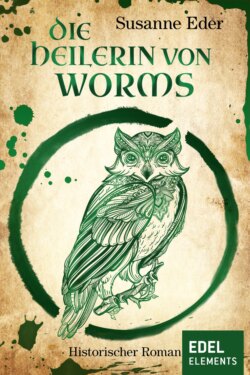Читать книгу Die Heilerin von Worms - Susanne Eder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеWorms, 2. November im Jahre des Herrn 1067
Ihr habt Euch um keinen Deut verändert«, bemerkte Bandolf, nachdem sein Vetter zum dritten Mal betont hatte, es sei ihm ein dringendes Anliegen, den Bischof alsbald wissen zu lassen, dass er, Notger von Onsheim, in Worms eingetroffen sei und Seiner Eminenz in jedweder Weise zur Verfügung stehe.
Bandolf versagte sich ein »Noch immer derselbe frömmelnde Wichtigtuer wie früher«, als er unter der Tafel einen unsanften Stoß an seinem Schienbein spürte und den warnenden Blick seiner Gattin Matthäa auffing.
Stattdessen brummte er nur unmutig in seinen Bart. Noch keine Hore war seit der Ankunft seines Vetters und dessen Gemahlin vergangen, und schon jetzt war ihm Notgers Anwesenheit von Herzen zuwider. Dabei war sein Vetter nur der erste der unwillkommenen Gäste, die in Kürze sein Heim bevölkern würden und ihm die lang ersehnte Rückkehr aus Sachsen madig machten.
Der Burggraf unterdrückte ein Seufzen.
Erst vor wenigen Wochen hatte der König Bandolf von Leyen aus seinen Diensten als Vogt der Buchenburg entlassen, und nach einem langen Jahr in Sachsen war der Burggraf von Worms endlich in sein Heim zurückgekehrt. Es war ihm jedoch nicht lange vergönnt gewesen, die stämmigen Beine wieder behaglich unter der eigenen Tafel auszustrecken. Kaum hatte er sich daran gewöhnt, von nun an Gattin und Schlafkammer mit seiner einjährigen Tochter zu teilen, hatte Reginhard von Köln, Propst des Domstifts und Archidiakon des Bischofs von Worms, für Sankt Martin ein Sendgericht einberufen.
Jeder Freie, der im Umland von Worms bis zu einem Tagesmarsch von der Stadt entfernt ein Stück Land besaß, war aufgerufen, sich am Tag des Heiligen Martin in der Kirche Sankt Alban vor den Toren der Stadt einzufinden, um dem Sendgericht des Bischofs beizuwohnen.
Kurz darauf hatte Notger von Onsheim seinem Vetter Bandolf in knappen Worten mitteilen lassen, da er einen Acker bei Worms besäße, der Bischof ihm zudem die Ehre erwiesen und ihn zum Sendschöffen berufen hätte und er daher eine Bleibe in Worms benötige, dürfe der Burggraf ihn, seine Gattin und sein Gefolge in Bälde in seinem Haus erwarten.
Zu Bandolfs Leidwesen hatte man nicht nur seinen Vetter – zweiten Grades, wie er stets betonte –, sondern auch seinen Onkel Grimbald zum Sendschöffen berufen, der ebenfalls ein Stück Land in der Nähe von Worms besaß. Grimbald schickte einen seiner Knechte zu Bandolf, der ihm wortgetreu und mit beneidenswert gelassener Miene ausrichtete, Grimbald vom Diemerstein wüsste zwar nicht, was er bei dem Popanz eines Sendgerichts zu schaffen hätte, da ihm die Sünden anderer Leute herzlich gleichgültig wären. Doch falls sein Neffe noch einen Platz an seinem Herdfeuer für ihn hätte, würde er sich in Kürze auf den Weg nach Worms machen. Wenn schon nicht, um den fetten Pfaffen auf dem Bischofsstuhl zufriedenzustellen, so doch wenigstens, um die Fortschritte seiner Patentochter in Augenschein zu nehmen.
Als würde es nicht schon verdrießlich genug werden, einen Eigenbrötler wie Grimbald und einen Moralapostel wie Notger zugleich unter seinem Dach beherbergen zu müssen, die sich noch dazu seit Jahren um das Erbe einer Hufe stritten, hatte auch noch Matthäas Tante Eltrudis ihren Besuch angekündigt. Ihr wolle scheinen, hieß es in ihrer Botschaft, das Fest des Heiligen Martin sei der geeignete Zeitpunkt, nach Worms zu kommen und dem Stift Sankt Martin eine Gans zu spenden, damit man daselbst drei Messen für ihren verstorbenen Gatten – Gott hab’ ihn selig – lesen würde.
Es stand gänzlich außer Frage, dass Eltrudis beabsichtigte, im Haus ihrer Nichte zu logieren.
»Allmählich erscheint mir das Leben eines Mönchs fernab jeglicher Verwandtschaft höchst erstrebenswert«, hatte Bandolf seine Gattin angeknurrt und sich gefragt, welche seiner Sünden den Allmächtigen wohl veranlasst hatte, ihn mit einem solchen Ansturm seiner Sippschaft zu strafen.
Der spöttische Unterton in Bandolfs Stimme war Notger offenkundig entgangen. »Mäßigung, lieber Vetter, Mäßigung«, antwortete er und strich sich mit einem selbstgefälligen Lächeln über das knochige Kinn. »Ich darf wohl behaupten, dass ich ein gottgefälliges Leben führe. Wie der Apostel Paulus sagt: ›Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist säet, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.‹ Habe ich nicht recht, meine Liebe?«
»Ganz, wie Ihr sagt«, bestätigte seine Gattin Medegund heiter, ohne den Blick von der Schüssel zu heben, die sie mit ihrem Gemahl teilte.
Um die Hälfte kleiner als ihr Gatte, der es, wenn schon nicht an Leibesumfang, so wenigstens an Größe mit dem stattlichen Burggrafen aufnehmen konnte, ließen Medegunds spitzes Gesicht, die kleinen, dunkel funkelnden Augen und die flinken Finger, mit denen sie zielgewiss die besten Bissen von der Tafel pickte, unweigerlich an eine Maus denken.
Bevor Bandolf erwidern konnte, was er von den Geistesgaben seines Vetters hielt, schien Matthäa den Ausdruck in seinem Gesicht richtig zu deuten und fragte hastig, ob Notger und seine Gemahlin denn eine angenehme Reise gehabt hätten.
Der Burggraf warf ihr einen verdrossenen Blick zu, doch Matthäa war just damit beschäftigt, die winzigen Hände ihrer Tochter im Zaum zu halten. Für einen Augenblick erheiterte Bandolf der Anblick der kleinen Lavinia, die mit einem Ausdruck höchster Aufmerksamkeit im pausbäckigen Gesichtchen bemüht war, aus dem Haarkranz ihrer Mutter rotblonde Locken herauszuziehen.
Als würde sie seinen Blick spüren, drehte die Kleine plötzlich den Kopf und starrte ihren Vater ernsthaft an. Dann warf sie die Arme in die Luft und krähte vergnügt.
›Ja, jetzt bist du plötzlich munter, nachdem du mich die halbe Nacht mit deinem Wehgeschrei wach gehalten hast‹, dachte Bandolf verdrießlich und schüttelte den Kopf, als er bemerkte, wie sich seine Lippen dennoch zu einem breiten Grinsen verzogen. Bisher war es ihm noch nicht gelungen, seiner Tochter lange gram zu sein, was ihn zuweilen trübe in die Zukunft blicken ließ.
»Die Straßen des Königs sind in einem beklagenswerten Zustand, von den Unterkünften, mit denen wir unterwegs vorliebnehmen mussten, ganz zu schweigen«, lenkte Notgers Antwort die Aufmerksamkeit des Burggrafen wieder auf seinen Vetter.
»Zwischen Mainz und Worms gibt es doch genügend Klöster, die einem Reisenden Unterkunft gewähren. Warum habt Ihr nicht dort um Quartier gebeten?«, erkundigte er sich.
Notger hob eine Braue. »Aber just hiervon spreche ich, lieber Vetter.« Augenscheinlich betrübt, schüttelte er den Kopf. »In den Klöstern, in denen wir logierten, frönte man einem bedauerlichen Hang zur Weltlichkeit. Und nicht nur das: Ich fand die Mönche unverschämt und gar so manchen Abt, der es meiner Person gegenüber am gebotenen Respekt fehlen ließ.«
›Du wirst dem Abt mit unwillkommenen Ratschlägen in den Ohren gelegen haben‹, dachte Bandolf und verdrehte die Augen.
»Ich stehe nicht an, Euch zu sagen, dass es höchste Zeit war, ein Sendgericht einzuberufen. Nur so kann Seine Eminenz dem Schlendrian ein Ende setzen, der sich allerorten eingeschlichen zu haben scheint. Wenn schon die Mönche nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist, wie wird es dann erst mit dem niederen Volk bestellt sein?«
Als der Burggraf wohlweislich keine Antwort darauf gab, fuhr Notger fort: »Wahrlich ein Glück, dass ich rechtzeitig genug in Worms eingetroffen bin, um meiner Pflicht als Schöffe nachzukommen.«
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Bandolf mit argwöhnisch gerunzelter Stirn.
»Nun, lieber Vetter, die Sündhaftigkeit des niederen Volks muss streng bestraft werden, sonst greift sie um sich, ehe wir dessen recht gewahr werden. Und ich erachte es als meine vornehmste Pflicht als Schöffe, solcherlei Sündhaftigkeit aufzuspüren, bevor das Sendgericht zusammentritt. Denn wie der Apostel uns lehrt: ›Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.‹ Habe ich nicht recht, meine Liebe?«
»Ganz, wie Ihr sagt«, nuschelte Medegund mit vollem Mund, während der Burggraf plötzlich den dringenden Wunsch verspürte, er wäre in Sachsen geblieben.
»Kommt nur weiter«, begrüßte Egin die Heilerin, nachdem er ihr die eingelassene Pforte im Tor zum Anwesen des Burggrafen geöffnet hatte.
Obwohl Garsende das Vorrecht besaß, in Bandolfs Haus ein- und ausgehen zu dürfen, wie es ihr beliebte, schlurfte der alte Torhüter neben ihr einher und schwatzte munter drauflos, während sie den Hof überquerten.
»Wenn Ihr wegen Filiberta kommt, sag’ ich’s Euch lieber gleich: Seit ihr Bein hinüber ist und die Herrin Rosalind ins Haus geholt hat, ist sie bockig wie eine alte Ziege. Wenn Ihr mich fragt, dann hat sie aber bloß Furcht, die Herrin könnt’ ihr Rosalind vor die Nase setzen, wenn Filibertas Bein nicht mehr wird.« Vertraulich die Stimme senkend, fügte er hinzu: »Wenn Ihr mich fragt, dann könnt’s wohl auch so weit kommen. Scheint wohl tüchtig zuzupacken, die Rosalind, und jung und fesch ist sie obendrein. Da können Filiberta und Hildrun die Neue noch so madig machen.«
Trotz ihrer Sorgen musste Garsende lächeln. Wie es schien, sorgte die neue Magd für reichlich Aufregung unter den Hauseigenen des Burggrafen.
Zu Michaeli hatte sich Filiberta, die Erste Magd der Burggräfin, bei einem unglücklichen Sturz das Bein gebrochen. Und da Matthäa alle Hände voll zu tun hatte, um Platz für die erwarteten Gäste zu schaffen, hatte sie sich kurzerhand eine Magd aus der Nachbarschaft ausgeliehen.
»Die Herrin könnt’ sich schon überlegen, mein’ ich, ob sie Rosalind der Lambsheimerin nicht abkaufen möcht’«, plapperte Egin weiter. »Immer fröhlich, das junge Ding, und hat für jeden ein gutes Wort übrig. Jacob sagt, sie tät’s, obgleich ich mich frag’, wie er das wissen will, wo er doch ...«
Garsendes Gedanken schweiften ab, und sie hörte nur noch mit halbem Ohr zu. Doch als der alte Torhüter schließlich meinte, wenn die Heilerin zur Herrin wollte, müsse sie auf ihre Rückkehr warten, alldieweil die Burggräfin mit Frau Medegund zur Messe gegangen sei, blieb sie abrupt stehen.
»Willst du damit sagen, dass die Gäste des Burggrafen schon eingetroffen sind?«
»Na, nicht alle. Da fehlen noch der Herr vom Diemerstein und die Tante der Burggräfin. Aber der Vetter vom Herrn, der ist zur Terz mit seinem Weib angekommen«, berichtete Egin. »Ein halbes Dutzend Knechte hatte der dabei und noch einen Leibknecht für sich, aber keine Magd, die seinem Weib aufwarten kann.« Trübe schüttelte er den Kopf. »Da weiß man doch gleich Bescheid, was man davon zu halten hat.«
»Verdammnis«, entfuhr es Garsende. Sie hatte lange mit sich gerungen, ob sie den Burggrafen aufsuchen sollte, und hatte sich auch sorgsam zurechtgelegt, was sie ihm sagen würde. Die Aussicht, ihm ihr Anliegen nun womöglich vor fremden Ohren unterbreiten zu müssen, kam ihr mehr als ungelegen.
Unschlüssig biss sie sich auf die Lippe. Vielleicht wäre es doch besser, wenn sie einfach abwartete, wie sich die Dinge entwickelten? Doch dann schüttelte sie den Kopf. Herrje, die Dinge standen doch schon schlimm genug. Was gab es da noch abzuwarten?
»Ich möchte mit dem Burggrafen sprechen«, sagte sie entschieden. »Ist dein Herr im Haus?«
Der Torhüter nickte. »Der Herr ist mit seinem Vetter drinnen. Geht nur hinein.«
Entgegen Egins Ankündigung fand Garsende den Burggrafen ohne seinen Gast in der Halle vor. Der grimmige Ausdruck in Bandolfs breitem, bärtigem Gesicht, mit dem er eine Schriftrolle studierte, die ausgebreitet vor ihm auf der Tafel lag, ließ Garsende vermuten, dass er nicht in bester Stimmung war.
Hinter dem Burggrafen stand sein Schreiber, und der träumerisch versunkene Blick, den der junge Prosperius unverwandt auf die Herdstelle richtete, galt offenkundig nicht dem Inhalt des Kessels über dem Herdfeuer, sondern der jungen Magd, die darin rührte.
Für einen Augenblick dachte Garsende an das Häuflein Elend, das Bandolf von Leyen im letzten Herbst nach Worms zurückgeschickt hatte. Doch was immer dazumal in Sachsen mit dem jungen Burschen geschehen war, inzwischen hatte er sich augenscheinlich wieder aufgerappelt. Dank der Fürsorge der Burggräfin und Filibertas Kost hatte er rasch wieder Fleisch auf die Rippen bekommen, und der ängstliche Ausdruck in seinen Augen war verschwunden.
Garsende wusste nicht genau, was in dem sächsischen Kloster vorgefallen war, in dem man Prosperius festgehalten hatte. Bei seiner Rückkehr hatte sie noch mit ihren eigenen Dämonen gekämpft, mit der Erinnerung an frostige Augen, die sie des Nachts im Traum verfolgten – Geister und Albträume, die sie mit der Burggräfin teilte.
Mit der Erinnerung an die Ereignisse im letzten Jahr tauchte das schmale Gesicht eines Mannes vor Garsendes geistigem Auge auf. Ein zärtlicher Blick aus dunklen Augen. Und ein Lächeln bar jeglichen Spotts. Inzwischen war mehr als ein Jahr vergangen, und sie hatte kein Sterbenswort mehr von Lothar gehört, seit er im Morgengrauen ihren Blicken entschwunden war. Der Abschied war schmerzlich gewesen, doch sie hatte gewusst, er würde zurückkehren. Wenn er konnte.
Ein schmerzlicher Stich jagte durch ihr Herz. Lothar von Kalborn ging einem gefährlichen Handwerk nach, und dass er nicht zurückgekommen war, konnte vermutlich nur eines bedeuten: Sein Handwerk hatte ihn umgebracht.
Garsende stieß ein tiefes Seufzen aus. Wenn er tot war, würde sie es vermutlich nie erfahren.
Erst als der Burggraf ihr zurief, sein Weib sei zur Messe gegangen, müsse aber bald wieder zurück sein, bemerkte sie, dass sie auf der Türschwelle stehengeblieben war. Rasch trat sie in die Halle und schloss die Tür hinter sich.
»Egin hat es mir schon gesagt«, antwortete sie. »Aber ich wollte mit Euch sprechen, wenn es Euch nicht ungelegen kommt?«
»Da ist mir heute ein anderer weit ungelegener gekommen«, brummte der Burggraf, rief nach Hildrun um einen neuen Krug Bier und bat die Heilerin, sich noch einen Augenblick zu gedulden, bis er mit »dieser vermaledeiten Angelegenheit« fertig wäre.
»Ich will ohnehin noch ein Auge auf Filibertas Bein werfen«, erwiderte Garsende, doch der Burggraf hatte sich bereits wieder über das Schriftstück gebeugt.
Filiberta saß unweit der Herdstelle auf einem Schemel und war damit beschäftigt, ein Huhn zu rupfen. Bei Garsendes Worten sah sie auf, griff nach der Krücke, die neben dem Schemel auf dem Boden lag, und machte Anstalten, sich hochzuhieven.
»Herrje, warum sagst du denn nichts? Du weißt doch, du sollst das nicht allein«, rief die junge Magd am Herdfeuer vorwurfsvoll und eilte rasch zu ihr, um ihr aufzuhelfen. Unwirsch schlug Filiberta die dargebotene Hand der Jüngeren weg. »Lass mich«, fauchte sie. »Kümmer du dich ums Nachtmahl, wie die Herrin dir angeschafft hat. Bist ohnehin schon säumig.«
Vielsagend verdrehte die junge Magd die Augen, doch in dem Blick, den sie der Heilerin über Filibertas Kopf hinweg zuwarf, lag soviel Schalk, dass Garsende unwillkürlich lächelte. Ähnlich wie Ebertine von Hollerborn hatte auch Rosalind honigfarbenes Haar und dunkle Augen, besaß jedoch keineswegs deren Schönheit. Aber das offenkundig sonnige Gemüt, das in ihrem runden, frischen Gesicht Ausdruck fand, machte allemal die allzu breiten Lippen und die kurze Nase vergessen. Kein Wunder, dass die junge Magd unter den männlichen Hörigen solche Aufmerksamkeit fand, dachte Garsende.
»Wenn du Hildrun dazu bewegen könntest, auf mich zu hören, wäre ich nicht zu spät mit dem Nachtmahl«, wandte sich Rosalind an die ältere Magd. »Könntest du sie mir nur ein wenig antreiben. Mach’s der Herrin zuliebe.«
»Eine wie du sagt mir nicht, was ich zu tun hab’«, schnappte Hildrun sogleich, offenkundig empört bei dem Gedanken, jemand, der im selben Alter war wie sie selbst, dürfe ihr Befehle erteilen. »Mach’s der Herrin zuliebe«, äffte sie Rosalind nach und schnitt ihr eine Grimasse. »Mach’s doch selber.«
»Jetzt ist’s aber genug«, wies Filiberta Hildrun zurecht. »Und was dich betrifft«, wandte sie sich scharf an Rosalind, »Wer hier wen wann schilt, bestimmen die Herrin und ich. Noch bin ich die Erste Magd im Haus. Das maßt du dir nicht an.«
»Als würd’ ich’s wagen«, meinte Rosalind mit einem Glucksen in der Stimme und kehrte schulterzuckend zum Herdfeuer zurück.
»Es ist töricht, wenn du Rosalinds Hilfe ausschlägst«, sagte Garsende leise zu Filiberta, während sie prüfte, ob die Holzschienen noch stramm genug um das gebrochene Bein saßen. »Du darfst mit dem Bein nicht auftreten, das weißt du doch. Oder willst du, dass es krumm zusammenwächst?«
»Helfen? Pah!«, schnaubte die stämmige Magd. »Mir Honig ums Maul schmieren, das will sie. Damit ich nicht merke, was sie hinter meinem Rücken treibt. Der Herrin schöntun, damit sie sie der Lambsheimerin abkauft. Erste Magd im Haus des Burggrafen, darauf ist das Gör’ aus. Darauf verwett’ ich meinen Hintern. Nur darum reißt sie sich ein Bein heraus und springt und tut.«
»Unsinn. Ich kann mir nicht denken, dass die Burggräfin dich entbehren kann«, versuchte Garsende sie zu beschwichtigen, doch Filiberta schüttelte betrübt den Kopf.
»Und wenn mein Bein nun nicht wieder wird?«
»Wenn du nichts Dummes tust und dir helfen lässt, wird’s schon wieder werden«, meinte Garsende leichthin und hoffte um Filibertas willen, dass sie Recht behalten würde. Sie hatte ihr Bestes getan, aber wie gut ein gebrochenes Glied wieder zusammenwuchs und wie beweglich es hernach wieder war, konnte man nur schwer voraussagen.
Als Garsende sich kurz darauf dem Burggrafen gegenüber auf die Bank setzte, rollte er just das Schriftstück zusammen und drehte sich zu Prosperius um, der noch immer mit andächtig geneigtem Kopf in die Betrachtung der jungen Magd am Herdfeuer versunken schien.
»Herrgottnocheins! Wo stierst du denn schon wieder hin?«, riss der Burggraf ihn unsanft aus der Verzückung.
Bis zu den Haarwurzeln errötend, zuckte Prosperius zusammen und schenkte der Heilerin ein verlegenes Lächeln.
»Bring das zum Propst von Sankt Paulus«, befahl Bandolf. »Und dann sagst du ihm, dass ich keinen weiteren Büttel entbehren kann, der ihm die Gassen um sein Stift im Auge behält. Reginhard von Köln hatte dasselbe Anliegen an mich, was den Dombezirk und die Gegend von Sankt Alban betrifft. Der Dompropst hat nun einmal Vorrang, und ich kann mir keine Büttel aus den Rippen schnitzen.«
Kopfschüttelnd sah der Burggraf seinem jungen Schreiber hinterher, als Prosperius auf dem Weg zur Tür über seine eigenen Füße stolperte und dann mit steifen Schritten aus der Halle stakste.
»Seit mein Weib die Magd der Lambsheimerin ins Haus gebracht hat, ist mit dem Bengel nichts mehr anzufangen«, brummte er.
»Und wie es scheint, ist er nicht der Einzige«, bemerkte Garsende erheitert.
Unmittelbar nach Prosperius’ unrühmlichem Abgang war der Pferdeknecht Jacob mit einem Stapel Holz eingetreten, den er nun Rosalind so feierlich überreichte, als überbrächte er ihr einen Schatz mit Juwelen.
Der Burggraf lachte. »Da solltest du erst das Gesäusel meines Hausmeiers hören, wenn das junge Ding in der Nähe ist. Herrje, der alte Kahlschädel sollte es nun wirklich besser wissen.«
Neugierig musterte sie ihn, doch der Burggraf selbst schien von Rosalinds Liebreiz unbeeindruckt zu sein.
»Was wolltest du mit mir besprechen?«, unterbrach er ihren Gedanken.
Auf dem Weg in die Münzergasse hatte sich Garsende sorgfältig zurechtgelegt, was sie ihm sagen würde, doch jetzt schien ihr Kopf mit einem Mal leer zu sein.
»Ich wollte Euch fragen ... Nun, ich dachte, Ihr könntet vielleicht...«
»Herrje, dumme Gans! Nimm dich zusammen!«, schalt sie sich. Wenn sie noch länger derart herumstammelte, würde ihre Geschichte noch dürftiger klingen als sie ohnehin schon war. Verärgert über sich selbst, ballte sie einen Augenblick die Hände.
»Vor ein paar Tagen ließ mich Guntram von Hollerborn in sein Haus rufen«, sagte sie schließlich. »Seine Tochter Ebertine klagte über ein Unwohlsein. Aber ich konnte nichts weiter an ihr entdecken als eine leichte Röte in ihrem Hals, ein schwaches Anzeichen für ein Geschnäuf.« Sie räusperte sich. »Um ehrlich zu sein, ich hatte den Eindruck, als spiele sie nur die Kranke.«
»Sie spielte die Kranke?«, wiederholte der Burggraf erstaunt.
Einen Moment lang dachte Garsende an den Anblick, der sich ihr geboten hatte, als sie die Kammer des blutjungen Weibes zum ersten Mal betreten hatte. Ebertine hatte mit strahlend blauen Augen, entzückend roten Lippen und einer Flut honigfarbener Locken auf ihrer Bettstatt gethront, während ihr junger Vetter Folcmar zu Füßen des Lagers versuchte, einer Rebec melodische Töne zu entlocken. Ein wenig abseits war Ansild mit einer Näharbeit beschäftigt gewesen, während Ebertines Base Kunigunde mit einem düsteren Ausdruck im Gesicht den erfolglosen Bemühungen ihres Bruders gelauscht hatte.
Ein schwaches Lächeln glitt über Garsendes Züge. »Sie sagte mir, sie litte an einem schweren Fieber, das sie auszehre und völlig schwäche«, antwortete sie. »Aber ich konnte beim besten Willen keinerlei Anzeichen dafür entdecken. Ihre Stirn war kühl und trocken, ihre Farben frisch, und sie hatte einen guten Appetit. Ihre Säfte schienen mir völlig im Gleichgewicht zu sein. Es war so, als genösse sie es einfach, dass jedermann im Haus ihr zu Diensten war.«
»Was geschah dann?«, wollte der Burggraf wissen, als sie nicht weitersprach.
»Nun, ich gab ihr einen Trank mit Honig, versetzt mit Engelsüß und Thymian, und am nächsten Tag war die Röte in ihrem Hals auch vollkommen verschwunden. Mir schien sie gänzlich wohlauf zu sein«, berichtete Garsende weiter. »Ebertine behauptete jedoch, sie fühle sich alles andere als wohlauf, brächte kaum einen Fuß aus der Bettstatt, so schwach sei ihr, und anderes mehr. Also bestand ihr besorgter Vater darauf, dass ich wiederkäme, um nach seiner Tochter zu sehen.« Garsende seufzte. »Nachdem ich dann drei weitere Tage etwas geheilt hatte, das nicht vorhanden war, hatte Ebertine ihr Spiel dann offenbar über. Sie verkündete ihrem Vater, sie fühle sich wieder gesund, und abgesehen davon würde der Anblick der mürrischen Heilerin sie verdrießen.«
Als Bandolf ein erheiterter Laut entfuhr, warf sie ihm einen ärgerlichen Blick zu. »Glaubt mir, Burggraf, zum Lachen ist mir nicht zumute«, sagte sie scharf.
»Ja, das sehe ich«, bemerkte er. »Fahr fort.«
»Nur wenige Stunden später klopfte Irma an die Tür meiner Hütte«, sagte sie nach kurzem Zögern. »Sie war ...«
»Irma?«, unterbrach sie der Burggraf.
»Die Magd in Guntram von Hollerborns Haus«, erklärte Garsende. »Ich müsse sofort in die Salzgasse kommen, sagte sie, ganz außer Atem. Mit der jungen Herrin sei etwas ganz und gar nicht in Ordnung.«
Einen Augenblick lang hielt Garsende inne. Nach einem tiefen Atemzug fuhr sie fort: »Tatsächlich fand ich das junge Weib völlig verändert vor. Sie litt unter heftigen Krämpfen, hatte einen übelriechenden Auswurf und ...«
Hastig winkte der Burggraf ab. »Es ging ihr also schlecht«, konstatierte er.
»Sehr schlecht.«
»Und dann?«
»Nur wenige Stunden später starb sie. In meiner Obhut!«
»Guntrams Tochter ist ihrem Leiden erlegen, und ...?«, hakte er nach, als Garsende nicht weitersprach.
»Sie starb mir einfach unter den Händen weg, versteht Ihr?«
»Nun, offen gestanden, nein«, meinte der Burggraf und runzelte die Stirn. »Sie war doch sicher nicht die erste Kranke, die in deiner Obhut gestorben ist?«
Ärgerlich über seine Begriffsstutzigkeit, platzte sie heraus: »Ich glaube, sie starb vor ihrer Zeit.«
Offenkundig verblüfft hob der Burggraf die Brauen. »Du glaubst, sie wurde getötet?«, vergewisserte er sich. »Wie kommst du darauf? Ich dächte, es sei so ungewöhnlich nicht, dass jemand an Krämpfen und Auswurf stirbt?«
Garsende senkte den Kopf und seufzte. Schon hatte er den Finger auf den wunden Punkt gelegt. »Derlei kommt vor«, gab sie leise zu. »Aber Ebertine war jung, kräftig und, wie es schien, auch völlig gesund. Ihr Ende kam viel zu rasch.«
»Und wenn sie nun ... ?«
»Nein, Burggraf«, unterbrach sie ihn. »Es gab auch keinerlei Anzeichen, dass sie an einer der Geißeln Gottes erkrankt wäre, die auch die Jungen von einer Höre zur nächsten dahinraffen.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Als Garsende den Kopf hob, fand sie den Blick des Burggrafen nachdenklich auf sich gerichtet. »Nehmen wir an, du hast recht, und Guntrams Tochter starb keines natürlichen Todes«, sagte er endlich. »Woran starb sie dann?«
»Womöglich war es ein Gift.«
»Womöglich?«
»Nun, es gibt Gifte, deren Anzeichen recht deutlich sind, aber in diesem Fall...« Garsende stockte.
»Du bist dir also nicht sicher?«
Garsende schüttelte den Kopf.
»Hast du jemanden in Verdacht, der Guntrams Tochter übel wollte?«, fragte er.
Erneut schüttelte sie den Kopf.
»Hmm«, brummte der Burggraf. »Du weißt nicht, wie sie gestorben ist, noch hast du jemanden in Verdacht. Warum glaubst du dann, dass das Mädchen ermordet wurde?«
»Weil jede einzelne Faser in mir das sagt«, dachte sie. Aber das würde den Burggrafen schwerlich überzeugen.
»Ich weiß selbst, wie dürftig das klingt«, gab sie heftiger als gewollt zurück. »Aber da ist noch etwas anderes«, sagte sie rasch, während sie einen der Beutel an ihrem Gürtel aufnestelte. Mit spitzen Fingern zog sie den Katzenschwanz heraus, den sie unter Ebertines Lager gefunden hatte. Um den verfluchten Gegenstand nicht länger als nötig in der Hand halten zu müssen, legte sie ihn auf die Tafel und schob ihn mit Hilfe ihres Zeigefingers zu Bandolf hinüber.
Mit gerunzelter Stirn starrte er den Schwanz an. Dann warf er ihr einen fragenden Blick zu: »Was, zum Teufel, ist das?«
»Das ist der Schwanz einer schwarzen Katze.«
»Das sehe ich«, brummte er.
»Seht Ihr auch dieses Kraut? Jemand hat den Katzenschwanz mit Teufelsbeeren umwickelt und ihn Ebertine von Hollerborn unter die Bettstatt geschoben.« Vielsagend wiederholte sie: »Teufelsbeeren!«
Offenkundig verstand er nicht, was sie meinte. »Und was hat es damit auf sich? Sind die Beeren giftig?«
Ungeduldig wedelte sie mit der Hand. »Ja, das sind sie. Aber hätte sie Teufelsbeeren zu sich genommen, würde ich die Anzeichen sehr wahrscheinlich erkannt haben. Außerdem schmecken die Beeren sehr bitter. Unfreiwillig isst man kaum mehr als höchstens ein, zwei Beeren. Davon hätte sie zwar auch Krämpfe bekommen, aber sie wäre nicht daran gestorben. Meistens sind es Kinder in einem Alter, da sie grundsätzlich alles in den Mund stecken, was ihnen unterkommt, die an den Beeren erkranken und sterben«, erklärte sie. »Nein, die Teufelsbeeren dienten dazu, den Schwanz der Katze zu besprechen. Das hier ist ein Fluch.«
»Verdammmich!«, knurrte der Burggraf und schlug rasch ein Kreuz. Dann fasste er sie scharf ins Auge. »Woher weißt du das?«
»Kommt mir jetzt nur nicht wieder mit Eurem Argwohn daher«, fauchte sie wütend. »Ich weiß es eben. Dass ich derlei nicht tue, solltet Ihr mittlerweile doch wissen!«
Eine steile Zornesfalte erschien auf seiner Stirn.
Im Augenblick war ihr nicht danach zumute, mit ihm zu streiten, daher schluckte sie die bissige Antwort hinunter, die ihr noch auf der Zunge lag.
Während Bandolf nachzudenken schien, beobachtete sie verstohlen sein breites bärtiges Gesicht, dessen Ausdruck von Ärger zum Zweifel wechselte. Ihr Mut sank. Wie konnte sie ihn nur davon überzeugen, dass sie Recht hatte?
»Zur Gänze kannst du nicht ausschließen, dass Guntrams Tochter einer Krankheit zum Opfer fiel, und dass man ihr ein Gift verabreicht hat, kannst du auch nicht sicher sagen«, brach der Burggraf schließlich das Schweigen. »Und es gibt auch niemanden, der diesbezüglich deinen Verdacht erregt hat. Was du da vorbringst, ist recht dürftig und vage. Ich wüsste nicht...«
»Und der Katzenschwanz?«, wandte sie hastig ein.
Der Burggraf schüttelte den Kopf. »Wenn jemand beabsichtigte, Guntrams Tochter umzubringen, würde er sie dann noch mit einem Fluch belegen, um ihr zu schaden? Was ergibt das für einen Sinn?«
»Womöglich hat man sie vergiftet, weil der Fluch nicht die gewünschte Wirkung zeigte«, bot sie an.
Plötzlich zog er die Brauen zusammen. »Da ist doch noch mehr?«, forschte er. »Heraus damit! Warum ist dir so an dem jungen Weib gelegen?«
Garsende unterdrückte ein Seufzen. Da sie ihm zu Ebertines Tod nichts wirklich Greifbares sagen konnte, hatte sie geahnt, dass er diese Frage stellen würde. Aber was für eine Antwort konnte sie ihm geben? Wie dieses schleichende Etwas in Worte fassen, das die Gemüter in der Stadt zu vergiften schien und sie allmählich zu Tode ängstigte?
Das, was sie befürchtet hatte, war eingetreten.
Vor drei Tagen war Ebertine gestorben. Sie war noch nicht unter der Erde gewesen, als man in der Stadt schon gemunkelt hatte, dass die Drude schuld am Tod des jungen Weibes sei. Erst gestern war der Leichnam zu Grabe getragen worden, und heute hatte man ihr auf dem Weg in die Münzergasse »Giftmischerin« hinterhergezischt und sie mit Dreckklumpen beworfen.
Garsende hatte nicht ausmachen können, wer den Unrat geworfen hatte, doch als sie erschrocken herumgewirbelt war, hatte sie in Gesichter voller Wut und Häme geblickt. Was würde als Nächstes geschehen, wenn es ihr nicht rasch gelang, die Menschen von ihrer Unschuld zu überzeugen?
»Wenn Ebertine vergiftet wurde und Ihr den Täter entlarven könnt, wird niemand mir ihren Tod anlasten können«, platzte sie heraus.
Für einen Augenblick runzelte der Burggraf verdutzt die Stirn. Dann lachte er. »Was redest du denn da für einen Unfug? Wer, in aller Welt, sollte dir den Tod dieses jungen Weibes anlasten wollen?«
»Herr im Himmel, Burggraf! Seid Ihr denn blind und taub?«, entfuhr es ihr gereizt. »Ihr müsst doch wissen, was in der Stadt über mich geredet wird!«
»Seit wann scherst du dich um das Geschwätz der Leute?«
»Seit man mir auf der Gasse ›gottlose Drude‹, ›Hure‹ und Schlimmeres nachruft, mich mit Unrat bewirft und ich dankbar sein kann, dass der Wächter mich am Stadttor noch nicht abweist«, rief sie aufgebracht.
»Bist du sicher, dass du dir da nichts einredest?«, brummte er. Die Ungläubigkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören.
Erneut lag ihr eine verärgerte Antwort auf der Zunge, doch es gelang ihr, an sich zu halten. Vielleicht war ihm tatsächlich nichts darüber zu Ohren gekommen? Es war gut möglich, dass man sich dem Burggrafen gegenüber mit Anschuldigungen gegen sie noch zurückhielt. Selbst der Dümmste in Worms wusste vermutlich, dass sie in seinem Haus noch immer willkommen war.
»Nun?«
Garsende sah auf und begegnete einem skeptischen Blick.
»Ihr seid noch in Sachsen gewesen, als ein Tuchweber starb, an dessen Lager man mich gerufen hatte«, begann sie. »Die Witwe gab mir die Schuld an seinem Tod. Überall posaunte sie hinaus, es wäre die Drude mit ihren teuflischen Tränken gewesen, die ihren Mann unter die Erde gebracht hätte. Zu Anfang glaubte ihr wohl niemand. Aber dann bemerkte ich, dass die Leute anfingen, mir argwöhnisch hinterherzuschauen und über mich zu flüstern. Irgendwann schien die Witwe sich dann wieder beruhigt zu haben. Die bösen Zungen verstummten allmählich, und als die ersten Blätter fielen, glaubte ich, dass die Angelegenheit vergessen sei.« Garsende seufzte. »Aber ich hatte mich geirrt. Vor einiger Zeit bemerkte ich, dass man hinter meinem Rücken wieder tuschelte und mir böse Blicke zuwarf. Und seither ...« Garsende schluckte. »Dieses Mal hörte das Gerede nicht wieder auf. Und inzwischen ist es so schlimm geworden, dass man ganz offen ›Hure‹ und ›Teufelsweib‹ hinter mir herzischt und mich mit Schmutz bewirft.«
Mit gemischten Gefühlen sah sie, dass sich der Ausdruck im Gesicht des Burggrafen verändert hatte. »Wie lange geht das schon so?«, fragte er, offenkundig ergrimmt.
»Genau weiß ich es nicht. Etwa seit Michaeli.«
»Ist zu Michaeli irgendetwas geschehen?«, fragte er.
Unglücklich schüttelte sie den Kopf. »Nichts. Gar nichts. Nicht das Geringste! Ich kann mir überhaupt nicht erklären, was die Leute derart gegen mich aufgebracht hat. Aber wenn es nun die Runde in der Stadt macht, dass die Tochter eines Edelmanns in meiner Obhut gestorben ist...« Die Stimme versagte ihr den Dienst.
Schweigend füllte der Burggraf seinen Becher aus dem Krug nach, den Hildrun an die Tafel gebracht hatte, doch er trank nicht.
Sein Stirnrunzeln vertiefte sich, während er den Becher in seiner Hand kreisen ließ und mit schmalen Augen der Bewegung folgte.
»Zu Michaeli hat Reginhard von Köln das Sendgericht ausgerufen«, murmelte er in seinen Becher.
›Als ob ich das nicht wüsste‹, dachte sie.
Als hätte er einen Entschluss gefasst, hob er plötzlich den Kopf und nickte. »Dann lass uns sehen, ob an deinem Verdacht etwas Wahres ist. Berichte mir alles, was du über Guntram von Hollerborn und dessen Familie weißt und was sich in diesem Haus ereignet hat«, befahl er.
Selbst überrascht, wie schwer die Last gewogen hatte, die ihr mit einem Mal um vieles leichter zu tragen schien, schloss Garsende für einen Augenblick die Augen.