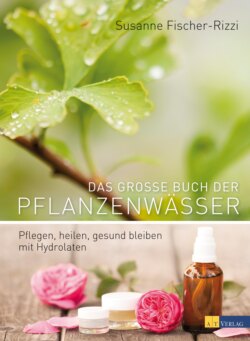Читать книгу Das grosse Buch der Pflanzenwässer - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSPRAY & CO.
WIE WENDET MAN PFLANZENWÄSSER AN?
»Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften, sagte das kluge Füchslein zum kleinen Prinzen.« ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Oft werde ich gefragt, was man mit Pflanzenwässern alles machen kann, wie man sie verarbeitet und welche Rezepte sich dazu eignen. In diesem Kapitel habe ich deshalb die Anwendungsmöglichkeiten und die dazugehörenden Rezepte zusammengestellt. Der letzte Satz dieses Kapitels müsste jedoch lauten: »… und vieles mehr.« Denn wenn man Pflanzenwässer zur Verfügung hat, ergeben sich viele weitere Möglichkeiten, den Alltag damit zu bereichern.
Pflanzenwässer herzustellen, sie zu kosmetischen Produkten, für Wellness und heilende Anwendungen zu verarbeiten, das schenkt ein gutes Gefühl von Selbstbestimmtheit und einer gewissen Unabhängigkeit vom Konsum vorgefertigter Waren.
Spüren Sie in der Anwendung der Pflanzenwässer das Besondere dieser Geschenke der Natur, lassen Sie sich stärken und nähren vom »wilden Herz der Pflanzen«, wie die Pflanzenwässer auch genannt werden.
Wenn Sie die Pflanzenwässer kennenlernen und damit auch einige Rezepte ausprobieren möchten, dann eignen sich für den Anfang schon einige wenige als Grundausrüstung wie:
→ Rosenwasser
→ Orangenblütenwasser
→ Lavendelwasser
→ Cistrosenwasser
→ Pfefferminzwasser
→ 1 Nadelbaumwasser wie Weißtannenwasser, Douglasienwasser, Zirbelkieferwasser
→ 1 Zitruswasser wie Limettenwasser, Orangenwasser
Diese Pflanzenwässer können Sie dann in vielen verschiedenen Anwendungen und Rezepten verwenden.
Maßeinheiten in den Rezepten:
| EL | = | Esslöffel |
| TL | = | Teelöffel |
| ml | = | Milliliter |
| g | = | Gramm |
| Msp. | = | Messerspitze |
| Teil | = | Volumenteil |
Die Angaben zu den Maßeinheiten sind teilweise in Gramm, teilweise in Milliliter angegeben. Bitte halten Sie sich daran, da es auf genaues Abmessen der jeweiligen Zutaten ankommt.
IN DER RAUMLUFT
Raumspray (Airspray)
Mit ein paar Pumpstößen Pflanzenwasser aus der Sprühflasche kann die Raumluft in Räumen, im Auto, im Hotelzimmer, in Bad und WC verbessert und aufgefrischt werden. Pflanzenwässer dienen so auch als Ansteckungsschutz, da manche eine desinfizierende Wirkung besitzen. Dafür werden die Pflanzenwässer pur oder weniger stark duftende Pflanzenwässer auch in Mischungen mit ätherischen Ölen versprüht. Meist reicht eine dezente, aber wirkungsvolle Raumbeduftung. Wünscht man ein noch intensiver duftendes Raumspray, zum Beispiel zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche oder zur Desinfektion, werden dem Pflanzenwasser pro 100 ml 5–25 Tropfen ätherisches Öl – je nach gewünschter Duftintensität – zugefügt. Eine höhere Dosis an ätherischem Öl löst sich besser, wenn man dafür Alkohol als Lösungsmittel verwendet. Der Duft der ätherischen Öle, besonders der Zitrusöle, wie auch dickflüssige Extrakte oder Absolues wie Bienenwabenabsolue, Vanilleextrakt, aber auch die ätherischen Öle von Benzoe Siam, Weihrauch und Myrrhe lösen sich mit Alkohol besser im Pflanzenwasser. Sie werden in der Flasche zunächst im Alkohol verschüttelt. Dann wird mit Pflanzenwasser aufgefüllt. Die im Handel angebotenen Pflanzenwässer beinhalten meist Alkohol. Man kann darin noch zusätzlich ätherische Öle verschütteln, falls sie nicht schon mit ätherischen Ölen versetzt wurden.
Pflanzenwässer mit Alkohol sollten Sie nicht als Raumspray anwenden für: Babys, Kleinkinder, Kinder, alkoholkranke Menschen und bei Schwerkranken.
GRUNDREZEPT RAUMSPRAY MIT ALKOHOL
| ätherische Öle | 15–25 Tropfen, je nach gewünschter Duftintensität |
| Alkohol (Weingeist 96 %) | 10–20 ml |
| Pflanzenwasser | 70–90ml |
Die ätherischen Öle in einer Sprayflasche gut im Alkohol verschütteln. Mit Pflanzenwasser auffüllen und erneut schütteln. Je höher die Alkoholkonzentration, desto mehr ätherisches Öl löst sich im Wasser.
Duftlampe
Duftlampen gibt es mit Kerze oder elektrisch betrieben. Sie eignen sich zur sanft wirksamen, dezenten Beduftung kleiner und mittelgroßer Räume. Dabei verwendet man, je nach Duftintensität, das Pflanzenwasser meist pur oder mit Wasser gemischt.
Zimmerbrunnen
Das Pflanzenwasser wird hierfür ins Wasser des Zimmerbrunnens gegeben. Zur sanften Beduftung kleiner Räume geeignet.
Destillation mit einer Glasdestille
Aromadiffuser
(Diffuser, Diffusor, Aromavernebler, Aerosol)
Das Pflanzenwasser und auch zugefügte ätherische Öle werden durch Ultraschallverneblung sehr fein kalt verdampft und so in die Raumluft gebracht. Der Aromadiffuser eignet sich für eine einfache und sehr wirkungsvolle Raumbeduftung. Vorsicht: Manche Modelle der Aromadiffuser sind nur für ätherische Öle und nicht für die Befüllung mit Pflanzenwässern ausgestattet. Diese Art von Verdampfung der Pflanzenwässer kann kleine wie auch große Räume beduften.
Körperumfeldspray
Versprühen Sie einige Sprühstöße aus der Flasche im Kopf- und Brustbereich um sich herum und atmen Sie den Duft bewusst ein. Hierfür eignen sich fast alle Pflanzenwässer.
Kissenspray
Einige Sprühstöße eines Pflanzenwassers wie zum Beispiel aus Holunderblüten, Melisse oder Lindenblüten werden vor dem Schlafengehen auf das Kopfkissen gesprüht und sorgen so für einen guten Schlaf.
Sauna
Geben Sie 10–50 ml Pflanzenwasser, je nach gewünschter Duftintensität, in eine Kelle Wasser zum Saunaaufguss, um die abwehrstärkene, reinigende, belebende Wirkung der Sauna zu verstärken. Gerade die Pflanzenwässer aus den Nadelbäumen wie Douglasie, Latschenkiefer und Weißtanne, die auch heilsam auf die Atemwege wirken, versetzen uns beim Saunagang in einen erholsamen Nadelwald.
ÄUSSERLICHE ANWENDUNG
Hauttest
Pflanzenwässer werden in der Regel sehr gut vertragen. Unerwünschte Hautreaktionen sind selten, jedoch besonders bei Menschen, die zu Allergien neigen, möglich. Testen Sie die Verträglichkeit der in den Pflanzenporträts als eventuell hautreizend beschriebenen Pflanzenwässer vor der ersten Anwendung auf Ihrer Haut. Sprühen oder reiben Sie das Pflanzenwasser auf die Haut der Innenseite der Armbeuge (Ellenbeuge). Sollten Sie allergisch reagieren, tritt eine Reaktion nach einigen Sekunden bis nach maximal 30 Minuten auf. Es kann zu Rötung, Juckreiz oder Pustelbildung kommen. Verzichten Sie in diesem Fall auf die Anwendung dieses Pflanzenwassers.
Bei der Destillation von Pflanzen, die reichlich ätherisches Öl enthalten, wie Lavendel, Fenchel, Salbei, Pfefferminze, kann mehr Öl anfallen, als das Pflanzenwasser aufnehmen kann. Das ätherische Öl schwimmt dann auf der Wasseroberfläche und kann bei der Anwendung die Haut oder die Schleimhäute reizen. Nehmen Sie, wenn das Pflanzenwasser auf der Haut angewendet werden soll, das ätherische Öl mit einem Löschpapier ab. Das duftende Löschpapier kann zur Beduftung von Schränken, Wäsche, Briefpapier usw. verwendet werden. Das ätherische Öl kann auch mit einer feinen Pipette (Haarpipette) abgenommen werden und eignet sich zum Mischen mit einem fetten Trägeröl. Es ergibt so ein duftendes Massageöl oder eine Grundlage für eine Second-Skin-Mischung. Bei größeren Destillen kann mehr ätherisches Öl anfallen. Dieses wird mit einem Trenngefäß, einer Florentiner Flasche, vom Wasser abgeschieden. Wird das Pflanzenwasser zur Raumbeduftung verwendet, kann das ätherische Öl im Pflanzenwasser verbleiben. Vor der Anwendung zum Beispiel als Raumspray sollte die Flasche gut geschüttelt werden, damit sich Wasser und ätherisches Öl kurzzeitig verbinden.
Körperspray
Das Pflanzenwasser wird auf die betreffenden Hautstellen, in einem begrenzten Hautareal gesprüht, zum Beispiel bei Insektenstichen, Schwellungen, Zerrungen, Wunden, Ausschlägen oder Sonnenbrand. Bei Sonnenbrand wirken manche Pflanzenwässer wie die aus Holunderblüten, Lavendelblüten oder Hamamelisrinde entzündungshemmend und beruhigend. Für Handoder Fußsprays dienen manche Pflanzenwässer zur leichten Desinfektion. Pflanzenwässer wirken als Körperspray wunderbar erfrischend und entstauend bei schweren, gestauten und müden Beinen und kreislaufanregend auf Unterarme und Waden, zum Beispiel das Rosmarinwasser. Oft reicht schon ein einzelnes Pflanzenwasser, um müde, gestaute Beine zu erfrischen. Es können jedoch auch ätherische Öle und Tinkturen aus Heilpflanzen dazugemischt werden.
GRUNDREZEPT SPRAY FÜR MÜDE BEINE
| Heilpflanzentinktur (45–70 %), z. B. aus Rosskastanie, Weinlaub, Mäusedorn | 5–10 ml |
| ätherische Öle, z. B. aus Pfefferminze, Douglasie, Lavendel | 8–10 Tropfen |
| Pflanzenwässer, z. B. aus Honigklee, Douglasie, Rosmarin, Salbei, Hamamelis, Angelika | 90 ml |
In einer 100-ml-Sprayflasche die ätherischen Öle in der Tinktur verschütteln. Mit Pflanzenwasser auffüllen und nochmals schütteln. Vor der Anwendung einen Hauttest machen. Zum Einsprühen und Einreiben.
Body Splash
Das Pflanzenwasser wird auf Körperteile oder, wie eine feine Dusche, auf den ganzen Körper gesprüht. Wundervoll erfrischend im Sommer. Auch geeignet vor einer Massage oder vor dem Einölen des Körpers nach Bad oder Dusche. Ein Body Splash ist eine Wohltat im Krankenbett, wenn ein Bad oder eine Dusche nicht möglich sind. Für ein Body Splash eignen sich zum Beispiel die Pflanzenwässer aus Apfelblüte, Myrte, Orangenblüte, Rosenblüte, Pfefferminze und Kornblumen. Die reinen Pflanzenwässer sind meist schon das pure Vergnügen. Es können aber auch ätherische Öle wie auch Alkohol zugefügt werden. Body Splash aus reinen Pflanzenwässern halten sich bei Gebrauch 4–6 Wochen. Wird Alkohol oder Heilpflanzentinktur (jeweils 70-prozentig) zugefügt – 5 ml auf 100 ml Pflanzenwasser –, wirkt das Body Splash etwas kühlender auf der Haut und hält sich bei Gebrauch bis 8 Wochen. Der Alkohol kann allerdings die Haut leicht austrocknen. Bei trockener Haut deshalb Body Splash ohne Alkohol verwenden.
Nasendusche
Pflanzenwässer können pur oder verdünnt, je nach Stärke des Pflanzenwassers in der Nasendusche eingesetzt werden. Verwenden Sie dazu nur Pflanzenwässer, die in den Pflanzenporträts explizit dafür empfohlen werden. Pro Nasendusche reichen in der Regel einige Tropfen. Es eignen sich Pflanzenwässer zum Beispiel aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Fenchel oder Myrte.
Waschungen
Für Teilwaschungen oder Ganzkörperwaschungen, als angenehm duftende Unterstützung der Körperpflege und zur Atemstimulierung werden die Pflanzenwässer in Wasser verdünnt: 3 EL auf 1–2 Liter Wasser, je nach Duftintensität des Pflanzenwassers. Für erfrischende Waschungen eignen sich Pflanzenwässer wie Lavendelwasser, Pfefferminzwasser oder Douglasienwasser.
Roller
In einen Roller (Roll-on-Stift), der 10–30 ml Flüssigkeit fasst, werden Pflanzenwässer wie auch ätherische Öle gefüllt, verschüttelt und die Haut damit punktuell, zum Beispiel bei Insektenstichen, Kopfschmerzen, Schwellungen, Wetterfühligkeit, bestrichen. Ein Roller dient auch zur Behandlung von Akupunkturpunkten. Die ätherischen Öle können im Roller zuvor mit einigen Tropfen 96-prozentigem Weingeist verschüttelt werden, bevor mit Pflanzenwasser aufgegossen wird. So lösen sie sich besser im Pflanzenwasser. Für einen Kopfschmerz-Roller eignet sich zum Beispiel das Pflanzenwasser aus Pfefferminze oder Melisse, bei Wetterfühligkeit Zirbelkiefer, Wiesenkönigin, Melisse.
Inhalation/Gesichtsdampfbad
Auf 1–2 Liter heißes Wasser in einer Schüssel gibt man zur Inhalation 2–4 EL Pflanzenwasser, je nach Duftintensität, zum Beispiel bei Erkältung oder Nasennebenhöhlenentzündung. Das Gesicht wird dabei über die Schüssel gehalten und ein großes Handtuch über Kopf und Schüssel ausgebreitet, sodass es über den Schüsselrand reicht. Schließen Sie die Augen. Dauer der Inhalation: circa 5 Minuten.
Bei Erkältungskrankheiten können die Pflanzenwässer auch mit einem Inhalationsgerät, das vor Nase und Mund gehalten wird, inhaliert werden.
In akuten Fällen 2–3-mal täglich anwenden. Manche Pflanzenwässer, wie zum Beispiel aus Thymian, können eventuell empfindliche Haut reizen und werden deshalb bei Erkältungskrankheiten besser in einem Inhalationsgerät angewendet und nicht über einer Schüssel inhaliert. Zur sanften und sehr milden Inhalation von Pflanzenwässern, zur Vorbeugung und Behandlung der Erkrankungen der Atemwege eignet sich auch ein Macholdt-Inhalator (Apotheke). Er ist klein und handlich und kann auch auf Reisen verwendet werden. Für Inhalationen eignen sich besonders Eukalyptuswasser, Myrtenwasser, Douglasienwasser oder Weißtannenwasser.
Gurgeln/Spülen
Je nach Stärke des Pflanzenwassers 1–2 EL Pflanzenwasser auf ½–1 Glas Wasser geben und bei Erkrankungen der oberen Atemwege mehrmals täglich gurgeln. Für Mundspülungen, zum Beispiel bei Mundschleimhautentzündungen und zur Pflege des Zahnfleisches, werden 1–2 TL Pflanzenwasser mit ½ Glas Wasser verdünnt.
Eiswürfel
Die Pflanzenwässer können portionsweise als Würfel oder dünne Platten eingefroren werden. Sie dienen dann zur kühlen Auflage bei Schwellungen, Prellungen oder Insektenstichen. Für kalte Kompressen können die Würfel oder Platten auch in ein Kompressentuch gewickelt werden. Es eignen sich gut Pfefferminzwasser, Limettenwasser, Hamameliswasser.
Bäder
Die therapeutische Anwendung von ätherischen Ölen und Pflanzenwässern wird im Rahmen der Bädertherapie der Naturheilkunde seit Langem geschätzt.
Pflanzenwässer eignen sich hervorragend für Bäder. Die entspannende oder kräftigende Wirkung der Bäder wird durch die Pflanzenwässer gesteigert. Sie lösen sich gut im Badewasser, sollten aber dem Wasser erst kurz vor dem Baden beigemischt werden. Ihre Wirkstoffe werden über die Haut aufgenommen. Der aufsteigende Duft, der in die Nase dringt, entfaltet zusätzlich seine wohltuende Wirkung auf die Psyche wie auch auf die Atemwege. Bäder mit therapeutisch wirksamen Pflanzenwässern machen Ihr Bad zu einem Kurort.
Armbad
Armbäder sind eine bekannte und sehr bewährte Anwendung aus der Wassertherapie nach Pfarrer Kneipp. Sie sind effektiv und leicht durchzuführen. Man benötigt ein größeres Waschbecken oder eine große Schüssel. Dem Wasser werden 50–80 ml Pflanzenwasser, je nach gewünschter Duftintensität, zugefügt.
Kaltes Armbad: Kalte Armbäder werden »Kneippscher Espresso« genannt, sie wirken kreislaufanregend wie eine Tasse Espresso am Morgen.
Nur durchführen, wenn Arme und Hände warm sind. Die angewinkelten Arme werden bis zur Mitte der Oberarme für 10–30 Sekunden in kaltes Wasser getaucht. Nicht abtrocknen, nur abstreifen. Dem Wasser werden Pflanzenwasser, zum Beispiel aus Douglasie, Limette, Rosmarin, Wacholder oder Zirbelkiefer, zugefügt. Wirksam bei zu niedrigem Blutdruck, stärkt die Abwehrkräfte, fördert die Blutzirkulation, hilft bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Wetterfühligkeit. Nicht anwenden bei Herzerkrankungen.
Warmes Armbad: Das Wasser darf 36–38 Grad warm sein. Ein Armbad dauert 10–20 Minuten. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und genießen Sie die Anwendung. Im Anschluss, im Sinne Kneipps, die Arme ganz kurz mit kaltem Wasser abspülen. Es passen Pflanzenwässer aus Melisse, Lavendel, Lindenblüte, Rosengeranie oder Iriswurzel. Warme Armbäder wirken wunderbar entspannend und ausgleichend, besonders bei Stressbeschwerden. Sie sind die »Beruhigungstablette der Wasserheilkunde«.
Fußbad
Ein duftendes, warmes Fußbad kann eine wahre Wohltat für Körper und Seele sein.
Fußbäder beeinflussen reflektorisch den ganzen Organismus. Die Haut der Fußsohlen nimmt besonders gut die Wirkstoffe aus den Pflanzenwässern auf. Der berühmte Kräuterexperte Maurice Mességué verordnete vorwiegend und mit großem Erfolg Hand- und Fußbäder. Fußbäder wirken, je nach verwendetem Pflanzenwasser, abwehrstärkend, beruhigend, erwärmend, entspannend, krampflösend und schlaffördernd. Für ein Fußbad werden dem etwa 37 Grad warmen Wasser in einer Schüssel oder Wanne circa 50–80 ml Pflanzenwasser, je nach gewünschter Duftintensität, zugegeben. Ein warmes Fußbad, zum Beispiel mit Rosmarinwasser, ist eine bewährte Hilfe bei chronisch kalten Füßen. Warme Fußbäder sind eine bewährte Einschlafhilfe. Man wendet sie ½ Stunde vor dem Schlafengehen an. Es eignen sich: Melissenwasser, Lavendelwasser, Lindenblütenwasser und Holunderblütenwasser. Zusätzlich zum schlaffördernden Fußbad können dem Wasser 2–3 EL Totes Meersalz beigemischt werden. Keine heißen Fußbäder anwenden bei Krampfadern oder bei Lymphödem.
Kühle oder kalte Fußbäder wirken belebend und kreislaufanregend, besonders in der heißen Jahreszeit. Dafür eignen sich Pflanzenwässer, zum Beispiel aus Limette, Meisterwurz, Pfefferminze oder Zitronenverbene. Nur anwenden bei schon warmen Füßen. Egal, welche Temperatur das Fußbad hat, pflegen Sie Ihre Füße nach dem Fußbad mit einer Creme oder einem Second Skin.
Vollbad
Was gibt es Schöneres als ein duftendes, entspannendes Vollbad? Die Pflanzenwässer liefern dazu ihre spezifisch wirksamen Eigenschaften. Zur Beduftung eines Vollbades benötigt man 400–500 ml Pflanzenwasser. Deshalb fügt man dem Pflanzenwasser meist noch ätherische Öle zu, um weniger Pflanzenwasser für ein Vollbad zu verbrauchen und die Wirkung zu verstärken. Dafür werden die ätherischen Öle (10–15 Tropfen, je nach Duftintensität) mit 3–4 EL natürlichen Emulgatoren wie Schlagsahne oder Honig verrührt und alles mit dem Pflanzenwasser in einem Schraubglas gut verschüttelt. Diese Mischung gibt man ins Badewasser.
In alten Drogistenbüchern findet sich noch die Rezeptur für die folgende wunderbare Bademilch, die sehr hautpflegend ist und Pflanzenwässer wie ätherische Öle für Bäder wasserlöslich macht. Der natürliche Emulgator in dieser Rezeptur ist Gummi arabicum.
BADEMILCH
| Gummi arabicum, Pulver | 3 EL |
| Fettes Trägeröl, z. B. Sonnenblumenöl oder Mandelöl | 3 EL |
| ätherisches Öl | 10–15 Tropfen |
| Pflanzenwasser | 80 ml |
Gummi arabicum und Öl mit dem Stabmixer auf höchster Stufe zu einer dickflüssigen Emulsion rühren. Ätherisches Öl einträufeln. Pflanzenwasser langsam zugeben und weiterrühren, bis eine weiße Milch entsteht. Reicht für 1–2 Vollbäder oder 4–5 Fuß- oder Armbäder. Im Kühlschrank maximal 2 Wochen haltbar.
Kompressen, Wickel, Umschläge
Wattepads können mit Pflanzenwasser besprüht oder damit getränkt und für circa 10 Minuten, zum Beispiel bei Schwellungen, auf die geschlossenen Augen gelegt werden. Für Augenkompressen eignen sich: Fenchelwasser, Hainbuchenwasser, Lindenblütenwasser, Melissenwasser, Myrtenwasser und Rosenwasser.
Kompressen: Weiche, kleine Tücher werden in kühlem oder warmem Wasser, das mit Pflanzenwasser gemischt wurde (2–3 EL auf ein Viertel Liter Wasser) getaucht, leicht ausgewrungen und aufgelegt. Sie helfen bei Kopfschmerzen (auf Stirn und Schläfen), bei Prellungen, Zerrungen, Verbrennungen, bei Verdauungsbeschwerden und Menstruationsschmerzen. Bei Menstruationsschmerzen werden feucht-warme Kompressen auf den Unterbauch oder den Kreuzbeinbereich gelegt. Sehr angenehm und beruhigend ist zum Beispiel eine Gesichtskompresse mit Orangenblütenwasser.
Wickel: 50 ml Pflanzenwasser in 1 Liter warmes Wasser geben, als Brustwickel bei Erkältungskrankheiten, zur Leberregeneration auf dem Leberbereich, als Bauchwickel bei Verspannungen und Blähungen im Bauchbereich oder als Wadenwickel zur Fiebersenkung anwenden. Wickel nicht anwenden bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Gefäßschädigungen und bei akuten, entzündlichen Erkrankungen. Genaue Angaben zum Anlegen von Wickeln finden Sie in der entsprechenden Literatur.
Franzbranntwein
Dieses altbewährte Hausmittel besteht ursprünglich vorwiegend aus bis zu 80 Prozent Alkohol, in dem ätherische Öle gelöst sind. Dieser hohe Alkoholgehalt wirkt zwar erfrischend auf der Haut, kann sie jedoch austrocknen. Franzbranntwein wird bei Muskelschmerzen, Prellungen, Verstauchungen usw. verwendet. Mit Alkohol (im Verhältnis 1:1 mit 45-prozentigem Weingeist und Pflanzenwasser) oder nur mit Pflanzenwässern und ätherischen Ölen kann eine hautschonende und sanft wirksame Version des Franzbranntweins hergestellt werden. Für Franzbranntwein eignen sich Pflanzenwässer aus Angelika, Fichte, Meisterwurz, Melisse oder Pfefferminze. Rezepturen finden Sie in den Pflanzenporträts.
Pflanzen-Gel
Diese Rezepturen sind schnell herzustellen und beinhalten weder Konservierungsstoffe noch andere Hilfsmittel. Sie halten sich bei Anwendung 2–3 Tage, im Kühlschrank 1–2 Wochen, je nach Grundsubstanz, die für das Gel verwendet wird. Gels können gut mit einem kleinen Schneebesen (Schwingbesen) gerührt werden.
Flüssigere Gels werden in ein Fläschchen mit Gelpumpe gefüllt, um eine Kontaminierung mit den Fingern zu vermeiden. Sie halten sich dann etwas länger. Die Abfüllung in eine kleine Tube ist besonders für unterwegs zweckmäßig. Gels halten sich dann im Gebrauch bis zu 3 Wochen (mit Guar- oder Siliceagel) und werden durch die Zugabe von ätherischen Ölen noch zusätzlich konserviert. Festere Gels werden in eine Salbendose gefüllt. Sie eignen sich zur Anwendung bei Hauterkrankungen, Insektenstichen, Entzündungen, Sonnenbrand, Schwellungen, Verstauchungen und Venenerkrankungen. Auch Duschgels kann man aus Pflanzenwässern herstellen.
Bei Sportverletzungen zum Abschwellen und zum Schmerzstillen werden die Gels mit Pfefferminzwasser und/oder Wiesenköniginwasser angerührt und auf 1 EL Gel 5 Tropfen Arnikatinktur gegeben. Bei müden, schweren Beinen und bei Venenproblemen werden sie eingerieben oder als Kompresse aufgelegt. Hier eignen sich Holunderblütenwasser, Honigkleewasser und Pfefferminzwasser. Auf 2 EL Gelgrundlage können 10 Tropfen Mäusedorntinktur (Ruscus aculeatus) oder 5 Tropfen Arnikatinktur gegeben werden, was die venenstärkende und abschwellende Wirkung verstärkt.
Mäusedorntinktur ist ein bewährtes Mittel bei nächtlichen Wadenkrämpfen. Auch Hamamelistinktur, Weinlaubtinktur und Rosskastanientinktur wirken venenstärkend und können einzeln oder in Mischung einem Venengel zugefügt werden. Bei Hauterkrankungen eignen sich als Gelzugabe Tinkturen aus Stiefmütterchen, Jiaogulan und Ringelblume.
Siliceagel: Silicea wird auch Kieselsäure genannt. Dieses Gel ist im Naturkostladen und im Reformhaus erhältlich. Es gibt auch ein aus Reis hergestelltes Siliceagel. Das Gel wird mit Pflanzenwasser (2–3 Teile Siliceagel, 1 Teil Pflanzenwasser) verrührt oder verschüttelt und auf die Haut aufgetragen. Siliceagel wirkt juckreizstillend, entzündungshemmend und sehr hautpflegend. Es ist wundheilend, schützt vor Hautalterung und ergänzt die passenden Pflanzenwässer. Mit Pflanzenwasser vermischt, hält es sich circa 1 Woche.
Aloe-Vera-Gel: Die Aloe-Vera-Pflanze besitzt sehr hautpflegende Eigenschaften. Sie beruhigt die Haut, wirkt entzündungshemmend, juckreizstillend, feuchtigkeitsspendend und eignet sich gut zur Mischung mit Pflanzenwässern. Fertigprodukte aus der frischen Aloe-Vera-Pflanze sind oft stark konserviert. Es lohnt sich, das Gel selbst herzustellen. Man braucht dazu frische Blätter der Aloe-Vera-Pflanze. Diese sind im Naturkostladen erhältlich. Man kann auch selbst Aloe-Vera-Pflanzen ziehen. Die Pflanzen sind nicht winterhart, können jedoch im Sommer draußen und im Winter im Zimmer gut gehalten werden.
Gelherstellung: Schneiden Sie ein Blatt ab und verwenden Sie davon ein Blattstück von 5–6 Zentimeter Länge (restliches Blatt in feuchtes Tuch einwickeln und im Kühlschrank aufbewahren). Schälen Sie das Blatt mit einem Sparschäler, Kartoffelschäler oder einem scharfen Messer. Entfernen Sie den gelben, bräunlichen Saft, der sich eventuell an der Schnittstelle bildet, da dieser hautreizend wirken kann. Zerdrücken Sie in einer Schale mit einer Gabel das schlüpfrige Aloe-Vera-Fleisch, geben Sie 1–2 TL Pflanzenwasser wie Rosengeranienwasser oder Lavendelwasser dazu und pürieren Sie mit einem Stabmixer die Mischung bis zu einer schaumigen, cremigen Konsistenz.
Der Aloe-Vera-Blütenschaum wird mit einem breiten Bäckerpinsel auf die Haut getupft. Circa 5 Minuten einwirken lassen und abnehmen. Besonders gut zur Pflege von trockener, unreiner, müder und gereizter Haut. Auch als Auflage bei entzündeter und juckender Haut, bei Insektenstichen, Quallenverätzungen und Sonnenbrand gut geeignet. Hierfür empfiehlt sich besonders gut eine Mischung mit Pflanzenwässern aus Lavendel, Immortelle, Rose, Gänseblümchen oder Ginkgo. Das frisch zubereitete Aloe-Vera-Gel hält sich im Kühlschrank circa 2 Tage. In seltenen Fällen kann Aloe-Vera die Haut reizen. Vor der Anwendung den Hauttest machen.
Guargel: Dieses Gel wird aus dem Guarkernmehl hergestellt. Es eignet sich besonders für hautpflegende Gesichtsmasken, bei Sonnenbrand, zur Venenstärkung, bei gestauten, müden Beinen, für ein mildes Reinigungsgel oder als Duschgel. Guar reizt nicht und besitzt eine feuchtigkeitsspendende Wirkung.
Die Konsistenz des Gels hängt von der Menge des Guarkernmehls imVerhältnis zum Pflanzenwasser ab. Je weniger Guarkernmehl eingerührt wird, umso dünnflüssiger wird das Gel.
GRUNDREZEPT GUARGEL
| Guarkernmehl | ½ TL |
| Pflanzenwasser | 40 ml |
Das Pflanzenwasser leicht erwärmen und das Guarkernmehl unter Rühren in das Wasser streuen, verrühren und nachquellen lassen.
Dem Gel kann noch 1 TL Pflanzenöl, zum Beispiel Ringelblumenmazerat, Johanniskrautmazerat, Honigkleemazerat wie auch 4–8 Tropfen ätherisches Öl, zugefügt werden. Dieses Gel hält sich circa 1 Woche im Kühlschrank.
GEL MIT ALKOHOL
| Heilpflanzentinktur (70 %), z. B. Hamamelistinktur | 10 ml |
| ätherisches Öl, z. B. Pfefferminzöl Lavendelöl, Immortellenöl | 5–10 Tropfen, je nach Duftintensität |
| Pflanzenwasser, z. B. Pfefferminzwasser, Lavendelwasser | 80 ml |
| fettes Trägeröl, z. B. Sonnenblumen-, Jojobaöl, Johanniskrautmazerat | 2 TL |
| Guarkernmehl | 1 gestrichener TL |
Das ätherische Öl in der Tinktur verrühren. Pflanzenwasser und Öl zugeben und verrühren. Quellen lassen. Zum Schluss das Guarkernmehl dazugeben und alles verrühren. Soll das Gel eher kühlend wirken, kann das Trägeröl weggelassen werden. Stattdessen gibt man 2 TL Pflanzenwasser, zum Beispiel Pfefferminzwasser, mehr zu der Mischung. Ein Trägeröl macht das Gel etwas geschmeidiger und kann eine zusätzliche Wirkung zur Mischung beisteuern, wie zum Beispiel das entzündungshemmende Johanniskrautöl oder das hautpflegende Ringelblumenöl. Durch die Zugabe von 10 ml Tinktur erhält das Gel eine zusätzliche Konservierung und hält sich im Kühlschrank circa 2 Monate.
Meine erfrischend wirkenden Gels färbe ich manchmal mit Chlorophyll grün ein. Diese Farbe passt sehr gut, wenn das Gel mit ätherischen Nadelbaumölen beduftet ist. Eine Glasstabspitze Chlorophyll reicht für eine Einfärbung. Es wird vor der Zugabe von Guarkernmehl im Gel gut verrührt.
GRUNDREZEPT GESICHTSREINIGUNGSGEL
| Guarkernmehl | 1 gestrichener TL |
| Heilpflanzentinktur (70 %) | 5 ml |
| Fettes Trägeröl wie Mandelöl | 4 ml |
| ätherisches Öl | 5–10 Tropfen |
| Pflanzenwasser | 40 ml |
Alle Zutaten bis auf das Pflanzenwasser in ein Schraubglas oder in einen Salbentiegel geben und mit einem kleinen Schneebesen sehr gut verrühren. Es dürfen keine Klümpchen mehr vorhanden sein. Einige Minuten quellen lassen. Dann mit dem Wasser auffüllen. Zuschrauben und circa 1 Minute gut schütteln.
Für pflegende Reinigungsgels eignen sich Tinkturen aus Hamamelis, Jiaogulan, Ringelblume oder Wundklee. Die Tropfenzahl der ätherischen Öle richtet sich nach Wirkung und Duftintensität. Es passen ätherische Öle wie Rosmarin, Rosengeranie, Lavendel. Für diese Gelmischung eignen sich Pflanzenwässer mit einer hautwirksamen, reinigenden Wirkung wie Frauenmantel, Gotu Kola, Gundermann, Ginkgo, Gänseblümchen, Stiefmütterchen, Storchschnabel, Wundklee oder Wiesenkönigin.
Quittengel: Dieses Gel aus den Quittenkernen eignet sich gut zur Mischung mit Pflanzenwässern. Es dient zu Einreibungen, Auflagen und als Haarfestiger. Herstellung siehe Seite 241.
EINNAHME
Die therapeutische Verwendung der Pflanzenwässer wird im Westen gerade (wieder) entdeckt. In der ayurvedischen Medizin jedoch werden die Pflanzenwässer, dort Arkas genannt, seit langer Zeit als bewährtes, hochwirksames Therapeutikum verwendet und bei verschiedenen Erkrankungen zur Einnahme empfohlen. Sie werden in Wasser verdünnt eingenommen. Man destilliert die Pflanzenwässer aus getrockneten, pulverisierten Pflanzen, die zuvor in Wasser eingeweicht werden. In der ayurvedischen Medizin kann man auf eine über viele Generationen gewachsene Tradition in der Verwendung der Pflanzenwässer zurückgreifen. Die Arkas werden in einer Destille, Arka Yantra, hergestellt. Die Arkas, die indischen Pflanzenwässer, halten sich 1 Jahr.
Oft wird hierzulande die Wirkung der Pflanzenwässer unterschätzt und eine Einnahme mit zu hoher Dosierung empfohlen. Sie sind jedoch hoch wirksam und sollten nicht überdosiert werden. Pflanzenwässer sind konzentrierter als Tees und werden niedriger als diese dosiert:
Je nach Pflanzenwasser: 1 TL–2 EL auf ½–1 Glas Wasser. Schluckweise trinken.
Werden die Pflanzenwässer kurmäßig eingenommen, wird meist nur 1 TL in Wasser zur täglichen Einnahme empfohlen. Pflanzenwässer eignen sich auch sehr gut als Trägerstoff zur Verdünnung von Bach-Blüten, Homöopathie, Gemmotherapie und Spagyrik zur Einnahme.
Nehmen Sie keine Pflanzenwässer ein, die in den Pflanzenporträts nicht zur Einnahme ausdrücklich ausgewiesen sind.
Bitte beachten Sie, dass die Einnahme von Pflanzenwässern keine medizinische Behandlung ersetzt. Wenden Sie sich dafür an die Heilpraktikerin, den Heilpraktiker oder die Ärztin, den Arzt Ihres Vetrauens.
IN DER KOSMETIK
In der Kosmetik gilt dasselbe wie beim Essen. »Wenn man die Zutaten nicht kennt, kennt sie der Körper womöglich auch nicht«, wie die Bio-Spitzenköchin Sarah Wiener es ausdrückt. Immer mehr Menschen möchten naturbelassene Kosmetik verwenden. Im Einklang mit der Natur möchten sie auf synthetische Farb- und Duftstoffe, synthetische Konservierungsmittel und Emulgatoren verzichten. Die Naturkosmetik soll weitgehend aus Zutaten, die aus der Natur stammen, hergestellt sein. Produkte auf Mineralölbasis (gereinigte Erdöle) sind Abfallprodukte aus der Mineralölindustrie und nicht in der Naturkosmetik erwünscht. Diese künstlichen Fette wie Paraffine und Silikone und auch Vaseline bilden auf der Haut einen abdichtenden Film (Okklusionseffekt), die Abgabe von Wärme und Feuchtigkeit durch die Haut wird blockiert, und andere wertvolle Inhaltsstoffe aus der Creme können nicht in die Haut eindringen. Im Gegensatz zur gewerblichen Herstellung und zum Vertrieb von Kosmetik kann bei der selbst hergestellten Frischkosmetik auf Konservierungsstoffe, Glyzerin, künstliche Emulgatoren, Konsistenzgeber usw. verzichtet werden. Eine kürzere Haltbarkeitsdauer kann man damit in Kauf nehmen. Die selbst gerührten Cremes müssen nicht lange haltbar sein, da sie nur für den Hausgebrauch dienen und nicht in den Handel gebracht werden. Die selbst hergestellte Frischkosmetik hält sich je nach Produkt 3–4 Monate und sollte nach der Herstellung gleich verwendet werden. Bis zum Verbrauch kann sie lichtgeschützt und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Geöffnete Cremes sollten innerhalb von 1 Monat aufgebraucht werden.
Der Begriff »Naturkosmetik« ist nicht geschützt, deshalb sollte man auch hier die Liste der angegebenen Inhaltsstoffe prüfen. Bei selbst hergestellter Naturkosmetik kann man sicher sein, dass diese nur das enthält, was man wünscht. Die Herstellung von Gels, Second Skin und Cremes geht bei etwas Übung relativ schnell, und so kann man sich im Abstand von circa 2–3 Monaten Nachschub herstellen und eventuell neue Rezeptkombinationen ausprobieren.
»Auch wenn der Einzelne zwar nicht denselben Aufwand wie Großlabors betreiben kann, sollte er sich von diesen Titanen der Sterilität keine Angst machen lassen, dass nur die keimfrei und perfekt nach der Norm hergestellten Mittel wirksam seien«, schreibt Christian Sollmann (2008) in seinem Buch über das Selbstherstellen von homöopathischen Mitteln.
Dies gilt meiner Ansicht nach auch für das Selbstherstellen von Naturkosmetik und anderen Produkten aus den Pflanzenwässern.
Verwenden Sie nur hochwertige Zutaten, bevorzugt in Bioqualität wie kaltgepresste Trägeröle, reine ätherische Öle, Bienenwachs von biologisch arbeitenden Imkerinnen und Imkern. Es empfiehlt sich, die Zutaten so naturbelassen wie möglich zu verwenden. Unsere Haut ist aufnahmefähig, und viele Stoffe werden über die Haut in den Körper eingeschleust.
Die Pflanzenwässer beinhalten nachweislich viele hochwirksame Substanzen, welche unsere Haut pflegen, nähren, ausbalancieren und in ihrer natürlichen Funktion unterstützen. Sie schenken der Haut Schutz, Regeneration und Schönheit.
Auch Naturprodukte können bei unsachgemäßer Herstellung und Anwendung Hautreizungen und Hautallergien verursachen. Beachten Sie die Anwendungsbeschränkungen der einzelnen Pflanzenwässer bei der Auswahl für Ihre selbst hergestellten NaturkosmetikProdukte.
Gesichtswasser
Pflanzenwässer als Gesichtswässer verwendet, sind die einfachste Art, sie auf die Haut einwirken zu lassen. Manche Pflanzenwässer können der täglichen Pflege dienen, andere werden über einen bestimmten Zeitraum verwendet, um zum Beispiel Pickel abheilen zu lassen, Hautentzündungen zu heilen oder Schwellungen zu behandeln.
Die Pflanzenwässer, pur oder in Mischungen, werden aufgesprüht oder mit dem Wattebausch zur Reinigung auf die Gesichtshaut und auf das Dekolleté aufgetragen. Einige wenige Tropfen ätherisches Öl – 1–5 Tropfen auf 50 ml Pflanzenwasser – können zur Duftintensivierung oder zur Betonung einer bestimmten Wirkung im Pflanzenwasser verschüttelt werden. Geben Sie nicht mehr als 0,5–1 Prozent ätherisches Öl der Mischung zu, da die ätherischen Öle ansonsten hautreizend wirken könnten. Verwenden Sie keine ätherischen Öle, die als hautreizend gelten. Bei empfindlicher Haut sollten Sie die ätherischen Öle vorher testen (siehe Hauttest Seite 38). Die ätherischen Öle werden, wenn sie in höherer Konzentration gewünscht sind, zuvor in wenig Alkohol verschüttelt und dann mit dem Pflanzenwasser vermischt. Da Alkohol die Haut austrocknen kann, werden Pflanzenwässer meist ohne oder mit sehr wenig Alkohol als Gesichtswässer empfohlen. Sie sind weniger lang haltbar und sollten in kleineren Abfüllmengen verwendet werden. Pflanzenwässer pur, als Gesichtswasser, halten sich im Gebrauch 4–6 Wochen, jeweils etwas länger durch Zugabe von ätherischen Ölen oder Pflanzentinktur. Wenn die Pflanzenwässer als Aftershave verwendet werden, kann ein Alkoholgehalt erwünscht sein, um die ätherischen Öle zu lösen und um einen kühlenden, desinfizierenden Effekt zu bewirken. Als Gesichtswasser eignen sich viele Pflanzenwässer wie aus Breitwegerich, Frauenmantel, Gänseblümchen, Gotu Kola, Gundelrebe, Hamamelis, Holunderblüten, Iriswurzel, Rosengeranie, Lindenblüte, Storchschnabel, Zitronenverbene.
Gesichtsdampfbad
Bei dieser Anwendung wird die Haut porentief gereinigt, geklärt und durchblutet. 1–2 Liter kochendes Wasser in eine Schüssel füllen, 10–20 ml Pflanzenwasser, je nach Duftintensität, zugeben. Das Gesicht über die Schüssel halten und mit einem Frotteetuch zeltartig abdecken, damit der Dampf nicht entweichen kann. Dauer: 5–10 Minuten. Nicht anwenden bei Couperose (Hautrötungen und erweiterten Äderchen). Für ein Gesichtsdampfbad eignen sich Pflanzenwässer mit hautreinigender Wirkung wie zum Beispiel aus Kamille, Fenchel, Gundermann.
Haarpflege
Die Pflanzenwässer eignen sich sehr gut zur Haarpflege. Sie werden in die Kopfhaut einmassiert, dienen als Haarkur, Spülung, Haarspray oder Haarparfum. Die Pflanzenwässer können auch Shampoos oder Haarkuren zugefügt werden. Für die Pflege der Kopfhaut werden die Pflanzenwässer in ein Applikatorfläschchen gefüllt, um sie auf die Kopfhaut aufzutragen. Danach werden sie sanft einmassiert. Die Kopfhaut wird gestärkt, regeneriert und die Durchblutung angeregt. Ist der Haarboden gut durchblutet, werden die Haarwurzeln verstärkt mit Nährstoffen versorgt. Neben der durchblutungsfördernden Wirkung können die Pflanzenwässer die Haarstruktur verbessern, das Haar besser kämmbar machen, ihm Glanz und Duft schenken. Zur durchblutungsfördernden, haarwuchsfördernden Pflege eignen sich zum Beispiel Atlaszedernwasser, Ginkgowasser, Palo-Santo-Wasser, Rosmarinwasser, Zirbelkieferwasser oder Zitronenverbenenwasser. Manche Pflanzenwässer werden als Haarspülung verwendet oder auf das trockene Haar gesprüht. Dazu eignen sich die Pflanzenwässer aus Römischer Kamille, Frauenhaarfarn, Linde und Rose. Den Pflanzenwässern können noch wenig ätherisches Öl – 1–5 Tropfen auf 50 ml – zugegeben werden. Sie werden gut verschüttelt. Es eignen sich Bay, Pfefferminze, Zedernholz, Rosmarin.
Deospray
Die Pflanzenwässer werden als sanftes Deodorant, pur oder in Mischungen auf die Haut gesprüht. Sie können mit ätherischen Ölen in Duft und Wirkung verstärkt werden. Auf 50 ml Pflanzenwasser werden 5–10 Tropfen ätherisches Öl verschüttelt. Zur besseren Lösung der ätherischen Öle und für ein zusätzliches Kältegefühl auf der Haut können die ätherischen Öle in 70-prozentigem Weingeist verschüttelt werden (5 ml 70-prozentiger Weingeist auf 50 ml Pflanzenwasser). Dann wird mit dem Pflanzenwasser aufgefüllt. An ätherischen Ölen passen zum Beispiel Douglasie, Rosengeranie oder Salbei. Für Deodorants eignen sich Pflanzenwässer aus Douglasie, Hamamelis, Lemongrass, Myrte und Salbei.
Aftershave
Mit oder ohne Alkohol, pur oder in Mischungen, ergeben die Pflanzenwässer ein natürliches Aftershave. Als ätherische Öle für ein Aftershave passen Atlaszeder, Bergamotte, Douglasie, Wacholder, Salbei, Rosmarin, Rosenholz, Vetiver, Zitronenmyrte – je nachdem, ob mehr eine frische, waldige, blumige oder Kräuterduftnote gewünscht ist.
Als Pflanzenwässer für ein Aftershave eignen sich zum Beispiel Angelikawasser, Cistrosenwasser, Johannisbeerknospenwasser, Mammutbaumwasser, Myrtenwasser, Pfefferminzwasser, Rosmarinwasser, Weißtannenwasser und Zirbelkieferwasser. Die ätherischen Öle (ca. 10 Tropfen pro 50 ml Pflanzenwasser) werden in Alkohol verschüttelt und mit Pflanzenwasser aufgefüllt.
Naturparfum
Intensiv duftende Pflanzenwässer wie Rosenwasser, Orangenblütenwasser und Jasminwasser sind wunderschöne, authentische Naturparfums. Sie können dafür pur, untereinander gemischt oder mit ätherischen Ölen verstärkt werden.
Second Skin
Die von Donna Maria (2000), der US-amerikanischen Aromatherapeutin und Expertin für Naturkosmetik, als Second-Skin-Elixier bezeichnete Zubereitungsart kennt man im deutschsprachigen Raum als »Schüttellotion«. Bei dieser Zubereitung, »der reinsten Form einer hautpflegenden Emulsion … mit hautliebenden Pflanzenwässern und nährenden Ölen«, wie Donna Maria Second Skin beschreibt, wird ganz auf zusätzliche Emulgatoren oder andere Hilfsmittel verzichtet. Second Skin verwöhnt die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit und macht die Haut geschmeidig. Diese Zubereitungen eignen sich deshalb sehr gut zum Einreiben bei trockener Haut.
Die Herstellung ist einfach: Pflanzenwasser und Trägeröl werden in einer Flasche durch Schütteln kurzfristig emulgiert. Es können auch noch einige wenige Tropfen passendes ätherisches Öl oder auch Wirköle wie Wildrosenöl, Borretschsamenöl, Nachtkerzenöl oder Granatapfelkernöl zugefügt werden. Durch das Schütteln entsteht eine milchähnliche Emulsion, die sich sehr gut auftragen lässt – ein wahres Elixier für die Haut. Das Second Skin trennt sich in der Flasche wieder in Fett- und Wasserphase. Füllen Sie das Second Skin in eine kleine Flasche mit Pumpspender (Gelpumpe, Hydrolipid-Flasche, Dispenser). Stellen Sie immer nur eine kleine Menge her, bewahren Sie sie im Kühlschrank auf, denn das Second Skin hält sich bei Gebrauch nur 3–4 Tage, im Kühlschrank circa 1 Woche.
Second-Skin-Zubereitungen eignen sich auch sehr gut für Massagen zum Beispiel als entspannender Belly-Balm für den Bauch oder als Aftershave-Balm, um die Haut nach der Rasur zu pflegen und zu beruhigen.
GRUNDREZEPT SECOND SKIN
| Trägeröl wie Jojobaöl, Mandelöl eventuell davon Wirkstofföle | 15 ml |
| Pflanzenwasser | 15 ml |
| ätherische Öle | 1–4 Tropfen |
In einem Fläschchen alle Zutaten gut miteinender verschütteln.
Enthält das Second Skin mehr Öl als Pflanzenwasser, wird es zum Balsam.
Maske
Masken sind streichfähige Pasten, die auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen werden, eintrocknen und die Haut mit einem festen, maskenartigen Mantel überziehen. Für pflegende Masken werden die Pflanzenwässer mit Heilerde (Tonerde) – 1 Teil Heilerde, 1–2 Teile Pflanzenwasser – zu einer streichfähigen Paste angerührt und mit einem breiten Bäckerpinsel auf die Gesichtshaut aufgetragen. Sie trocknet ab und wird, bevor sie ganz austrocknet, nach einer 10–15-minütigen Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch abgenommen und mit lauwarmem Wasser abgewaschen. Masken werden einmal wöchentlich angewendet. Nach Abnahme der Maske kann die Haut mit einem Pflanzenwasser nochmals gereinigt werden.
Heilerdemasken wirken hautstraffend, hautreinigend und durchblutungsfördernd und werden mit Pflanzenwässern angerührt, die ebenfalls reinigende und hautpflegende Wirkungen besitzen. Sie eignen sich besonders für unreine, fettige, schlecht durchblutete Haut und Mischhaut und bei Akne. Es stehen verschiedene Heilerdearten zum äußeren Gebrauch zur Verfügung.
→ Grüne Heilerde: wirkt besonders stark hautreinigend und antibakteriell
→ Braune Heilerde: zum Beispiel Luvos-Heilerde äußerlich, wirkt milder hautreinigend und weniger austrocknend
→ Rosa Heilerde: wirkt mild hautreinigend
→ Weiße Tonerde: sie ist eisenfrei und wirkt sehr mild hautreinigend
→ Aion-A-Heilerde: Diese Heilerde ist eigentlich ein Heilgestein und wird als »Königin unter den Heilerden« gelobt. Sie stammt aus Würenlos in der Schweiz. Die Wirkung dieser Heilerde wurde von der Heilpraktikerin Emma Kunz entdeckt. Aion A wirkt hautreinigend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und stimuliert die Hautdurchblutung.
Werden Masken auf trockener Haut angewendet, kann der Heilerde noch ein fettes Trägeröl zugefügt werden. So wird das Austrocknen der Haut verhindert. Die Zugabe von Aloe-Vera-Gel schenkt zusätzliche Pflege.
Für hautreinigende Masken mit Heilerde eignen sich Pflanzenwässer wie zum Beispiel aus Gänseblümchen, Gundermann, Heublumen, Lavendel, Salbei und Stiefmütterchen.
Packungen
Packungen werden mit hautpflegenden Konsistenzgebern zu einer streichfähigen, cremigen Paste gerührt. Sie sind wie nährender Dünger für die Haut, sie wirken regenerierend und feuchtigkeitsspendend und trocknen auf der Haut nicht aus wie die Masken, sondern bleiben feucht und geschmeidig. Packungen werden auf die Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté mit einem Bäckerpinsel aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit (entspannen, zum Beispiel in der Badewanne) von 10–15 Minuten werden sie mit einem feuchten Tuch entfernt. Mit einem Pflanzenwasser kann man noch nachreinigen. Für Packungen verrührt man Pflanzenwässer mit Eibischwurzelpulver, Traubenkernmehl, Avocadofruchtfleisch – Mus, Hafermehl, Mandelmus, aber auch mit Gelgrundlagen wie Aloe-Vera-Gel, Siliceagel und Quittengel. Es eignen sich Pflanzenwässer mit nährenden und pflegenden Eigenschaften, wie zum Beispiel Fenchelwasser, Gotu-Kola-Wasser, Frauenmantelwasser, Holunderblütenwasser, Maulbeerwasser, Quittenwasser, Rosenwasser, Rosengeranienwasser.
Peeling
Die Pflanzenwässer werden mit pflanzlichen Substanzen mit mehr oder weniger rauer Oberfläche zu einer streichfähigen Masse verrührt, auf die Haut aufgetragen und mit kreisenden Bewegungen einmassiert. So wird der Peelingeffekt erziehlt: Abgestorbene Hautzellen werden gelöst und abgetragen, der Hautstoffwechsel wird angeregt, und die pflegenden Wirkstoffe der Pflanzenwässer dringen in die Haut ein. Ein Peeling fördert die Neubildung der Haut, der Teint bekommt ein strahlendes Aussehen. Für ein sanftes Peeling eignen sich als Grundlage Mandelkleie, Haferkleie und Rosskastanienmehl. Für ein stärkeres Peeling für die robustere Haut auch an den Füßen können Aprikosensteingranulat, Mandelsteingranulat oder Seesand dienen. Es eignen sich Pflanzenwässer mit hautreinigender, entgiftender Wirkung wie Hamameliswasser, Johannisbeerknospenwasser, Ginkgowasser, Stiefmütterchenwasser oder Lavendelwasser.
APHRODITE-PEELING-MISCHUNG
| Mandelkleie, süß, fein | 4 EL |
| Iriswurzelpulver | 2 EL |
| Heilerde, rosa oder Luvos | 1 EL |
| Rosskastanienmehl | 1 EL |
| Rosenwasser | nach Bedarf |
Die trockenen Anteile der Mischung miteinander vermischen und aromageschützt in einem Schraubglas oder in einem Salbentiegel aufbewahren.
Für ein Peeling 1 EL der Mischung mit etwas Rosenwasser zu einer streichfähigen Paste verrühren und in kreisenden Bewegungen auf die Gesichtshaut auftragen. Einige Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser gut abwaschen. Eine sehr pflegende und reinigende Mischung, die sich auch für trockene und empfindliche Haut eignet. Die Peelingpaste reinigt die Haut sanft, schenkt Feuchtigkeit und hält die Haut elastisch.
Creme
Sie benötigen zur Cremeherstellung folgende Ausstattung:
→ 2 Bechergläser oder Marmeladegläser
→ 2 Töpfe oder Pfannen für das Wasserbad. Besonders gut zum Schmelzen der Fettphase und zum Rühren eignet sich eine Fantaschale aus Emaille. Sie wird im Wasserbad erwärmt.
→ 2 Speise -oder Laborthermometer
→ Messbecher mit ml-Skala, z. B. Becherglas
→ Salbendosen, Salbentiegel (5 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml), Fläschchen mit Pumpaufsatz für flüssigere Zubereitungen wie Second Skin oder Körpermilch
→ Schneebesen oder elektrischen Milchaufschäumer für kleine Crememengen, Mixstab für größere Mengen
→ Weingeist (70 %), um Geräte und Behälter zu desinfizieren
→ kleine Laborwaage 500 g × 0,1 g oder Briefwaage
→ Haushaltspapier zum Abdecken beim Auskühlen der frisch eingefüllten Creme
→ Cremespatel: zum Entnehmen beim täglichen Gebrauch der Creme aus der Cremedose. Dies verlängert die Haltbarkeit der Creme im Gebrauch.
Folgende Zutaten werden benötigt:
→ unbehandeltes, ungebleichtes Bio-Bienenwachs
→ Auswahl an ätherischen Ölen, 3 bis 5 verschiedene Öle reichen für den Anfang
→ Auswahl an 2 bis 3 fetten Trägerölen wie Jojobaöl, Mandelöl, Aprikosenkernöl
Optional:
→ 1 bis 2 Wirkstofföle wie Wildrosenöl, Sanddornfruchtfleischöl, Granatapfelkernöl
→ Olivenöl oder Mandelöl zum Herstellen von Ölmazeraten wie Ringelblumenöl, Centellaöl oder Quittenöl zum Herstellen von Tinkturen: Weingeist (40–70%)
Spezifische Cremerezepte finden Sie in den Pflanzenporträts.
Arbeiten Sie bei der Cremeherstellung sehr sauber, verwenden Sie nur sterilisierte oder mit Alkohol gereinigte Behälter. Entnehmen Sie Cremes aus den Salbendosen möglichst mit Cremespatel, um eine Kontaminierung der Creme mit den Fingern zu vermeiden.
Bitte beachten Sie bei allen Anwendungen und Zubereitungen mit Pflanzenwässern deren Anwendungsbeschränkungen, die Sie in den Pflanzenporträts nachlesen können. Ich habe die Rezepte so einfach wie möglich gehalten. So können sich die einzelnen Zutaten ganz entfalten, und man kann auch ohne viel Vorkenntnisse Cremes selbst herstellen. Diese Grundrezepte ergeben je nach Rezept 4–6 Salbendosen mit je 10 ml Inhalt, gerade so viel, dass der Vorrat 2–3 Monate hält. Sie können die Creme nach Wunsch in größere Salbentiegel füllen, kleine Dosen sind wegen der Haltbarkeit jedoch zweckmäßiger. Falls Sie eine größere Menge herstellen möchten, können Sie die Rezepte verdoppeln.
GRUNDREZEPT 1
| Bienenwachs | 2 g |
| Lanolin, anhydrid | 5 g |
| fettes Trägeröl | 15 g |
| Kakaobutter | 2g |
| ätherische Öle | 2–6 Tropfen, je nach gewünschter Duftintensität |
| Pflanzenwasser | 20 g oder |
| 17 g Pflanzenwasser und | |
| 3 g Tinktur |
Bienenwachs und Lanolin in einem Becherglas oder einer Fantaschale im Wasserbad schmelzen. Trägeröl und Kakaobutter dazugeben, schmelzen und kurz auf 70 Grad erwärmen. Dann die Wirkstofföle einrühren. In einem separaten Becherglas Pflanzenwasser und eventuell Alkohol kurz auf 70 Grad erwärmen und unter Rühren schluckweise in die Fettphase geben. Aus dem heißen Wasserbad nehmen und so lange weiterrühren, bis die Creme fest wird.
Kurz bevor die Creme andickt und fest wird, gibt man ätherische Öle und zum Beispiel Chlorophyll und Sanddornfruchtfleischöl in die Creme und rührt diese, bis sie fest wird und auf circa 30–35 Grad heruntergekühlt ist. Die Creme kann mit einem Milchschäumer, Mixstab auf kleinster Stufe oder per Hand mit einem Schneebesen gerührt werden. Die fertige Creme in saubere, mit 70-prozentigem Weingeist gereinigte Cremedosen füllen. Bis zum vollständigen Erkalten mit Küchenpapier abdecken, damit kein abdampfendes Wasser in der Creme verbleibt. Verschließen und kühl aufbewahren.
Ein Teil der fetten Trägeröle wie Mandelöl, Aprikosenkernöl, Jojobaöl, Avocadoöl können durch Wirkstofföle wie Wildrosenöl, Hanföl, Sanddornfruchtfleischöl ersetzt werden. Eine reichhaltige, nährende Creme, die sich für die normale bis trockene Haut eignet. Die Creme ist bei kühler Lagerung 2–3 Monate haltbar. Diese Creme nicht verwenden bei Allergie auf Bienenwachs.
GRUNDREZEPT NACH PIA HESS
Heilpflanzentinkturen, die sich als Zugabe für Cremes eignen, sind zum Beispiel aus Frauenmantel, Ginkgo, Jiaogulan, Ringelblumen, Rosenblüten oder Kamillenblüten.
Soll die Creme etwas länger als 2–3 Monate halten, kann mit 70-prozentigem Weingeist konserviert werden. Dieser wird in Form von 15-prozentiger Heilpflanzentinktur im Verhältnis 2:3 (oder in einem anderen Mischungsverhältnis) oder als reiner 70-prozentiger Weingeist der Creme zugefügt. Der Alkohol wird in die warme Wasserphase eingerührt.
VARIATION FÜR DOPPELTE MENGE
| Bienenwachs | 5 g |
| Lanolin anhydrid | 10 g |
| Shea- oder Kakaobutter | 5 g |
| Mandelöl | 20 ml |
| Jojobaöl | 20 ml |
| ätherisches Öl | 3–10 Tropfen |
| Pflanzenwasser | 40 ml |
Ein ähnliches Cremerezept wie links jedoch mit mehr Zugabe von fettem Trägeröl und für die doppelte Crememenge konzipiert. Herstellung wie Grundrezept 1. GRUNDREZEPT NACH STEFANIE FABER
GRUNDREZEPT 2
| Bienenwachs | 3 g |
| Jojobaöl | 40 g |
| Kokosfett, duftend | 3 g |
| Pflanzenwasser | 40 g |
| ätherische Öle | 4–8 Tropfen |
Bienenwachs und Jojobaöl schmelzen und auf 70 Grad erwärmen. Vom Herd nehmen und in der Restwärme das Kokosfett schmelzen. Das Pflanzenwasser separat auf 70 Grad erwärmen und langsam in die geschmolzene Fettphase einrühren. Ätherische Öle zufügen. In diesem Rezept sollte nur Jojobaöl und kein anderes Trägeröl verwendet werden, da das Jojobaöl hilft, die Creme zu emulgieren. Pflanzenwässer und ätherische Öle können nach Bedarf im Rezept verwendet werden. In die flüssige Fettphase kann eine Messerspitze Guarkernmehl eingerührt werden, um das Festwerden der Creme zu unterstützen.
Für diese Creme ist etwas mehr Erfahrung erforderlich, um eine Konsistenz zu erreichen, bei der sich die Wasser- und die Fettphase nicht wieder trennen. Rühren Sie die Creme, bis sie andickt und bis unter 35 Grad abgekühlt ist. Eine leichte Creme für jede Haut, besonders geeignet auch für die Mischhaut. Zugefügte Pflanzenwässer und ätherische Öle sollten zum Kokosduft der Creme passen. Ohne Konservierung im Kühlschrank circa 4–5 Wochen haltbar. Nicht verwenden bei Allergie auf Bienenwachs.
GRUNDREZEPT NACH PIA HESS
GRUNDREZEPT 3
| Bienenwachs | 3 g |
| Jojobaöl | 30 g |
| Kakaobutter | 3 g |
| Sheabutter | 10 g |
| Pflanzenwasser | 40 g |
| ätherische Öle | 3–5 Tropfen |
Im Wasserbad das Bienenwachs im Jojobaöl schmelzen. Kakaobutter und Sheabutter zugeben. Auf 70 Grad erwärmen. In der Zwischenzeit das Pflanzenwasser in einem separaten Becherglas auf 70 Grad erwärmen und langsam in die Fettphase einrühren. Ätherische Öle zugeben, aus dem heißen Wasserbad nehmen und 25–30 Minuten rühren. Die Creme ist ohne Konservierung im Kühlschrank circa 6 Wochen haltbar.
Bei diesem Rezept ist mehr Übung nötig, und selbst dann gelingt es nicht beim ersten Versuch. Das Gelingen ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel müssen Fett- und Wasserphase zwingend vor dem Emulgieren die gleiche Temperatur aufweisen. Die Wasserphase muss langsam und stetig eingerührt werden. Die Wasserphase sollte immer wieder warm gehalten werden, bis sie komplett eingerührt wird. Außerdem ist es wichtig, Jojobaöl zu benutzen und dies nicht durch ein anderes Öl zu ersetzen. Wenn dies nicht beachtet wird, kann sich die Creme sofort oder nach ein paar Tagen scheiden, das heißt, die Wasser- und die Fettphase trennen sich wieder. Es muss 20–30 Minuten geduldig gerührt werden.
Das lange Rühren beim Herstellen wird belohnt: Sie erhalten eine wunderbare Creme, leicht und sahnig, die gut in die Haut eindringt. Sie ist ergiebig, man kann sie sparsam verwenden. Sie passt für jeden Hauttyp, besonders gut für die junge Haut. Die Creme pflegt außerdem die fettige, großporige Haut. Dieses Rezept eignet sich gut für eine zart duftende Creme, die keine ätherischen Öle, sondern nur Pflanzenwasser enthält und gut für die sehr empfindliche Haut verwendet werden kann. Nicht verwenden bei Allergie auf Bienenwachs.
GRUNDREZEPT NACH CAROLINE WALLACE
Vegane Cremes
Wenn Sie eine vegane Creme selbst herstellen möchten, dann eignen sich hierfür die Rezepte 2 und 3. Sie enthalten kein Wollfett. Das Bienenwachs in den Rezepten wird durch die gleiche Menge Candelillawachs ersetzt. Dieses Wachs wird aus den Blättern und Stängeln des Candelillabusches (Euphorbia antisyphilitica) gewonnen. Dieser Busch gedeiht in Halbwüsten im Norden Mexikos, in Texas, Arizona und Kalifornien. Die Pflanze schützt ihre Blätter und Stängel mit dem Wachsüberzug vor dem Austrocknen.
Das Candelillawachs hat einen Schmelzpunkt von 67–70 Grad. Das Wachs ist als Lebensmittelzusatz in der EU unter der Nummer E 902 ohne Höchstmengenbeschränkung zugelassen. Die Einfuhr in die EU unterliegt den CITES-Bestimmungen (Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen).
Eine aktuelle Bezugsquellenliste für Pflanzenwässer, Zutaten zur Verarbeitung der Pflanzenwässer, Destillen wie auch Adressen zu Workshops und Seminaren zum Thema »Selbstherstellen von Naturkosmetik« finden Sie auf meiner Homepage www.fischerrizzi.de und dort auf der Serviceseite zu diesem Buch.