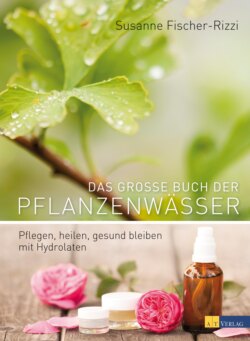Читать книгу Das grosse Buch der Pflanzenwässer - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDESTILLATION DER PFLANZENWÄSSER
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN
Wer Pflanzenwässer herstellen möchte, sollte das Geheimnis der Kunst der Destillation kennen. Deren Ursprünge liegen, so vermutet man, bereits in den alten Hochkulturen Mesopotamiens, Ägyptens wie auch in Indien und China. Dieses alte Wissen war zu manchen Zeiten bekannt, geriet jedoch immer wieder in Vergessenheit. Mit der Kunst der Destillation, wie auch mit den Pflanzenwässern selbst, verbinden sich viele Geschichten. Wenn Sie die ersten Pflanzenwässer ausprobieren oder Sie selbst destillieren und das duftende Pflanzenwasser aus der Destille tropft, die Siedesteinchen erwartungsvoll hüpfen und knistern, und »die Seele der Pflanze« – wie die Alchemisten den extrahierten Duft nannten – den Raum erfüllt, dann ist die beste Zeit diesen Erzählungen zu lauschen.
Destille aus Mohenjo-Daro
DIE ÄLTESTE DESTILLE
Die erste Geschichte zur Destillation ist dramatisch: Die älteste bis jetzt bekannte Destille stammt aus dem 3. Jahrtausend vor der Zeitenwende. Sie ist aus Ton gebrannt und steht in einem Museum in Taxila, im Norden Pakistans. Prof. Paolo Rovesti (Rovesti, Fischer-Rizzi 1995) identifizierte das Gefäß während einer Forschungsreise erstmals als Destille. Die Destille war in Mohenjo-Daro (2300 v. Chr.), der Ausgrabungsstätte einer alten, einst blühenden Kultur am Unterlauf des Indus gefunden worden. Diese Kultur wurde wiederholt von Völkern des Nordens überfallen. In der Nähe des Gerätes fand man Skelette, zwischen deren Rippen Messer lagen. Die Destillateure waren, so zeigen die Ausgrabungen, während der Destillation überfallen worden und haben ihr Geheimnis der Destillation mit ins Grab genommen. Die agressiven Invasoren interessierten sich wohl nicht für duftende Kostbarkeiten, die Gefäße für Parfums und kosmetische Produkte blieben unberührt, wie Prof. Rovesti berichtet. Für einige tausend Jahre danach blieb die Kunst der perfekten Destillation wieder ein Geheimnis, und niemand wusste, wie man ein komplettes Destilliergerät baut.
DER URTOPF
Im antiken Ägypten, Griechenland und Rom kannte man zwar auch Pflanzenwässer und ätherische Öle. Diese wurden aber zunächst auf primitive, jedoch geniale Art, ohne Kühler hergestellt. In Ägypten destillierte man schon 2600 v. Chr. auf eine einfache Weise: In einem Kessel wurden Pflanzen und Wasser gekocht, wie bei der Zubereitung einer Suppe. Der aufsteigende Wasserdampf, angereichert mit ätherischen Ölen, kondensierte am aufgelegten Deckel und wurde zum Beispiel mit einer Feder abgestreift und gesammelt. Man hatte empirisch den Zusammenhang von Verdampfen durch Kochen und Kondensation am Deckel erkannt. Bei einer anderen Methode, dem sogenannten Wollkondensator, im 1. Jahrhundert n. Chr. von Dioskurides beschrieben, legte man auf den Topf ein Schafwollflies. In diesem reicherten sich die aufsteigenden duftenden Dämpfe der im Wasser kochenden aromatischen Pflanzen an und konnten daraus ausgewrungen werden. Dieser Topf bildete den Ursprung der späteren Destillen. In den Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens wurde in einem Topf, in einem Tiegel, nicht nur gekocht, sondern es wurden auch Tees hergestellt, Metalle geschmolzen, Wolle gefärbt, Bier gebraut, Leim gekocht usw. Aus diesem »Urtopf« entwickelte sich später der Alambic, der Glaskolben, der Edelstahlbehälter für die Destillation, ja die ganze Apparatur zum Destillieren.
Im antiken Griechenland kannte man zur Destillation schon eine Art Helm, der die aufsteigenden Dämpfe aus dem Topf auffing und ableitete.
DESTILLATIONSKUNST DER ARABER
Viel später verbesserten dann die Araber diese einfachen Destillationen im Lauf der Jahrhunderte. Viele Gelehrte, Alchemistinnen und Alchemisten aus Alexandria waren 415 n. Chr. vor fanatischen Christen auch nach Syrien geflohen, von wo aus ihr Wissen für die arabische Kultur zugänglich wurde. So bauten die Araber besser konstruierte Destillen mit passenden helmartigen Deckeln für das Gefäß, in dem Wasser mit Pflanzen gekocht wurde. Die Innenwände besaßen eine eingearbeitete Auffangrinne, um das entstehende Kondenswasser zu sammeln. Die Destillen funktionierten jedoch noch nicht mit Wasserkühlung. Man verwendete mit kaltem Wasser getränkte Schwämme, um das Gefäß und somit auch den heißen Wasserdampf zu kühlen, damit er kondensiert und Pflanzenwasser entsteht. Es gab sogar auch schon Glasdestillen, denn die Araber hatten von den Syrern die Glasverarbeitungstechniken übernommen. Bekannte arabische Alchemisten dieser Zeit, die sich eingehend mit der Destillation beschäftigten, waren vom 8. bis 11. Jahrhundert Geber (Jabir ibn Hayyan), Al-Kindi und Al-Razi, den man im Mittelalter unter dem Namen Rhases kannte. Noch heute findet man auf Märkten in Marokko oder Tunesien Nachbildungen dieser nach einfachem, arabischem Prinzip gebauten Destillen, die zur Herstellung eines vorzüglichen Rosenwassers dienen.
DAS ROSENWASSER
Die Weiterentwicklung der arabischen Destillierkunst, die meist mit der Alchemie verbunden war, hat sich oft mit der Verbesserung der Rosenwasserdestillation beschäftigt. Duftende Blütenwässer waren im Orient seit jeher sehr beliebt und genossen höchste Wertschätzung. Speziell das Rosenwasser wird heute noch in der islamischen Welt viel verwendet und gilt als duftende, weihevolle Beigabe bei Festen, Hochzeiten, Verlobungen, zur Begrüßung von Gästen und vor allem beim Besuch der Moschee.
Von Avicenna, einem Arzt und Alchemist (980–1037), ist überliefert, dass er die Destillation entwickelt hat, bei der Wasserdampf durch das Pflanzenmaterial geleitet wird und nicht wie bisher üblich, Pflanzen und Wasser zusammen gekocht werden. Er soll außerdem die Destillation von Rosenwasser perfektioniert haben. Es existieren heute noch mehr als tausend Jahre alte Rezepte aus Arabien, die genau beschreiben, wie man Rosenwasser von höchster Qualität destilliert. Im 8. und 9. Jahrhundert war Bagdad einer der größten Handelsplätze für Rosenwasser. Auch Shiraz, in historischer Zeit als »Stadt der Rosen« bekannt, und Isfahan spielten, was Rosenanbau und Rosenwasser anbetrifft, eine bedeutende Rolle. Blütenwässer, zum Beispiel aus Rose, Narzisse und Veilchen, wurden damals von Arabien aus nach Spanien, Indien und sogar nach China ausgeführt.
Erst später destillierte man, um ätherische Öle zu erhalten. Die Legende berichtet davon, und dies ist eine erfreulichere Geschichte als jene vom Anfang der Destillation: Damals in Bagdad wurden die Wände der Moscheen verschwenderisch mit Rosenwasser abgewaschen. Die Gemahlin des persischen Kaisers Jahangir betrachtete entzückt das an den Wänden der Moschee herabfließende, schillernde Rosenwasser, tauchte ihre Hand hinein und entdeckte, dass sie von einer duftenden, öligen Schicht überzogen war, dem Rosenöl. Sie ließ das auf dem Wasser schwimmende Öl, das sich am Fuße der Wand gesammelt hatte, abschöpfen. So erfährt man aus dieser nach Rosen duftenden Legende, dass man dort einst nur das Rosenwasser kannte und später erst die Destillation der Rosen auch zur Herstellung eines Rosenöls verwendete.
Das Rosenwasser in unserer heutigen Zeit lässt noch etwas vom Zauber des alten Orients zu uns herüberwehen.
BEDEUTENDE BÜCHER ÜBER DIE DESTILLIERKUNST
Über die Araber kam die Destillierkunst im 11. Jahrhundert zu uns, als die Mauren große Teile Südeuropas eroberten. Diese Geschichte ist eng mit Ibn Sina, Avicenna genannt, verbunden. Im Mittelalter waren es dann die Mönche und Nonnen, die in den Klöstern die Destillierkunst pflegten und neben Pflanzenwässern auch Alkohol und ätherisches Öl destillierten. Aus Alkohol, Pflanzenwässern, Kräutern und ätherischen Ölen stellten sie Kräuterliköre oder auch Kräutergeiste her, wie zum Beispiel den Melissengeist, das Aqua mirabilis oder den Chartreuse, legendäre Rezepturen, die noch heute bekannt sind.
Die Pflanzenwässer wurden in den Jahrhunderten nach der Einführung der Destillationskunst in Europa lange mehr geschätzt und verwendet als die ätherischen Öle. Viele Destillier- und Kräuterbücher wurden meist von Ärzten verfasst, beispielsweise eine Handschrift von Gabriel von Lebenstein zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Man schätzte damals die Pflanzenwässer als wertvolle Medizin. Der österreichische Arzt Michael Puff von Schrick verfasste das älteste gedruckte Destillierbuch, das er bereits 1430 als Handschrift angefertigt hatte und für das wahrscheinlich die Handschrift von Gabriel von Lebenstein ein Vorbild war. 1448 wurde die Handschrift als Buch gedruckt, kurz nachdem die Buchdruckerkunst erfunden wurde. In seinem Buch lobt von Schrick die aus den Kräutern gebrannten Wässer als wirksame Medizin und beschreibt, wie man sie zur Gesundheit des Menschen nützen soll. Ein Exemplar des Orginalbuches befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek und kann dort digital eingesehen werden (siehe Abbildung Seite 18).
Der Arzt Hieronymus Brunschwig beschrieb 1512 in seinem Buch Das buch der waren kunst zu distillieren die Herstellung und Heilwirkung von 273 Pflanzenwässern. Er verfasste insgesamt zwei Bücher über die Destillation von Pflanzenwässern, zunächst das kleine und zwölf Jahre später, 1512, Das große Destillierbuch. Das Werk förderte in der Renaissance das Interesse am Destillieren und die Anwendung von Pflanzenwässern enorm. Brunschwig beschreibt in seinem Werk, wie man eine Sonnendestillation nur mithilfe von Sonnenwärme, ohne Zugabe von Wasser im Kolben vornehmen kann. Diese Pflanzenwässer werden in der Alchemie als besonders wirkungsvoll geschätzt und noch heute hergestellt. Auch die Destillation von Pflanzenwässern rein aus der Pflanze, ohne Wasserzusatz und im Wasserbad erwärmt, wird von Brunschwig beschrieben. Er bescheinigt den Pflanzenwässern 1 Jahr Haltbarkeit.
DER SCHATZ DER ARMEN
In seinem Buch gibt Brunschwig auch Anleitungen zur einfachen Herstellung von preisgünstigen Medikamenten. Er widmet dies als »Schatz der Armen« den weniger bemittelten Bevölkerungsschichten, die damals keinen Zugang zu Ärzten oder teuren Medikamenten hatten. »Damit hält er sich auch aus humanitären Gründen aus jenem Nimbus frei, mit dem sich die meisten seiner damaligen und späteren Berufskollegen aus Standesdünkel umgaben. Brunschwig stellte sich mit dieser seiner Haltung in die Reihe jener Ärzte, die, durchdrungen vom Ethos ihres Berufes, dem kranken Menschen ohne Standesunterschied zu helfen sich bemühten. Zu ihnen gehörte auch Paracelsus, der, nur wenig jünger als Brunschwig, kompromisslos die gleichen Ziele vertrat und hieraus bekanntlich bitterste Konsequenzen zu ziehen hatte«, so würdigt sehr treffend Prof. Heinz Prinzler (1983) das Wirken Brunschwigs. Der Ethos dieser beiden Männer, Brunschwig und Paracelsus, gehört zu den guten Geschichten, die sich um die Pflanzenwässer und die Destillation ranken. Das Buch von Brunschwig wurde ein Riesenerfolg und in jede europäische Sprache übersetzt. Es ist heute als Reprint erhältlich.
PARACELSUS
Zu jener Zeit lebte auch der oben erwähnte berühmte Schweizer Arzt und Alchemist, Theophrastus von Hohenheim, Paracelsus genannt (1493–1541). Für ihn ist die Alchemie nichts anderes als der rechte Umgang mit den Dingen der Natur. Er verband die Alchemie auf seine Art mit der Heilkunde, entwickelte und propagierte die noch heute bekannte Spagyrik, die sich mit der Herstellung von Heilmitteln beschäftigt. Einer der geistigen Nachfolger von Paracelsus in unserer Zeit, Alexander von Bernus (1880–1965), führte dieses Erbe weiter und entwickelte viele sehr wirksame Rezepturen für Heilmittel. Seine Gattin Isabella von Bernus öffnete mir für meine Studien die Bibliothek von Alexander von Bernus. Dort stieß ich auf interessante historische Literatur über die Pflanzenwässer und studierte viele der in diesem Text beschriebenen Bücher. Interessante Gespräche mit der wundervollen Isabella bereicherten mein Bild von der Alchemie.
Historische Glasdestillen, Aromamuseum Buchenau
WEITERENTWICKLUNG DER DESTILLATION
In der Renaissance gab es in Italien die ersten modernen Glasgefäße zur Destillation, da die Venezianer das Monopol auf diese Glasbläserkunst aus Murano besaßen. So verwendete man nun im Westen vorwiegend nicht nur kupferne oder tönerne Destillen, sondern man konnte mit den neuen Glasdestillen mit eigenen Augen zusehen, was im Inneren des Alambics, des Destilliergefäßes, geschah.
Das Wissen von Brunschwig über die Herstellung von Pflanzenwässern wurde in zahlreichen weiteren Büchern verarbeitet und weiterentwickelt. 1577 erschien zum Beispiel das umfangreiche Kräuterbuch von Hieronymus Bock, der darin zahlreiche Pflanzenwässer beschrieb. Weiterhin diente die Destillation vorwiegend der Herstellung von Pflanzenwässern und nicht von ätherischen Ölen. In der Volksheilkunde hat sich dieses Wissen von den Pflanzenwässern teilweise bis in die Zeit unserer Großmütter und Großväter erhalten.
MARIA, DIE MUTTER DER EUROPÄISCHEN ALCHEMIE
Während die Geschichten zur Destillation von Pflanzenwässern bisher vorwiegend von berühmten Männern berichteten, heften wir uns nun an die Fersen von bemerkenswerten Frauen, die ebenfalls mit Alchemie, Destillation und den Pflanzenwässern verbunden waren. Dafür gehen wir noch einmal zurück zu den Ursprüngen.
Im antiken Alexandria in Ägypten, in der alexandrinischen Epoche, formte sich die europäische Alchemie aus der ägyptischen Tradition, aus griechischer Philosophie und orientalischer Mystik. Alexandria, eine weltoffene Stadt, war damals Zentrum der Wissenschaften und besaß die umfangreichste Bibliothek der antiken Welt.
Dort lebten und wirkten seit der Zeit um Christi Geburt auch Philosophinnen, Ärztinnen, Mathematikerinnen und Alchemistinnen. Die Geschichte der Alchemie, und speziell die der Destillation, verband sich über lange Zeit mit der Geschichte und dem Leben bedeutender Heilerinnen. Die ersten historisch bekannten und berühmten Frauen im Umfeld des Heilens und Weissagens waren Seherinnen, wie die Sibyllen im antiken Rom, die Seherinnen des Orakels zu Delphi in Griechenland, die Astarte-Priesterinnen in Karthago, die weisen, wahrsagenden Frauen der Kelten und Germanen, deren Namen wie Wala oder Veleda erhalten geblieben sind. Frauen mit diesen Fähigkeiten scheinen zu Beginn der Alchemie diese Kunst mitbestimmt zu haben. Die erste namentlich bekannte Alchemistin aus Alexandria war Maria die Prophetin, auch Maria die Jüdin genannt. Sie lebte vermutlich im 1. Jahrhundert und gilt als Stammmutter der europäischen Alchemie. Wie der griechische Alchemist Zosimos, der Maria als seine Lehrerin bezeichnet, berichtet, machte sie bedeutende Erfindungen auf dem Gebiet der Labortechnik, besonders zur Destillation. Maria die Prophetin entwickelte einen damals neuen Destillationsapparat, den tribikos, der aus Tongefäßen und Kupferröhren konstruiert war. Um das Entweichen von Dampf aus der Destille zu verhindern und um die Teile miteinander zu verbinden, verwendete Maria, ganz nach Hausfrauenart, eine Teigmasse. Noch heute wird ein Teig aus Roggenmehl und Wasser für das Abdichten von Kupferdestillen gebraucht, der so genial wie einfach seinen Zweck erfüllt. Maria erfand außerdem den kerotakis, eine Art Rückflussapparatur, die weiterentwickelt noch heute in der Kosmetikindustrie verwendet wird. Marias alchemistische Arbeit, ihre labortechnischen Erfindungen wirken bis in unsere Zeit hinein. Sie legte den Grundstein für die heutige Chemie sowie auch zur Kosmetikherstellung, einer Tradition der weiblichen Alchemie, die auch heute noch mit den Pflanzenwässern verbunden ist. Maria führte das nach ihr benannte Marienbad balneum mariae, ein Wasserbad, ein, das in Frankreich heute noch als »bain-Marie«, bekannt ist. Es ist ein doppelwandiges Gefäß und dient zum langsamen Erwärmen von Substanzen. Es ist heute noch in der Gastronomie in Gebrauch. Es dient zum Schmelzen von Schokolade wie auch in der Herstellung von Cremes.
OPUS MULIERUM – DAS WERK DER FRAUEN
Frauen, die als Alchemistinnen arbeiteten, benutzten ihr praktisches Wissen als Hausfrau, um alchemistische Arbeiten zu verbessern. Das Marienbad kann man zu schonendem Kochen wie auch zur Destillation gebrauchen. Auch das Wissen vom Brotbacken, Bierbrauen usw. brachten die Frauen in das alchemistische Arbeiten mit ein. Die ägyptischen Alchemistinnen übernahmen auch Wissen und Rezepte von Frauen anderer Kulturen. So wurde dieses praktische Wissen von Frau zu Frau weitergegeben, wie in einer weiblichen Handwerkstradition. Aus diesen Gründen wird das alchemistische Werk auch opus mulierum, das Werk der (Haus)frauen, genannt. Viele Frauen der alchemistischen Linie haben die Entwicklung der Destillation wie auch anderer Vorgänge im Labor vorangetrieben und bis in unsere Zeit hineingewirkt. Manchmal wissen praktisch veranlagte Hausfrauen eben mehr als Professoren.
In der alchemistischen Tradition würdigt man noch heute diese ersten bekannten Alchemistinnen. Oft wurden ihre Spuren verwischt oder ihre Arbeiten Alchemisten zugeschrieben. Der römische Kaiser Diokletian ließ die Alchemistinnen verfolgen und ihre Schriften verbrennen. »In der Geschichtsschreibung der Naturwissenschaften werden Marias Entdeckungen und die anderer berühmter Alchemistinnen wie Kleopatra und Paphnutia meist Zosimos aus Panopolis zugeschrieben, der erst im 4. Jahrhundert n. Chr. in Alexandria lebte.« (Heymann, Moser, Sandner 1996)
DIE KUNST DER KOSMETIK
In Alexandria, der Stadt, die auch »Amme der Welt« genannt wurde, hat sich viel von der uralten babylonischen Tradition der Herstellung von Salben, Duftstoffen und Kosmetika mit der hoch entwickelten ägyptischen Tradition in diesen Bereichen verbunden. Die Arbeiten zur Kosmetikherstellung der babylonischen Parfumherstellerinnen wurden von ägyptischen Alchemistinnen wie Maria, Paphnutia, Theosebeia und Kleopatra weitergeführt. Von Kleopatra (69–30 v. Chr.) wird berichtet, dass sie die Kunst der Alchemie beherrschte, und zahlreiche, sehr wirkungsvolle Kosmetikrezepte sollen auf sie zurückgehen.
Wasserbrennerin bei der Arbeit, 15. Jahrhundert
Die Nahtstelle zwischen Ägypten und Mesopotamien im opus mulierum, der Arbeit der destillierenden Hausfrauen, führt uns zur frühesten namentlich bekannten Frau in dieser Reihe, zu Tapputi-Belat-ekallim. Sie lebte im 2. Jahrtausend v. Chr. im assyrischen Reich in Mesopotamien. Ein Tontäfelchen aus dieser Zeit (siehe Abb. Seite 19) berichtet, dass sie die Vorsteherin eines großen Haushaltes war und duftende Salben herstellte (Ebeling 1950). Dazu verwendete sie Blumen, Zyperngras, Myrrhe und wohlriechendes Schilfrohr, goss Wasser darüber und kochte alles in einem großen Topf. Vielleicht sammelte sie den aufsteigenden, mit ätherischen Ölen angereicherten Wasserdampf. Diese Tontafel, die von Tapputi berichtet, ist wahrscheinlich der älteste schriftliche Hinweis auf eine ganz ursprüngliche Art, duftende Pflanzenwässer und kosmetische Produkte herzustellen.
Die destillierenden Frauen, die Alchemistinnen, waren immer auch daran interessiert, mithilfe der Destillation Mittel für die Schönheit zu entwickeln. Viele Rezepte der Alchemistinnen haben sich bis heute erhalten. Noch immer nimmt die Kosmetik und die Herstellung von Parfums aus duftenden Pflanzen im Bereich der Destillation und der Pflanzenwässer, wie Sie in diesem Buch sehen werden, einen großen Raum ein.
KRÄUTERKUNDIGE ALCHEMISTINNEN
Besonders aber waren die forschenden Frauen aller Zeiten mit den Heilpflanzen verbunden, die sie für ihre Kosmetikrezepte wie auch für andere alchemistische Werke verwendeten – ein Erbe, das bis in die vorgeschichtliche Zeit zurückreicht, als Frauen Sammlerinnen von Pflanzen waren. Das opus mulierum war von Anfang an mit Heilpflanzenkunde, Kosmetik wie auch mit dem traditionellen Beruf der kräuterkundigen Heilerinnen und der Hebammen verbunden. Beide Künste, die Alchemie wie die Geburtshilfe, waren lange Zeit als Beruf für Frauen möglich. In der Medizinschule von Salerno in Italien, die auf der Tradition der arabischen Hohen Schulen, einem Vorläufer der heutigen Universitäten, fußt und deren Hochzeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert lag, studierten und lehrten auch Frauen. Die Ärztin Trotula, die zur Fakultät von Salerno gehörte, verfasste ein umfangreiches Werk über Gynäkologie und beschäftigte sich wie die alexandrinischen Alchemistinnen mit Kosmetikrezepturen. Sie schrieb ebenfalls ein Buch über Kosmetika. In Texten aus der Schule von Salerno wird auch die Herstellung von Rosenwasser genau beschrieben.
In der Renaissance, als die Alchemie eine Wiedergeburt erlebte, wird wieder mehr von Frauen berichtet, die im Alchemielabor arbeiteten und forschten, die Heilpflanzen zu Rezepturen verarbeiteten. Die Inquisition löschte allerdings die alte Kultur des opus mulierum, die Arbeit von Alchemistinnen, kräuterkundigen Hebammen und Ärztinnen aus, und heute versuchen kräuterkundige Frauen an das Wissen und Vermächtnis jener Frauen wieder anzuknüpfen. Jetzt, in unserer Zeit, mit der Wiederentdeckung der Destillation im nichtkommerziellen Bereich und der Heilkraft der Pflanzenwässer, ist auch das Interesse an der generationenübergreifenden Geschichte, die damit verbunden ist, erwacht und die Gestalt der einen oder anderen dieser frühen und legendären Alchemistinnen und Kräuterheilkundigen leuchtet aus dem Dunkel der Geschichte wieder auf.
Eine Schülerin von mir wurde auf der Suche nach regionalem Kräuterwissen fündig und entdeckte eine bemerkenswerte Frau der Renaissance, die sich der Destillation, dem Heilen und Helfen verschrieben hatte: Anna von Sachsen.
Tontäfelchen mit dem Namen Tapputi-Belat-ekallim, ca. 1200 v. Chr., Assur
»Wie sich meine große Leidenschaft zu den Pflanzenwässern, den Hydrolaten, entwickelte, ist eine spannende Geschichte: Während der Heilpflanzenausbildung bei Susanne Fischer-Rizzi hatten wir uunter anderem die Aufgabe, eine landschaftsbezogene Karte über die Region, in der wir leben, zu gestalten. Wir sollten auch nach Menschen fahnden, die dort in Verbindung mit Heilpflanzen einst tätig waren, und sollten unsere eigene phytotherapeutische Identität finden. Ich stellte fest, dass ganz in meiner Nähe vor 500 Jahren eine Frau gelebt hatte, die sich mit der Destillierkunst, mit Pflanzenwässern und der Alchemie sehr gut auskannte. Es war Kurfürstin Anna von Sachsen. 1532 als Tochter des dänischen Königs geboren, verheiratet mit August Kurfürst von Sachsen, Mutter von 15 Kindern, war sie außerdem Fachfrau für Destillation, Expertin für Pflanzenheilkunde, Gärtnerin, politische Beraterin ihres Gatten und Sammlerin von Arznei- und Kochrezepten. ›Mutter Anna‹ nannte man sie, weil sie nicht nur die von ihr hergestellten Arzneimittel im Familienkreis zur Heilung einsetzte, sondern sie auch an die arme und notleidende Bevölkerung kostenlos abgab. Aus den destillierten Wässern stellte sie außerdem Kosmetikartikel der damaligen Zeit her. Sie besaß mit ihrer Familie ein Jagdschloss, zu dem ein großes Destillierhaus mit zahlreichen Destillen gehörte. Ich fand heraus, dass sie besonders Königskerze, Kirschblüten, Beifuß, Odermennig, Schafgarbe und Pfingstrosen verarbeitete – genau wie ich heute in meiner Kräuterschule. Je tiefer ich in die Geschichte von Anna eintauchte, umso mehr fühlte ich mich von ihrem Geist und ihrem Wesen gefangen, und umso mehr begeisterte mich die Heilkraft der Pflanzenwässer. Anna ist eine Art Ahnin für mich geworden, deren Geist ich gerne weitertragen möchte.«
SIMONE SCHALK, KRÄUTERFACHFRAU, WILDKRÄUTER- UND HEILPFLANZENSCHULE MOLMERSWENDE
Auch in Italien gab es zur Zeit der Renaissance eifrig arbeitende und forschende Alchemistinnen, die Pflanzenwässer und andere Zubereitungen herstellten. Die bekannteste war wohl Caterina Sforza (1463–1509), Gräfin von Forli. Sandro Boticelli verewigte sie in vielen Porträts auf seinen Gemälden. Ihre Schönheit hat ihn zu künstlerischen Höchstleistungen inspiriert.
Caterina, eine außergewöhnliche Frau, die auch als »Amazone von Forli« bezeichnet wurde, führte ein luxuriöses, aber sehr bewegtes Leben voller Verfolgungen, Verschwörungen, Flucht und Gewalt. Vierhundert Rezepte, vorwiegend zur Phytokosmetik, sind von ihr erhalten geblieben. Besonders liebte sie die Pflanzenwässer, schätzte deren »Leichtigkeit und Transparenz« und war der Meinung, dass diese nicht nur die Haut, sondern auch die Seele schön und die innere Schönheit eines Menschen sichtbar machen können. Noch heute wissen wir um die psychische Wirkung der Pflanzenwässer, erleben und schätzen ihre wohltuenden, ausgleichenden Kräfte auf unser Gefühlsleben. Darüber werden Sie in den Kapiteln über die einzelnen Pflanzenwässer Angaben finden.
Auch nach dem Ende der Renaissance wurde die Destillierkunst weiter zur Herstellung von Pflanzenwässern betrieben. Im Kräuterbuch von Tabernaemontanus, das 1731 erschien, werden zahlreiche Pflanzenwässer aufgeführt und ihre Heilkraft und Verarbeitung genau erläutert.
DIE WASSERBRENNERINNEN
Die Destillierkunst zum Herstellen von Pflanzenwässern geriet dann mehr und mehr in Vergessenheit. Nur in der Alchemie und in der Parfümerie wurde sie noch praktiziert. Als die ätherischen Öle seit Ende des 18. Jahrhunderts in größerem Stil produziert wurden, verschwand das Interesse an den Pflanzenwässern. Einzelne Pflanzenwässer blieben in der Volksheilkunde erhalten und wurden in populären Kräuterbüchern beschrieben. Das Destillieren der Pflanzenwässer in kleinem Stil lag nun wieder in den Händen von kräuterheilkundigen Frauen, die sie herstellten, um Heilmittel für ihre Familie zur Verfügung zu haben oder auch von Hebammen, die Pflanzenwässer für ihre Arbeit verwendeten. Dieser Strang der Tradition der destillierenden Frauen führt bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Damals entstand der Stand der »Wasserbrennerinnen«. Sie brannten damals gewerbsmäßig mit Destillen Alkohol, und es waren meist Frauen, die diesen Beruf ausübten. Sie destillierten wohl auch, mit und ohne Alkohol, Pflanzenwässer und kannten sich mit deren Heilkräften bestens aus. Deshalb trägt das kleine Büchlein des Arztes Michael Puff von Schrick als Titelbild einen Holzschnitt, der eine Wasserbrennerin mit ihrer Destille zeigt (siehe Abb. Seite 18). Wasserbrennerinnen scheint es bis in unsere Zeit hinein gegeben zu haben. Wie eine Allgäuer Schülerin von mir auch auf der Suche nach heilkundigen Vorfahren herausfand, destillierten ihre Urgroßmutter und ihre Großmutter auf ihrem Bauernhof und stellten aus den Pflanzenwässern verschiedene Heilmittel für Mensch und Tier her.
Kurfürstin Anna von Sachsen, 1532–1585
PFLANZENWÄSSER IN DER MODERNEN AROMATHERAPIE
Als die moderne Aromatherapie Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich, Italien und England Fuß fasste, wurden die ätherischen Öle wiederentdeckt, aber nur wenige beschäftigten sich mit den Pflanzenwässern. Eine Ausnahme bildeten das Rosen- und das Orangenblütenwasser, die für Kosmetik und Küche traditionell verwendet wurden, aber aromatherapeutisch kaum eine Rolle spielten. Der Vater der modernen Aromatherapie, der Chemiker René-Maurice Gattefossé, der 1936 den Begriff »Aromatherapie« prägte, erforschte zunächst das Lavendelöl und dann weitere ätherische Öle, ohne auf die Pflanzenwässer besonders einzugehen. Auch sein Nachfolger, Jean Valnet, der im Zweiten Weltkrieg ätherische Öle zur Wundbehandlung einsetzte, erwähnt in seinem Buch Aromatherapie keine Pflanzenwässer. Der Arzt Prof. Paolo Rovesti, der an einer Mailänder Klinik die Wirkung der ätherischen Öle auf die Psyche erforschte, schreibt 1970 in seinem Buch über die Suche nach verlorenen Düften ein Kapitel über Aromatherapie mit Pflanzenwässern. Henry Viaud, ein erfahrener Destillateur, den ich in der Provence besuchte, besaß ein großes Wissen über die Pflanzenwässer. In seinem 1983 erschienenen Buch beschreibt er nicht nur die Wirkung der ätherischen Öle, sondern auch die der Pflanzenwässer. In der französischen und italienischen Aromatherapie und Aromapflege hat sich bis heute ein kleiner Teil des einstigen Wissens um die Heilkraft der Pflanzenwässer erhalten.
Im deutschsprachigen Raum ist die Aromatherapie erst wieder in den 1970er- und 1980er-Jahren neu entdeckt und belebt worden. Bis auch die Pflanzenwässer hier ihr Comeback nach einigen Jahrhunderten des Vergessens erlebten, sollte es noch etwas dauern.
DIE GESCHICHTE GEHT WEITER
Wieder tauchten die destillierenden Frauen auf. Diesmal stammten sie von einem anderen Kontinent und nicht aus Europa, das die Geschichte der neueren Aromatherapie geprägt hatte. 1983 erschien das Buch Secrets of the Still von Grace Firth, Lehrerin, Buschpilotin, Destilleurin und Heilpflanzenkundige in Alaska. Sie teilt in diesem Buch ihre langjährige Erfahrung mit dem Destillieren und beschrieb 50 verschiedene Heilpflanzen mit Rezepten und Hinweisen zur Destillation von ätherischen Ölen und Pflanzenwässern. Ihre Anleitungen sind gespickt mit herrlichen humorvollen Geschichten, die das Leben einer Lehrerin und Buschpilotin spannend machten. Hier sind wir bei einer Geschichte zur Destillation aus unserer Zeit angelangt. Dass es manchmal überlebenswichtig sein kann, die Kunst der Destillation zu beherrschen, zeigt diese Geschichte von Grace: An einem Sonntagnachmittag fuhr sie, einer spontanen Idee folgend, mit ein paar Freunden in einem Boot auf eine Insel, die der Küste Alaskas vorgelagert ist. Wegen bestimmter Meeresströmungen war es nicht möglich, die Insel wieder zu verlassen. Hier waren sie nun also auf einer Insel ohne überlebenswichtiges Trinkwasser. Was tun? Grace kam die Idee, eine Destille aus einer Kaffeedose, dem Ködereimer und Teilen des Bootes zu bauen.
»Ich erinnerte mich an eine trichterförmige Destille unseres Nachbarn, der damit Blumenwasser herstellte, und an die kupferne Vorrichtung in Großmutters Schrank oberhalb der Küchenspüle (in den es mir verboten war hineinzuschauen). Ich begann unsere Kaffeedose und den Benzintrichter sauber zu schrubben, während zwei andere in die Lagune paddelten, um an das am wenigsten trübe Wasser zu gelangen. Miki, dem das Boot gehörte, entfernte die Abdeckung vom Außenmotor – sie hatte eine Mulde mit einem runden Loch in der Mitte. Als Erstes legten wir flache Steine passgenau in den verzinkten Ködereimer. Wir platzierten die Kaffeedose so auf die Steine, dass sie nicht umkippte. Dann passten wir den Trichter in das Loch der Motorenabdeckung, sodass die Trichtermündung mit der Muldenhöhe in der Motorabdeckung abschloss – mittig zu der darunter stehenden Kaffeedose. Nachdem wir alle Fehlstellen mit Moos ausgestopft hatten, begannen wir damit, unser Feuer zu entzünden und Salzwasser im Eimer zu kochen. Es funktionierte! Wir hörten bald Kondenswasser von der oberen Abdeckung tropfen, entlang des Trichters runter in den Kaffeetopf.«
Destille von Grace Firth
Die Idee von Grace durch Destillation aus Meerwasser Trinkwasser herzustellen, wurde übrigens schon im 2. Jahrhundert n. Chr. von dem antiken Philosophen Alexandros von Aphrodisias beschrieben. Auch damals versorgten sich Seeleute so mit dem überlebensnotwendigen Süßwasser.
Dem Buch von Grace Firth folgten weitere Bücher von Autorinnen, die mit Pflanzenwässern therapeutisch arbeiten oder sie herstellen. 1999 erschien das Buch von Jeanne Rose, der US-amerikanischen Heilpflanzenfachfrau und Aromatherapeutin, 375 Essential Oils and Hydrosols. Jeanne Rose ist der Meinung, dass Pflanzenwässer die eigentliche Aromatherapie darstellen. Im selben Jahr erschien in Frankreich das erste, umfassende Buch, das sich ausschließlich mit der therapeutischen Wirkung und Anwendung der Hydrolate, der Pflanzenwässer, befasst: Les Hydrolats: Thérapie des Eaux florales von Lydia Bosson und Guénolée Dietz. Die Pflanzenwässer, die in neuerer Zeit nur als Beiprodukte der Herstellung von ätherischen Ölen betrachtet wurden, bekamen nun einen eigenen Stellenwert, eine Wertschätzung als aromatherapeutisch wirksame Heil- und Pflegemittel. 2001 gab die kanadische Aromatherapeutin Suzanne Catty ihr Buch Hydrosols – The Next Aromatherapy heraus. Es war das erste ausführliche und umfangreiche Werk in englischer Sprache über die Pflanzenwässer mit vielen Erkenntnissen und Erfahrungsberichten aus ihrer therapeutischen Praxis. Es enthält Angaben zu Wirksamkeit, Verabreichung, Inhaltsstoffen, pH-Wert, Haltbarkeit, Anwendungsprotokolle und vieles mehr. Die englischen Aromatherapeuten Shirley und Len Price schrieben ebenfalls ein Buch über die Pflanzenwässer, Understanding Hydrolats – The specific Hydrosols for Aromatherapy, das 2004 publiziert wurde und sich als ein Führer zur professionellen Anwendung der Hydrolate versteht.
Dann war es endlich so weit: Das erste deutschsprachige Werk über die Pflanzenwässer, Hydrolate, die vergessene Dimension der Aromatherapie und Aromapflege, erschien 2012 als E-Book von der deutschen, in Irland lebenden, bekannten Aromatherapeutin Eliane Zimmermann. Seit Ende 2013 ist es auch als Buch erhältlich. Es ist eine gute Bestandsaufnahme des bis dahin vorhandenen modernen Wissens über Pflanzenwässer aus der Aromatherapie und Aromapflege und ein Aufruf zum weiteren Entdecken der Pflanzenwässer. Ein weiteres Buch folgte 2012 von Ingrid Kleindienst-John: Hydrolate – Sanfte Heilkräfte aus Pflanzenwasser, in dem erstmals in Verbindung mit Pflanzenwässern erklärt wird, wie man diese selbst destillieren kann.
Und nun halten Sie mein Buch in den Händen. Tauchen Sie mit mir ein in die faszinierende Welt der Pflanzenwässer, nun auch verbunden mit der Naturheilkunde, der Alchemie, einer ganzheitlichen Sicht der Pflanzenwelt und vielen Erfahrungsberichten aus der Praxis mit Hydrolaten.
Lernen Sie deren Kräfte kennen, und werden Sie Teil dieser spannenden Geschichte.
Die Pflanzenwässer sind zurückgekehrt.