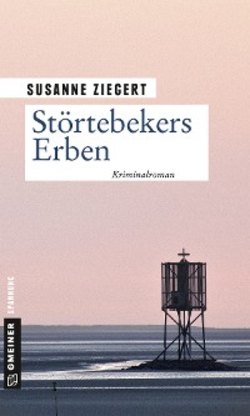Читать книгу Störtebekers Erben - Susanne Ziegert - Страница 7
Kapitel 2
ОглавлениеDas leise Knarren auf der Treppe entlockte Margo, die im Zimmer hinter der Rezeption am Computer saß, ein amüsiertes Lächeln. In dem Leuchtturm brauchte man einfach keine Alarmanlage, die jahrhunderte alte Holztreppe knarrte und quietschte, so vorsichtig man seine Füße auch setzte. Das Treppenhaus war außerdem lückenlos mit Kameras behängt, um die sogenannte Staatsetage, die sich über dem kleinen Hotel befand, vor unerbetenen Besuchern abzuschirmen. Im historischen Ratssaal mit den alten Wappen im oberen Geschoss konnten Hamburgs Senatoren tagen, wenn sie den Außenposten der Stadt besuchten. Drei luxuriöse Suiten standen für längere Aufenthalte bereit. Für das Wohlbefinden der Amtsträger war das Neueste und Teuerste gerade gut genug. Die Besuche waren jedoch rar, und die Räume standen meist leer.
Margo erkannte ihren derzeit einzigen Gast, der offenbar versuchte, die knarrende Treppe zu überwinden, ohne dass es jemand merkte. Seine Schuhe trug er in der Hand und drückte sich an die Wand, er wollte nicht gesehen werden. Lassen wir ihn mal in dem Glauben, dachte Margo. Dann fiel ihr Blick aber auf einen schwarzen Schatten. Was war das für eine merkwürdige, lange schwarze Tasche, die er sich umgehängt hatte und mit beiden Händen festhielt? Man sieht die merkwürdigsten Dinge, hatte sie die Wirtin vorgewarnt, sogar auf einer ganz kleinen stillen Insel in der äußersten Provinz. Sie saß noch spät vor dem Computer, denn sie wollte der Wirtin Hillu ihren ersten Bericht schicken und überlegte krampfhaft, was sie ihr an besonderen Vorkommnissen mitteilen sollte. Ihre Gedanken schweiften ab, und sie dachte an ihre abenteuerliche Überfahrt vor einer Woche. Wie in einer Karawane in der Wüste kamen die Pferdewagen über das Watt gefahren, diese graue Sandfläche voll unberechenbarer Wasserläufe. Es war beeindruckend für Margo, als sie auf dem Kutschplatz auf dem Festland stand und dann die ersten Wagen in der Ferne auftauchen sah. Sie schienen direkt aus dem Meer zu kommen, in der Ferne hinter ihnen sah Margo große Schiffe vorüberfahren. »Ist das nicht gefährlich?«, hatte sie einen älteren Mann gefragt, der sich um das Gepäck der Touristen kümmerte. Doch der belehrte sie, dass die Pferdewagen nur bei Ebbe hin- und herfuhren, und diese Wattwagen seien immer noch die zuverlässigste Möglichkeit, auf Neuwerk zu kommen. Die fuhren auch noch in der Nachsaison, wenn das Schiff Pause machte, bei Regen, Sturm und Gewitter. Jeweils bei Ebbe setzten sich die speziell für den nassen Untergrund konstruierten Kutschen am Festland und auf der Insel in Bewegung, um Gäste oder Material auf die andere Seite zu bringen.
Schon seit Jahrhunderten fuhren die Insulaner gemeinsam zum Festland, um sich beizustehen, wenn ein Wagen mit seinen Rädern in einen tiefen Priel geriet oder eines der Pferde stürzte. Das passiert nur sehr selten, versicherte ihr der Mann. Die Kutschen waren mittlerweile am Sandstrand angekommen, die Pferde nahmen Schwung und kamen dann auf den Halteplatz angetrabt. Ihr Gesprächspartner warf ihre Koffer nach hinten und stellte ihr eine Leiter an die Kutsche, und sie war erstaunt, wie hoch diese war. Zwischen den Rädern und einem Aufbau mit Sitzbänken befand sich noch eine Art Gestell, durch die Höhe blieben die Gäste meist trocken, hatte sie von ihrer Bekanntschaft erfahren. Sie nahm auf einer kalten und durchnässten Sitzbank Platz. Der Kutscher hatte ihr kurz zugenickt und dabei einen knurrenden Ton von sich gegeben, der wohl eine Begrüßung sein sollte. Hillu hatte ihr in der Mail geschrieben, dass sie sich am Deich einfinden sollte und dass sie dort von einem Wattwagen abgeholt würde. Das sei eine wunderschöne Überfahrt, manche Touristen kämen nur nach Neuwerk, um einmal mit einem solchen Wattwagen zu fahren. Die Geschmäcker sind eben verschieden, dachte Margo. Sie verstand bald, warum der Mann mit dem Cowboyhut so verkniffen aussah. Sie fröstelte schon nach wenigen Minuten auf dem feuchten Sitz unter dem strömenden Regen, merkte, wie die Feuchtigkeit durch ihre Kleidung hindurch bis auf die unterste Schicht kroch, und schlang die Decke fester um sich.
Die beiden schweren großen Pferde trabten den Strand hinab und in den graubraunen Schlamm hinein. Das Wasser spritzte Margo ins Gesicht, an der Seite wirbelten die Räder noch mehr Nass nach oben. Ihre Augen brannten von den Regentropfen, sie sah ohnehin nur Schlamm um sich und Wasser. Der Wagen schien geradezu ins Nichts zu fahren. Erleichtert sah sie nach einer unendlich lang erscheinenden Zeit Land vor sich auftauchen, grün ragte es aus dem Meer hervor, außer einem rötlichen Gebäude, wahrscheinlich dem Leuchtturm, konnte sie keine Häuser erkennen. Das musste Neuwerk sein, ihre neue Heimat für die nächsten sechs Monate.
»Böses Omen«, hatte der Cowboy finster gebrummt, als sie nach einer Stunde triefend und durchgefroren am Leuchtturm angekommen waren. Margo hatte schon genug über die Insulaner gehört, ein streitbares Völkchen, das gegen Festlandbewohner fest zusammenhielt.
»Ich bin die neue Leuchtturmwärterin – jedenfalls für den Winter«, hatte sie sich ihm vorgestellt.
»Die Letzte ist nach drei Tagen abgehauen: Inselkoller«. Verächtlich spuckte der Typ irgendein braunes Zeug haarscharf an ihr vorbei, wahrscheinlich Kautabak. »Wir sind hier nicht so verkommen wie ihr auf dem Festland. Hier hilft jeder jedem. Doch das geht in eure Köpfe nicht rein.« Er schlug sich mit der Hand an seinen wassertriefenden Lederhut.
Der Typ hatte offensichtlich etwas gegen Zugezogene im Allgemeinen, und sie konnte er wohl im Besonderen nicht ausstehen. Wortlos ließ er ihren Koffer vor den Eingang plumpsen und ging ohne Gruß zurück zu seinem Gespann. Er winkte nur ab, als sie ihn fragte, was sie für die Überfahrt schuldete.
»Das hat Hillu geregelt. Die weiß, was sich gehört.«
Das war nicht gerade ein ermutigender Anfang, aber sie war nicht zum Vergnügen hier. Und sie fragte sich, wie sie die Stille der Natur aushalten würde. Sie liebte ihre Wahlheimat Berlin, die Stadt hatte genau die richtige Größe, war nicht ganz so hektisch, wie Paris, wo sie davor studiert hatte. In Berlin lebte es sich entspannter, die Stadt war aber dennoch lebendig und inspirierend für sie.
Selbst ihre Bilder, die sie als Malerin schuf, zeigten keine grünen Idyllen oder gar Meer mit fluffigen Wolken, sondern Großstadtlandschaften mit Brücken, Schienen oder Hochhausgebirgen. Die Natur inspirierte sie nicht zum Malen, ihre Kunst brauchte das schrille Kreischen der Hochbahn in den Kurven, das Heulen der Martinshörner, und sie vermisste sogar das monotone Spiel des bulgarischen Akkordeonisten unter ihrem Kreuzberger Fenster. Aber sie brauchte Zeit für sich, sechs Monate, nachdem ihre Mutter gestorben war. Der Notar hatte ihr zwei Briefe ausgehändigt, einen, den sie nach dem Tod ihrer Mutter verschicken sollte und einen, der an sie selbst gerichtet war. Diese letzten Worte hatten sie tief erschüttert, doch der Brief hatte ihre Fragen, die sie ihrer Mutter gerne gestellt hätte, nicht beantworten können, er hatte sie mit noch mehr Fragen allein zurückgelassen und Margo hatte beschlossen, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
Mutterseelenallein fühlte sie sich, und das war sie ja nun auch, ihr Lebensgefährte Friedrich hatte kein Verständnis für ihre Trauer und ihre Grübeleien gezeigt. Sie wollte deshalb auch gleich eine Auszeit von dem Mann an ihrer Seite nehmen, um über ihre Beziehung nachzudenken. Sie hatte es satt, immer nur das Anhängsel des bekannten Ökounternehmers zu sein und nur eine winzig kleine Nebenrolle in dessen Leben voller bedeutsamer Termine zu spielen.
Von einem Tag auf den anderen hatte sie die Stelle als Vertretung im Leuchtturmhotel angenommen. Die Hotelbetreiberin wollte den Winter mit ihren Kindern auf dem Festland verbringen. Bald war Saisonende, dann hatte Margo keine Gäste mehr zu betreuen, sondern einen Bereitschaftsdienst mit Präsenzpflicht, denn die Senatswohnung musste dauerhaft besetzt sein. Außerdem hatte Hillu ihr eine Liste mit Erledigungen hinterlassen, die sie im Lauf des Winters abarbeiten sollte. Stress würde sie auf jeden Fall nicht haben, wenn sie nicht einmal mehr Frühstück servieren musste.
Sie schaute hinter sich auf den Kalender, die Pension war nur noch zwei Tage geöffnet. Sie fragte sich, wie sie mit der Ruhe und der Einsamkeit zurechtkommen würde, wenn bald der letzte Gast abgereist war. Insgeheim hoffte sie, dass ihr Lebensgefährte nun um sie kämpfen würde und vielleicht ganz überraschend ein Motorboot chartern würde und zu Besuch käme. Offiziell fuhren die Wattwagenkutscher außerhalb der Saison nicht mehr täglich zwischen Insel und Festland, doch gegen das entsprechende Kleingeld würden sie sicher ihre Pferde anspannen. Aber sie wusste auch, dass sie sich wahrscheinlich etwas vormachte. Er hatte beim Abschied am Bahnsteig niedergeschlagen gewirkt und gesagt, dass er sie vermissen werde. Sicher war sein Bedauern über ihre lange Abwesenheit nicht gespielt gewesen, aber in seinem stressigen Alltag hatte er dies bestimmt schon bald wieder vergessen. Ihr Blick fiel wieder auf den Computer, gerade einmal zwei Zeilen hatte sie in ihrem Bericht geschafft. Vielleicht war es besser, sie würde sich am Morgen mit neuer Energie an den Text setzen. Dann fiel ihr noch ein, dass ihr Hillu eingeschärft hatte, den Konzertabend im »Seemannsgarn« nicht zu verpassen, der an diesem Abend stattfand. Sie schloss die Tür zur Rezeption ab und ging über den Flur in ihr Zimmer, das sich auf der gleichen Etage befand.
Heute Abend wollte sie endlich wieder unter Menschen gehen; sie hoffte, weitere Inselbewohner kennenzulernen, die Antworten auf all ihre Fragen hatten.
Margo schlüpfte in ein kurzes schwarzes Kleid, zog elegante Schuhe an und den dicken Wollmantel darüber, um sich gegen den Wind zu schützen. Der Platz vor dem Leuchtturm wirkte wie ausgestorben, die Fensterläden am Schullandheim waren geschlossen, das Haus winterdicht eingemottet, und auch beim Kaufmann, ihrem direkten Nachbarn, war kein Licht zu sehen. Heins Wohnung befand sich über seinem Laden, davor hatte er zwei Zelte mit Sitzbänken aufgestellt, damit die Tagestouristen seine Fischbrötchen auch bei Schlechtwetter im Trockenen verspeisen konnten. Sie hatte sich anfangs gewundert, warum er täglich andere Öffnungszeiten hatte, und dann verstanden, dass sich der komplette Rhythmus der Insel nach den Gezeiten richtete. Ob Hein auch zu dem Konzert gegangen war? Sie war froh, als sie auf dem beleuchteten Mittelweg angekommen war, der nach Norden führte, rechts und links in der Dunkelheit befanden sich Weiden, auf denen Kutschpferde und Kühe grasten. Sie musste dem Weg bis zum anderen Ende der Insel folgen, das zum Glück keine zwei Kilometer entfernt war. Schon von Weitem sah sie die hell erleuchteten Fenster vor sich, das musste das »Seemannsgarn« sein, Kneipe, Café, Restaurant und Konzertbühne in einem, der einzige Ort mitten im Wattenmeer, wohin man ausgehen konnte, hatte ihr Hillu vorgeschwärmt. Das schloss insbesondere den Wirt ein, den Musiker Jo Prell, der als Wattrocker bekannt geworden war.
Angefangen hatte er mit einer schnell zusammengezimmerten Holzbude hinter dem Deich. Damals reichte der Wattrocker seine Grogs und geräucherten Heringe über den Tresen ins Freie und sang im Sommer mit der Gitarre am Lagerfeuer. Aus der Bude war ein solides Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche geworden und der Wattrocker eine Berühmtheit. Mit seinen Konzerten füllte er selbst größere Veranstaltungsorte und wurde bundesweit in Talkshows eingeladen.
Vor dem flachen Holzbau, der an ein traditionelles Friesenhaus mit Reetdach angebaut war, wehte knatternd eine schwarze Piratenflagge, das Markenzeichen, das wohl noch aus den Anfangsjahren stammte.
Margo stand in der offenen Tür und ließ ihren Blick über den mit Fischernetzen, Rudern, Muscheln und präparierten Fischen dekorierten Gastraum schweifen. Links befand sich ein Tresen, vor dem sich die Gäste drängten, rechts und links davon waren die Tische im Restaurant voll besetzt, zwei Kellner mit Piratentüchern um den Kopf eilten mit Tellerstapeln an ihr vorbei, eine weitere Bedienung im Seeräuberkostüm verteilte kleine Gläser mit Hochprozentigem, wohl zur Verdauung der norddeutschen Spezialitäten. Zum Essen war Margo zu spät dran, dabei sollte es hier die beste Nordseescholle Neuwerks geben. Von einem runden Tisch, der auf einer kleinen Plattform in der Mitte der beiden rechtwinklig aufeinander zulaufenden Gasträume um einen alten Schiffskompass herum gebaut war, sah sie jemanden hektisch in ihre Richtung winken.
David, der Leiter des Nationalparkhauses, ruderte mit seinen Armen, um Margo an den Tisch zu lotsen, an dem er mit zwei Wattführern vom Festland beim Bier saß. Margo hatte die beiden mehrmals beim Inselkaufmann gesehen, als sie mit einer Gruppe Wanderer eingetroffen waren. Sie setzte sich neben David und scherzte: »Lange nicht gesehen«, denn er hatte noch am Nachmittag eine Gruppe Ornithologen auf den Leuchtturm begleitet.
»Manche Menschen kann man gar nicht oft genug sehen«, antwortete David, als ihn Margo mit einem Küsschen begrüßte.
»Oho, der Schwerenöter. Wo ist denn deine Freundin?«, rief einer der beiden Männer in Davids Richtung. »Wir sind gestrandet«, erklärte er Margo. Sie waren mit ihren Gästen vom Festland durch das Watt gewandert und sollten mit dem Schiff zurück fahren, doch wegen des Sturmtiefs war der Schiffsverkehr ausgesetzt, und die Gruppe saß über Nacht auf der Insel fest. Ein Paar mittleren Alters kam an den Tisch und protestierte lautstark gegen die Programmänderung.
»Aber es muss doch möglich sein, von dieser öden Insel zu kommen«, zeterte die dickliche Frau in bunter Funktionsbekleidung. »Mein Mann ist Unternehmer, er hat schließlich wichtige Termine.« Der stille sehr dünne Gatte schwieg zu dem Lamento. Die Gattin zischte verächtlich. »Nicht mal einen Wellnessbereich gibt es!« Plötzlich verstummte sie.
Ein blonder Hüne im Karohemd mit Dreitagebart hatte sich den Weg von der mittlerweile sehr vollen Bar zu ihrem Tisch gebahnt und deutete eine leichte Verbeugung vor Margo an: »Die schöne Leuchtturmwärterin, welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte.« Seine wasserblauen Augen hatte er wie Scheinwerfer auf Margo gerichtet, und seine Gedanken ließen sich leicht erraten, als sein Blick an ihrem Dekolleté hängen blieb.
»Ich bin Jo. Jo Prell, wie Jacques, aber mit P und zwei L«, sagte er dann und streckte erst Margo und dann David lässig seine Pranke hin, die anderen Gäste am Tisch bedachte er mit einem leichten Nicken.
»Malgorzata, kurz Margo«, stellte sie sich vor. Sie kannte den Wattrocker bisher nur aus den bunten Magazinen, in denen sie manchmal im Wartezimmer ihres Zahnarztes blätterte; dass er sich nun neben sie gesetzt hatte, passte perfekt in ihren Plan. An Seemannsgarn über Jo Prell fehlte es nicht, sie war natürlich auch davor gewarnt worden, dass er ein unverbesserlicher Casanova sei, der in jedem seiner Konzertorte mehrere Freundinnen habe. Es kam ihr aber durchaus gelegen, dass er offensichtlich mit ihr flirten wollte. Am besten reden lassen und ganz naiv auf sein Geplänkel einsteigen, dann wird er mehr Informationen preisgeben, als ihm am Ende lieb ist.
»Jetzt verstehe ich den Namen ›Seemannsgarn‹«, entgegnete sie.
»Was lässt Sie denn zu dieser überraschenden Schlussfolgerung kommen, schöne Frau?«, er warf ihr einen langen und eindeutigen Blick zu.
»Nun ja, Leuchtturmwärter sind ja leider ausgestorben. Und bescheiden ist die Hütte nur noch auf dem Foto.« Sie deutete auf eine Reihe Schwarzweißaufnahmen an der Wand, auf denen noch das alte Holzhäuschen mit Piratenflagge zu sehen war.
»Genau genommen sitzen wir jetzt noch hier«, erklärte der Musiker. Mit seiner rechten Hand skizzierte er vier Linien in der Luft und zeigte in Richtung der Wände des großen Mittelraumes. »Genau hier, das sind exakt zehn Mal drei Meter, der Grund, den mir mein Vater für mein Geschäft überlassen hat. Ansonsten hat er mich enterbt. Alles andere habe ich mir selbst erarbeitet, Jahr für Jahr ein Stück ausgebaut«, erklärte er voller Stolz. »Aber wenn mich mein Alter damals wegen der Musik nicht rausgeschmissen hätte, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich bin.«
»Ja, manchmal kann ein Familienkrach auch Gutes bewirken«, pflichtete ihm Margo bei. »Dann sind Sie trotzdem Ihrer Insel treu geblieben?«, fragte sie, als eine dickliche blonde Frau mit Kochmütze an den Tisch trat, die den Wattrocker wütend anblickte und mehr forderte als fragte: »Kommst du bitte mal in die Küche, Schatz!«, was dieser ohne hörbaren Protest auch tat.
»Jaja, da weiß man, wer die Hosen anhat«, mokierte sich David über Jos Abgang.
Margo entdeckte auf dem Stuhl neben ihr etwas Weißes, das Jo aus der Tasche gerutscht war. Unauffällig schob sie ihre Handtasche darüber und steckte das verlorene Stück Stoff in die Tasche. Sie würde es sich später genau ansehen. Bisher war der Abend ganz gut gelaufen, jetzt konnte sie den kulturellen Höhepunkt des Insellebens genießen, jedenfalls sahen das die Ureinwohner so.
Eine Viertelstunde später setzte sich der Wattrocker mit seiner Gitarre auf die Bühne. Er begleitete sich selbst zu, wie er ankündigte, romantisch-depressiven Songs über die Gezeiten, die Natur, das Leben, die Liebe, die in seinen Liedern selten gut ausging, seinen Bruder, der zu früh gegangen war.
»Was war denn mit seinem Bruder?«, fragte sie David leise.
»Der hatte wohl einen Unfall im Watt, war vor meiner Zeit«, flüsterte er und verabschiedete sich dann. Margo hörte gebannt zu. Die poetischen Texte seiner Songs, die er mit seiner rauchigen Stimme vortrug, überraschten Margo. Sie hatte eher so eine Art Stimmungsmusik erwartet. Mittlerweile hatten sich die Tische geleert, da stimmte Jo mit einigen Fans noch das »Insellied« an. Es war eines der stimmungsvoll fröhlichen Lieder, die den Ruhm des Musikers begründet hatten, die er allerdings nur noch auf ausdrückliches Verlangen des Publikums spielte.
»Der Rausschmeißer«, scherzte einer der Wattführer. »Länger darf er nicht, da schimpft die Gattin.« Margo erschrak, als sie auf die Uhr sah. Schon nach eins, sie schnappte ihre Handtasche, nickte dem Künstler kurz zu und eilte zum Leuchtturm zurück. In nicht einmal sechs Stunden musste das Frühstück bereit sein. Doch der Abend hatte sich gelohnt, sie hatte etwas, das sie weiterbringen würde. Sie sah sich den Stoff genauer an, legte ihn in eine Plastiktüte und verstaute diese ganz unten in ihrem Kleiderschrank.
*** Holzfischen. Den Menschen des Meeres die Früchte des Meeres. Das hatte sein Großvater immer gesagt. Arm waren sie und ständig der Gefahr der tosenden See ausgesetzt, den Stürmen, den Wellen und den Fluten, die so viele von ihnen verschlungen hatten. Von alters her gehörte ihnen, was das Meer an ihre Küste spülte. Manches Mal hatte das ihren Vorfahren das Leben gerettet, wenn die Frauen nicht mehr wussten, womit sie ihre vielen Kinder am nächsten Morgen ernähren sollten und die Männer weit weg auf dem Meer oder eines Tages nicht mehr wiederkamen. Dann erbarmte sich der Wettergott und sandte ein Fass voller Heringe oder Brot, das eines der gestrandeten Schiffe mit sich geführt hatte. Nicht immer erreichte sie die rettende Gabe noch rechtzeitig, um alle Münder zu füttern, die Alten erzählten oft von den kleinen Särgen, die sie zum Festland brachten. Wann immer eine Ladung Holz über Deck gegangen war, fuhren die erwachsenen Männer der Insel zum Holzfischen. An Land wurden die Bretter und Balken in Stapel aufgeschichtet. Sie stellten dann einen kleinen Jungen mit dem Rücken zum Holz, sodass er es nicht sehen konnte. Von Stapel zu Stapel führten sie ihn, dann rief er jedes Mal den Namen einer Familie. So wurde Haufen für Haufen gerecht verteilt. In jedem Haus wirst du die Balken und Bretter finden, die über Bord gegangen sind. Denn das wenige Geld reichte gerade einmal für eine Handvoll Getreide für jeden von ihnen, und auf dem salzigen Fleckchen Erde wuchs nichts, womit sie ihre armseligen Hütten bauen konnten. Der Herr nimmt und der Herr gibt, sagte dann der Großvater.