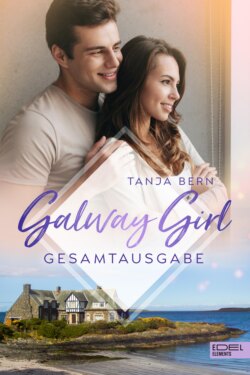Читать книгу Galway Girl Gesamtausgabe - Tanja Bern - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
- 5 -
ОглавлениеIch erwache und weiß für den Augenblick nicht, wo ich bin. Sonnenstrahlen blenden mich. Ich schaue auf eine Scheibe, wo der Frost notdürftig weggekratzt ist. Mir ist kalt, obwohl ich meine Jacke trage und eine Decke auf mir liegt, wie ich erstaunt feststelle.
Abrupt kehrt die Erinnerung zurück, und ich richte mich zu rasch auf. Mir ist kurz schwindelig, doch das legt sich wieder.
Neben mir steht eine Thermoskanne und eine Brotdose. Ich greife nach dem metallenen Gefäß, stelle verwundert fest, dass es warm ist. Ich schraube den Deckel ab, schnuppere an dem heißen Dampf. Kaffee? Woher hat Ethan heißen Kaffee?
Ich sehe mich um. Wo ist er eigentlich?
Durch die Fenster kann ich nur schemenhaft etwas sehen, denn sie sind beschlagen. Also öffne ich die Tür, schnappe mir mein Frühstück und gehe hinaus. Die Temperaturen sind eisig, ich atme die klare Luft ein.
Der Healy Pass ist von Schnee bedeckt. Die Sonne kommt hinter den Wolken hervor, bestrahlt die Hügel. Es sieht aus wie ein glitzerndes Zauberland.
Ich lache leise auf, umklammere meinen Kaffee und blicke mich suchend nach Ethan um.
Auf der anderen Seite des Autos im Windschatten finde ich einen kleinen Campingkocher inklusive Topf.
„Ethan?“ Meine Stimme hallt seltsam wider.
Es ist ruhig und einsam hier oben. Nur der Wind rauscht über die Ebene.
Noch kann ich nicht sagen, ob ich dieses Abenteuer genieße, meine Gefühle sind zwiegespalten.
Mit einem Seufzen gehe ich zu einem der Felsen, streiche den Schnee herunter und setze mich darauf. Ich frühstücke und fühle mich plötzlich wie in einem Endzeitfilm. Rasch vertreibe ich diesen Gedanken.
Wo bist du nur, Ethan?
Nach einer halben Stunde setze ich mich ins Auto, weil mir nun richtig kalt ist. Die Schlüssel stecken, doch als ich den Motor starten will, rührt sich nichts.
Mir wird übel.
Noch einmal versuche ich es, der Anlasser klickt nur leise. „Das darf doch nicht wahr sein!“
Ich haste hinaus, mein Herz rast. „Ethan!“, rufe ich, so laut wie ich kann.
Eine leise Antwort kommt aus unserer Fahrtrichtung, ich verstehe sie aber nicht. Ob er Hilfe braucht?
Rasch nehme ich die Gaskartusche aus dem Kocher und räume die Kochutensilien wieder ins Auto. Ich ziehe mir meine Mütze über, klappe den Kragen meines Parkas hoch und schließe den Land Rover ab. Entschlossen stapfe ich durch den Schnee, finde Ethans Spuren und folge ihnen. Obwohl es mir wirklich sehr kalt vorkommt, taut es bereits, der Schnee ist nicht mehr so pulvrig.
Erschrocken weiche ich zurück, als er hinter einem Felsvorsprung hervorkommt. Ich lege meine Hand aufs Herz. „Du lieber Himmel, hast du mich erschreckt.“
„Das wollte ich nicht, tut mir leid.“
„Was machst du denn hier?“
Ethan wirkt zerknirscht. „Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber der Wagen springt nicht mehr an.“
„Ja, das ist mir aufgefallen.“
„Die Batterie verträgt anscheinend die Kälte nicht.“
„Das erklärt nicht, warum du hier herumstreunst.“
Er lacht auf, doch der Laut kommt mir nicht fröhlich vor. „Ich wollte mich orientieren. Ich brauchte einen Punkt, den ich kenne.“
„Und?“
„Es sieht im Schnee alles so fremd aus. Aber ich weiß, dass wir gestern schon am Glanmore Lake vorbeigefahren sind. Zu Fuß sind es bei guten Wetterverhältnissen vielleicht noch anderthalb Stunden.“
„Du wolltest alleine nach Adrigole laufen?“
„Nein! Ich lasse dich doch nicht so lange ohne eine Nachricht hier oben alleine.“
Ich lächle. „Du hast also die Gegend ausgekundschaftet.“
„Sozusagen.“ Er fährt sich durchs Haar, wuschelt es auf und sieht dann aufmerksam in den Himmel.
„Und? Hast du irgendwelche Feinde gefunden?“
„Oh ja, glitschige Felsen, kleine Abgründe und tiefe Matschlöcher, die der Schnee verbirgt.“ Er hebt seinen rechten Fuß hoch. Sein Stiefel ist voller Schlamm. „Außerdem windet sich der Weg hier hin und her. Der Straße zu folgen wird nicht leicht sein. Es sei denn, es taut weiter.“
Wieder guckt er nach oben, ich folge seinem Blick. Die Wintersonne strahlt mit voller Kraft, ist jedoch von tiefgrauen Wolken umgeben.
„Ob es regnen wird?“
„Ich bin nicht sicher, es sieht danach aus. Die Luft erwärmt sich zwar langsam, aber der Boden ist noch gefroren.“
„Glatteis.“
Ethan nickt.
„Dann lass uns aufbrechen.“
„Du hast nicht zufällig den Kocher und so weggeräumt?“
„Doch, hab ich, wie es sich für eine brave Frau gehört“, sage ich in scherzhaftem Ton.
Er schnauft amüsiert auf. „Wie es sich für eine brave Frau gehört? Auf welchem Trip bist du denn?“
Der witzig gemeinte Spruch weckt eine Erkenntnis, die mich unangenehm berührt. „Bei Thomas … war ich das irgendwie. Manchmal kam ich mir vor wie in den Sechzigern. Er hat das erwartet, weil er längere Arbeitszeiten hatte.“
Ethan starrt mich an, ich weiche ihm aus, in dem ich an meiner Jacke herumzupfe. Ich fühle seine Hände an meinen Oberarmen, er dreht mich zu sich hin.
„Das ist bescheuert.“
Ich senke den Kopf. „Ja, ich weiß.“
„Sieh mich an, Sínead, bitte.“
Ich komme dem nach, schaue ihm in die grauen Augen, die hier in der Schneelandschaft viel heller wirken.
„Niemand sollte dich dazu bringen, ein Leben zu führen, das dich nicht glücklich macht.“
„Deshalb hab ich mich getrennt.“
„Und das war gut so. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Ich habe sehr wohl bemerkt, wie du dich während dieser Beziehung verändert hast.“
„Verändert?“
„Du hast dich immer mehr zurückgezogen.“
Ich seufze, schaue auf die weiße Ebene. „Das hast du gemerkt?“
„Natürlich.“
„Du hast aber nie etwas gesagt.“
„Weil ich mich ungerne in andere Beziehungen einmische, aber … es tat weh, es mitanzusehen.“
Plötzlich kann ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten, mir verschwimmt die Sicht. Ich verliere den Kampf um meine Beherrschung. Ethan zieht mich an sich. Er umarmt mich fest, und ich schmiege mich an ihn.
„Deine Mum wollte mich überreden, dich hier auf der Tour zur Vernunft zu bringen. Aber ich werde den Teufel tun!“
Ich verberge mein Gesicht an seiner Schulter. „Ich habe es mir fast gedacht, sie mag Thomas sehr.“
Ethans Jacke dämpft meine Stimme, er versteht mich trotzdem. Er löst sich von mir, schiebt mich so weit von sich, dass er mich ansehen kann. Sachte hebt er mein Gesicht an. „Hör auf dein Gefühl“, raunt er.
Ich nicke zustimmend.
Liebevoll streicht er mir über die Wange und lächelt. „Aber jetzt müssen wir los.“
Ich blinzle, der Zauber des Augenblicks bricht entzwei. Es fühlt sich an wie ein seltsames Erwachen, als wären Ethan und ich in einer Seifenblase gewesen, fern von allem anderen.
Verdutzt bemerke ich den Nieselregen.
„Bleib am besten in meiner Spur, so lange wir den Weg noch nicht richtig sehen“, rät er mir, bevor wir losgehen.
Der Regen fällt sacht vom Himmel, feiner Staub, der vom Wind davongeweht wird. Die zuvor reinweiße Schneefläche bekommt Schattierungen. Felsen und Gras blitzen hervor.
Wir kommen gut voran, obwohl die Straße noch nicht sichtbar ist und wir über feuchtes, unebenes Gelände gehen. Ethan führt uns mit seinem Kompass stetig nach Südosten. Mir gefällt der Marsch. Durch die Bewegung spüre ich die Kälte nicht mehr.
Wir kommen an eine Steigung, die ich problemlos erklimme. Der Nieselregen ebbt sogar ab, nur vereinzelt sehe ich noch Nebelfelder. Oben auf der Anhöhe drehe ich mich langsam um mich selbst, um eine Rundumsicht zu haben.
Böen treiben die Wolken vor sich her, die Sonne setzt sich durch, beleuchtet einzelne Bezirke der Berglandschaft. Ich sehe schemenhaft einen Zipfel des Atlantiks und schaue nach rechts, wo der Hungry Hill sein muss, ein Berg, dessen Erwähnung immer eine Gänsehaut auslöst. Früher nannte man ihn den Zornigen Berg. Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen, kenne aber die Geschichten. Berg der zwei Gesichter nennen manche ihn. Er ist fast immer mit Dunst umgeben. Die einzelnen Nebelfelder scheinen durch den Wind sogar in seine Richtung zu wandern, als ziehe er sie magisch an. Vertreibt die Sonne aber jede Feuchtigkeit, erstrahlen seine kargen Hänge in einem goldenen Schein. Ich habe es auf Fotos gesehen.
„Da sind die ersten Gehöfte“, sagt Ethan und zeigt in Richtung Meer.
Wir nähern uns den Häusern, die vereinzelt in der Natur stehen. Fast wirkt die kleine Siedlung verlassen, doch ich rieche Torf, sehe Rauch aus einem der Schornsteine aufsteigen. Drei Schafe laufen blökend von rechts auf die mittlerweile wieder sichtbare Straße.
Ethan schaut ihnen hinterher. „Folgen wir ihnen. Sie sehen hungrig aus und wissen sicher den Weg zu ihrem Bauern.“
„Der bestimmt ein Auto hat.“
Wir eilen den Tieren nach und finden einen alten Mann, der seinen Geländewagen gerade mit Heu belädt.
„Dia dhuit!“, begrüßt Ethan den Mann auf Irisch.
Er grummelt einen Gruß zurück, schenkt uns ein schiefes Lächeln. „Kommt ihr von oben?“, fragte der Bauer stirnrunzelnd.
„Ja, wir sind oben mit dem Auto stehen geblieben, es war mir zu gefährlich, weiterzufahren.“
„Man sieht ja auch nix.“
„Eben.“
Er lehnt sich an sein Auto, streichelt einem der Schafe über den Kopf. Die Tiere klauen sich längst das Heu hinten von der Ladefläche, den Mann scheint es nicht zu stören. „Na, und nun? Der Schnee schmilzt doch. Wieso wandert ihr durch den Matsch?“
Ich schaue an uns herunter und schmunzle. Sowohl Ethans als auch meine Wanderstiefel starren vor Schmutz und Schlamm.
„Der Land Rover springt nicht mehr an.“
Der Bauer nickt. „Steigt ein, ich muss sowieso hoch und nach den anderen Schafen sehen. Die verkriechen sich bei dem Wetter immer und finden kein Futter mehr.“
Er lässt den drei Schafen etwas Heu in der Auffahrt und schwingt sich auf den Fahrersitz. Ich setze mich neben ihn. Ethan steigt auf die Ladefläche, weil das Auto keine Rücksitze mehr hat. Alles ist für den Transport umfunktioniert worden.
Mit dem Wagen sind wir in kurzer Zeit bei Ethans Land Rover, der zum Glück nur eine Starthilfe benötigt. Wir bedanken uns und schauen dem Bauern nach, wie er querfeldein fährt, um zu den Schafen zu gelangen.
„So, was machen wir jetzt?“, frage ich, als wir im Auto sitzen.
„Wie wäre es mit einem anständigen Frühstück?“
„Da sage ich nicht Nein.“
*
Einige Zeit später stehe ich ein wenig fassungslos vor einer alten Seilbahn, deren Gondel gerade das Meer überquert und im Nebel versinkt. Die rostigen Eisenverstrebungen geben ein knirschendes Geräusch von sich, als die Kabine schwankend im Dunst verschwindet.
„Es gibt in Irland eine Seilbahn?“
Ethan nickt begeistert. „Eine etwas betagte Seilbahn, aber sie führt über den Atlantik. Boote können hier nicht übersetzen. Die Strömungen sind einfach zu tückisch.“
Ein älterer Mann mit weißem Schopf nähert sich lächelnd. „Bei Flut hat man genau eine halbe Stunde Zeit, um an einer Stelle anzulegen. So hat man damals die Autos rübergebracht. Aber die jüngeren Leute wissen so was gar nicht mehr.“
Wir begrüßen uns, und der Mann stellt sich mir als der Verantwortliche der Seilbahnstation vor. Ethan scheint ihn bereits zu kennen.
„Du willst dein Mädchen also rüberbringen?“, fragt er Ethan.
Der schaut mich an. „Willst du?“
Ich schmunzle noch über die Wortwahl des Mannes, möchte das aber unbedingt durchziehen. „Natürlich!“, sage ich entschlossen. „Es ist sowieso eine Schande, dass ich nicht gewusst habe, dass wir Iren eine Seilbahn haben.“
Die beiden Männer lachen.
Wind zerrt an meinem Haar und an meiner Kleidung. Einige Wasservögel ruhen zwischen den Felsen, stören sich weder an uns noch an den Geräuschen der Bahn. Ich starre in den Nebel, warte auf die Gondel, die nach einigen Minuten zu uns zurückkehrt.
„Das Wetter ist nicht problematisch für die Anlage?“
„Ach nein“, antwortet mir der Seilbahnführer. „Frost und Schnee schadet ihr nicht. Nur bei Windstärke 8 könnte es die Gondel aus der Trosse heben.“
Ich sehe erschrocken zu ihm herüber.
Er zwinkert mir amüsiert zu. „Keine Sorge, das ist in fünfzig Jahren noch nie passiert.“
Mich beschleicht ein ungutes Gefühl, aber diesen Spaß will ich mir nicht entgehen lassen.
Ethan bezahlt die Überfahrt, und als der blau-weiße Stahlkasten bei uns hält, steigen wir in die Gondel. Innen riecht es etwas nach Schaf, einige Strohreste stecken noch zwischen den Ritzen der Holzbank. Wir setzen uns, und ich recke den Hals, um hinaussehen zu können.
„Eigentlich dürfen seit einiger Zeit keine Tiere mehr transportiert werden.“ Ethan zupft einen Strohhalm hervor. „Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht wahr?“
Ich schnaufe amüsiert auf. „Als ob wir Iren uns von solchen Paragrafen abhalten lassen, etwas zu tun, was uns wichtig erscheint.“
„Da hast du wohl recht.“
Es gibt einen Ruck, und die Seilbahn fährt an, steigt stetig in die Höhe.
Wir schweben nun über den wild tosenden Atlantik. Ich fühle mich wie eine Möwe, die das Meer überfliegt. Es ist wundervoll. Das sanfte Schaukeln der Gondel macht mir nichts aus. Noch verbirgt der Nebel die Insel, zu der wir fahren, ich sehe rein gar nichts.
Ich denke an die sagenumwobene Nebelinsel der Artussage, und mir huscht ein Lächeln übers Gesicht.
„An was denkst du gerade?“, fragt Ethan und sucht meinen Blick.
„Avalon.“
Er nickt, atmet tief durch und schweigt wieder.
Eine Bö rüttelt an unserer Kabine, ich muss mich festhalten. Auf einmal fällt mir ein Schild ins Auge.
Zum Schutz täglich lesen. Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es doch dich nicht treffen …
Ich frage mich, warum dieses Gebet hier vonnöten ist. Das Schwanken gewinnt an Bedeutung, mir wird mulmig zumute. Da tauchen die Felsen von Dursey Island wie eine Geistererscheinung auf. Der Nebel weicht zurück, die milchige Sonne gewinnt an Kraft, und ich kann die grünbraune Ebene bereits sehen.
Als wir langsam in Richtung Insel fahren, fliegen einige Austernfischer auf. Ihr hohes Geschrei hallt seltsam wider, fast wie ein Echo.
Die Seilbahn stoppt automatisch und überraschend sanft. Mit etwas wackligen Beinen steige ich aus, Ethan hilft mir aus der Gondel.
Ein Schild begrüßt uns. Es gibt hier kein Wifi, redet miteinander.
Wunderbar! Ich habe ein Smartphone, nutze es aber nur sporadisch. Mir macht ein fehlendes Netz also rein gar nichts aus. Und ich habe den besten Gesprächspartner bei mir, den es gibt.
Noch reden wir allerdings nicht miteinander. Wir lauschen dem Raunen des Atlantiks und genießen den zarten Wind, der uns umschmeichelt.
Ethan nimmt meine Hand. Zusammen gehen wir eine schmale Straße entlang, biegen aber bald in einen Trampelpfad ein, der uns direkt zu den Klippen führt, die wir nun entlangwandern.
„Vor fünfzig Jahren ging es hier wohl lebhafter zu. Nun gibt es auf Dursey Island drei Geisterdörfer und wahrscheinlich nur noch zwei Menschen, die dauerhaft hier leben“, sagt er und schaut auf die Wellen, die, wie von einer fremden Macht getrieben, an die Felsen schlagen.
Die Seilbahn, ja, selbst Irland liegt hinter uns. Hier herrscht völlige Einsamkeit. Die Welt steht einen Moment lang still.
Ethan sieht mich an, lässt meine Hand nicht los. Mir wird schwindelig unter seinem forschenden Blick. Das erste Mal kann ich nicht in ihm lesen, kann nicht erkennen, was in ihm vorgeht. Völlig unerwartet streicht er mir zärtlich eine Haarsträhne zurück und nähert sich mir. Ich fühle mich wie paralysiert. Instinktiv recke ich mich ihm entgegen. Hier auf Dursey Island gibt es auf einmal keine Barrieren, keine Angst mehr. Mein Herz rast, und mit einem Mal erwacht mit voller Macht ein Sehnen, das ich jahrelang verdrängt habe.
Was geschieht hier gerade?
Ethan zieht mich zu sich, beugt sich zu mir herunter … und küsst mich.
Die Berührung ist unschuldig und zart, wie eine leise Frage. Nichts anderes nehme ich wahr, nur ihn. Seine Wärme umhüllt mich. Ich spüre seine Bartstoppeln, wage kaum, mich zu bewegen. Seine Hand ruht noch immer schützend an meiner Wange.
Ich fühle mich überrumpelt, gleichzeitig jagt mein Puls vor Sehnsucht. Wie soll ich reagieren? Mein Verstand rebelliert, das Herz triumphiert.
Ethan löst sich, schaut mich an. In seinem Ausdruck lese ich Irritation und … Enttäuschung?
Ich habe den Kuss nicht wirklich erwidert, ihn nicht einmal umarmt! Das schockt mich mehr als diese abrupte Wandlung unserer Beziehung.
Ethan senkt den Kopf. „Ich wollte es wenigstens versuchen“, murmelt er.
Ich begreife, was das bedeutet, muss in Sekunden entscheiden, was nun geschehen soll.
Er weicht meinem Blick aus, starrt aufs Meer hinaus.
„Ethan …“
„Schon gut.“
„Entschuldige.“
„Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen, Sínead.“
„Nein, du verstehst nicht. Du hast mich nur … überrascht.“
Ich lasse nicht zu, dass eine Lücke zwischen uns entsteht. Meine Hand fährt durch sein kurzes, zerzaustes Haar, mein Zeigefinger berührt sein Kinn. „Was bedeutet das, Ethan?“
Ihm huscht ein Lächeln übers Gesicht. „Ist das nicht offensichtlich?“
Ich lächle verstehend. „Seit wann?“, flüstere ich.
„Schon immer.“
Diese zwei Worte lösen etwas in mir aus.
Ich lege ihm die Arme um den Hals. Seine Lippen sind so nah, dass ich seinen Atem spüre. Ethan lässt mich gewähren, rührt sich nicht und schaut mich abwartend an.
Ich brauche einen Augenblick, um wirklich sicher zu sein, dann komme ich ihm entgegen, überbrücke die Distanz und … küsse ihn.
Meine rechte Hand rutscht tiefer, legt sich auf sein Herz, das ich selbst durch die Winterjacke wild schlagen spüre. Mit der Linken ziehe ich ihn am Nacken näher an mich heran. Er seufzt leise, und in mir explodiert ein Feuer, das mich völlig aus der Bahn wirft. Ich fühle seine forschenden Lippen, erwidere endlich diesen besonderen Kuss.
Erst ein Regenguss schreckt uns auf.
Rasch streift Ethan mir meine Kapuze über, bevor er sich seine überstülpt.
Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Ethan stimmt ein, nimmt meine Hand und rennt mit mir über die felsige Ebene zurück zur Straße.
Der Regen löst den Schnee auf, verwandelt den Untergrund in schlammige Pfützen. Ich sehe, dass über dem Atlantik die Sonne scheint, nur über Dursey Island ist eine dunkelgraue Wolke. Der Wind lässt den Regen fast waagerecht in unsere Richtung fallen, meine Jeans ist binnen Sekunden durchnässt.
Ethan wendet sich nicht zur Seilbahnstation, sondern drängt in die entgegengesetzte Richtung. Einige Schafe stehen unbeugsam mitten auf dem Weg, ignorieren schlicht das schlechte Wetter. Wir kommen um eine Biegung, und ich sehe, wo Ethan mich hinzieht. Auf einem Hügel steht ein halb verfallenes Haus. Wir hasten die Anhöhe hoch. Eine Tür gibt es nicht mehr, wir können sofort ins Innere.
Vergilbte Gardinen hängen noch an zerborstenen Fenstern. Ein zerkratzter Tisch steht mitten im Raum, ansonsten existiert nichts mehr, nur noch ein Schutthaufen am anderen Ende des Gemäuers und die vage Andeutung eines weiteren Stockwerks, das aber schon vor Jahrzehnten eingebrochen sein muss. An verschiedenen Stellen tropft es. In einer verborgenen Ecke liegen zwei Schafe, die uns misstrauisch beäugen. Auch sie haben wohl Schutz gesucht.
Ich befühle die raue Steinwand. „Du hast von Geisterdörfern geredet“, sage ich, während ich meine Finger über die Wand gleiten lasse. „Hier ist wohl das erste Haus davon.“
„Nicht ganz. Weiter die Straße rauf gibt es zwei intakte Häuser, die sogar manchmal bewohnt sind.“
Zwei weitere Schafe trotten zu uns hinein und blöken uns an. Ich entdecke Heu. Nun ja, warum einen Unterstand bauen, wenn die Tiere auch in die alten Gemäuer flüchten können?
Ich setze mich auf den Tisch, der bedrohlich knarrt und sachte schwankt. Ethan grinst mich an, und ich weiß, was er denkt.
„Erinnerst du dich noch an Tante Maudes Kommode?“, fragt er mich schelmisch und kommt näher.
„Dieser Tisch ist stabil.“
„Und an Mums Lieblingsgartenstuhl?“
„Ethan, dem Stuhl fehlte eine der Hauptschrauben. Ich frage mich immer noch, wer mir den Streich gespielt hat. Und Tante Maudes Kommode war wurmstichig. Der Tisch hier ist noch sehr stabil. Komm, setz dich.“ Einladend klopfe ich auf das Holz und versuche die Balance zu halten, um zu vertuschen, dass der Tisch in Wirklichkeit kurz vor dem Zusammenbruch steht.
Mit einem Schulterzucken zieht sich Ethan auf die Holzplatte, während ich rasch aufspringe. Mit einem lauten Krachen, das die armen Schafe in den Regen hinaustreibt, bricht der alte Tisch auseinander. Ethan sitzt mit zusammengepressten Lippen auf dem Boden, der nun übersäht ist von zerborstenen Teilen des Tisches, und ich breche in lautes Gelächter aus.
„Das war fies, Sínead“, grummelt er.
„Ich warte seit Jahren darauf, mich für den Stuhl zu rächen.“
Er prustet belustigt auf, und ich helfe ihm hoch, ziehe ihn mit Schwung aus den Holzsplittern.
„Da war ich gerade zehn.“
„Na und? So was verjährt nicht.“
„Okay, das lasse ich gelten. Trotzdem bist du manchmal echt ein kleiner Kobold.“
Ich schnappe nach Luft, um zu protestieren.
„Ein sehr hübscher Kobold! Eher eine freche Sídhe“, setzt er rasch nach.
Die Erwähnung irischer Feen stimmt mich milde. Ich schenke Ethan ein Lächeln, und er legt seinen Arm um meine Schultern. Zusammen lauschen wir dem Rauschen des Regens. Mein kleiner Streich ist verziehen.
Die Schafe kehren zurück und drängeln sich wieder an uns vorbei in ihre Ecke.
Die Aussicht hier ist wunderbar. Sturmböen peitschen das Meer an die Klippen. Gischt wirbelt durch die Luft, die Feuchtigkeit verwandelt alles in durchscheinenden Dunst. Die Hügel schimmern stellenweise wieder in Grüntönen.
„Sag was“, raunt Ethan.
Das erste Mal fühle ich mich in seiner Gegenwart unsicher, denn ich weiß, dass er über den Kuss reden möchte. Meine Gefühle fahren Achterbahn, wenn ich daran denke. Sehnsucht mischt sich mit Angst, ihn womöglich als Freund zu verlieren. Ich sollte ihm genau das sagen, bringe aber kein Wort über die Lippen.
Er spürt meinen Zwiespalt. „Ist okay, wir müssen nicht.“
„Ich möchte es nicht kaputtreden. Das habe ich mit Thomas zur Genüge gemacht“, sage ich leise.
Er zieht mich an seine Brust, und ich lehne meinen Kopf gegen seine Schulter. „Sag mir nur, ob ich mir Hoffnungen machen darf“, flüstert er. „Ich habe es zu lange verdrängt, habe viel zu lange gewartet. Aber deine Trennung von Thomas … Es fühlt sich für mich wie eine Chance an. Aber ich will nicht gegen Windmühlen rennen oder etwas zwischen uns zerstören.“
Ich hebe den Kopf, sehe zu ihm auf. Worte sind hier fehl am Platz, auch wenn er genau diese erwartet. Lieber möchte ich ihn noch einmal küssen.
Unsere Lippen berühren sich, und das ist ihm Antwort genug.