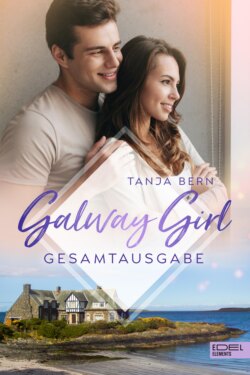Читать книгу Galway Girl Gesamtausgabe - Tanja Bern - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
- 7 -
ОглавлениеIch erwache durch eine sanfte Berührung. Blinzelnd öffne ich die Augen. Ethan ist über mich gebeugt und lächelt mich versonnen an. Nie zuvor hat er mich so angesehen. Oder hat er es nur vor mir verborgen?
Mein Puls erhöht sich.
„Hast du mich wachgeküsst?“, wispere ich mit heiserer Stimme.
„Wie Dornröschen.“
„Kannst du das wiederholen? Ich fühle mich noch gar nicht wach.“
Ethan lächelt und küsst mich erneut, sachte, als wäre ich wirklich eine Prinzessin.
Nie zuvor hat sich ein Kuss so wundervoll angefühlt. Auf Dursey Island war ich noch so unsicher, aber jetzt erscheint es mir perfekt.
Ich umfange ihn mit meinen Armen, sein Shirt ist hochgerutscht, und ich fühle nackte Haut an meinen Fingern. In mir erwacht ein Feuer, das sich durch alle Sinne brennt. Für einen Moment fühle ich mich wie in einem Rausch.
Unser Kuss vertieft sich. Ich vergesse meine Furcht, ziehe Ethan nah zu mir heran. Die Empfindung, die ich schon beim Einschlafen hatte, bricht mit aller Kraft aus mir heraus, eine Emotion, die ich jahrelang verdrängt habe, mit dem Gefühl der Freundschaft übertüncht. Sie kämpft sich an die Oberfläche und lässt mich atemlos zurück. Ich fühle mich, als sei ein Bann gebrochen, eine Mauer eingestürzt.
Als sich Ethan von mir löst, spüre ich einen kühlen Luftzug zwischen uns. Ich hebe die Hand, streichle über seine Wange, fahre durch sein Haar.
Ich will nicht, dass er aufhört, aber dann erkenne ich, dass Ethan ein bisschen aufgelöst wirkt.
„Ist alles okay, Ethan?“
Er legt sich zurück auf seine Bettseite, zieht mich aber gleichzeitig mit sich, sodass ich auf seiner Brust zu liegen komme.
„Das hier ist wahr, oder?“, fragt er leise. „Ich habe Jahre auf so einen Moment gewartet, und jetzt kommt es mir vor wie ein Traum.“ Seine Hände umfangen mein Gesicht. „Sínead, du hast am Healy Pass gesagt, du könntest es nicht ertragen, mich zu verlieren.“
„Ja, und das meine ich so.“
Er schluckt schwer. „Mir geht es auch so. Und dieses Gefühl, … es ist so stark, dass ich den Gedanken nicht ertrage, jemals ohne dich zu sein.“ Ethan presst die Lippen aufeinander. „Wir … wir zerstören es hiermit nicht, oder?“
Das erste Mal sehe ich Angst in seinem Blick. Er ist sonst so furchtlos, und dieser Ausdruck lässt mich die Fassung verlieren. Meine Sicht verschwimmt vor Tränen, und ich wische mir rasch über die Augen. Dennoch pulsiert eine Gewissheit in mir.
„Ethan … wir sind uns so nah. Wenn wir es jetzt nicht versuchen, werden wir es immer bereuen.“
Er atmet erleichtert aus, umarmt mich fester. Ich erwidere die Geste und lehne meinen Kopf an seine Schulter.
„Aber überstürzen sollten wir es nicht“, flüstere ich.
„Dem stimme ich zu.“
Ich schließe die Augen und lausche seinem Herzschlag, fühle mich so geborgen.
„Wie fühlst du dich körperlich?“, fragt er nach einer Weile.
„Eigentlich gut, wieso?“ Ich will Zuversicht suggerieren, weil ich mittlerweile einen gewissen Ehrgeiz verspüre, was Ethans Tour angeht. Aber ich spüre jeden Knochen im Leib, und mein Lächeln scheint etwas gequält zu sein, denn Ethan lacht leise.
„Schaffst du es heute, noch einen Berg zu besteigen? Ich habe Wanderstöcke für dich. Das wird es dir erleichtern.“
Nach dem üppigen Frühstück laufen wir durch das Tal, das in Tannenwälder eingebettet ist. Die Luft ist neblig und nicht optimal für eine Besteigung des Lugnaquilla. Wagen wollen wir es trotzdem, weil es laut Wetterbericht am Nachmittag aufklart.
Als wir an dem Weg ankommen, der uns bergauf führen wird, nimmt Ethan den Rucksack ab und holt zwei Stöcke hervor, die er wie Teleskopstile auseinanderschraubt. Ich schnalle mir die Schlaufen ums Handgelenk, Ethan legt den Rucksack wieder an. Er selbst benutzt keine Hilfe.
Mit den Wanderstöcken fällt mir der Aufstieg viel leichter. Jedoch wechselt das Wetter wieder, je höher wir kommen. Ein eisiger Wind weht hier oben. Vereinzelte Schneeflocken werden von den Böen umhergewirbelt, und einige Schneeverwehungen sind noch nicht geschmolzen. Der Nebel will nicht so richtig weichen, obwohl manchmal sogar die Sonne hervorschaut. Sie wird aber immer wieder von Wolken verdeckt.
Ethan beäugt den Nebel skeptisch, ich hingegen finde ihn mystisch und will unbedingt weitergehen. Ich ignoriere das Wetter, setze Fuß um Fuß auf den felsigen Boden, kämpfe mich vorwärts und bin überrascht, wie gut ich vorankomme. Meine Muskeln schmerzen nur gering, seit sie sich durch die Bewegung erwärmt haben. So wandern wir eine Weile, bis zumindest der Himmel wieder sichtbar ist.
Ethan bleibt stehen, und ich remple ihn fast an, weil ich völlig in Gedanken war.
„Das gefällt mir überhaupt nicht“, sagt er laut, um gegen den Wind anzukommen.
Ich brauche einen Augenblick, um zu Atem zu kommen, bevor ich antworte. „Was denn? Ich fühle mich grad wie in Herr der Ringe bei der Besteigung des Caradhras und finde das total schön.“
Ethan schmunzelt. „Dann hoffen wir mal, dass die Steinriesen nicht anfangen, mit Felsbrocken zu werfen.“ Er fasst mich sanft an die Schultern und dreht mich nach Westen. „Aber ich meine das da.“
Eine dunkelgraue Front kommt am Himmel auf uns zu. „Ist das ein Sturm?“
„Es sieht nach einem Gewitter aus, wir sollten umkehren.“
Ich vertraue ihm, er kann solche Wetterereignisse viel besser lesen als ich. Schon als Kind faszinierten ihn Wolkenformationen und was sie auslösen.
Also machen wir kehrt, auch wenn mich das innerlich fuchst, denn ich wäre gerne bis zum Gipfelplateau gekommen.
Wind heult auf und pfeift uns um die Ohren. Schneeregen lässt den Weg rutschiger werden. Ich stemme meine Stöcke fest in den Untergrund.
Ein langgezogener Donner grollt über den Berg, der noch immer in Dunst gefangen ist.
Wir beschleunigen unsere Wanderung. In mir keimt Furcht auf, die ich Ethan verschweige. So schnell es der Pfad zulässt, steigen wir vom Berg, innerlich bin ich total aufgewühlt.
Ein Blitz blendet mich plötzlich, und ich erschrecke mich so sehr, dass ich einen der Stöcke verreiße und stolpere. Die Metallspitze rutscht vom Untergrund ab, ich verliere meine Balance. Mit einem Aufschrei falle ich mit dem Steißbein auf glattes Felsgestein. Den Schmerz nehme ich nur vage wahr, denn ich rutsche weiter, über das schlammige Heidegras, schlage mir das Knie an und sehe einen Abgrund auf mich zukommen.
Ethans Ruf hallt zu mir. Ich kralle meine Hände ins Erdreich, aber die verdammten Stöcke sind mir im Weg. Völlig schockiert registriere ich, dass ich über die Böschung schlittere und den Boden unter den Füßen verliere.
Mein Fall wird abrupt aufgehalten, ein Ruck durchfährt mich und kugelt mir fast den Arm aus.
„Greif nach dem Stock!“, ruft Ethan.
Er hat den Wanderstock gepackt, und ein Zittern durchfährt meinen Körper, weil ich sehe, dass mich nur noch die Schlaufe hält, die um mein Handgelenk geschlungen ist.
„Sínead, der Stock!“, wiederholt Ethan unnachgiebig.
Mit der freien Hand versuche ich den Griff zu erreichen. Mich durchflutet pure Erleichterung, als ich es schaffe und Ethan mich zu sich hochzieht. Mein Körper bebt, und ich habe das Gefühl, mir springt das Herz aus der Brust. Ethan zieht mich vom Abgrund weg und in seine Arme.
Einen Moment hält er mich so, dann fasst er mich an den Oberarmen und schiebt mich so weit von sich, dass er mir in die Augen sehen kann. „Ist alles in Ordnung? Hast du dich verletzt?“
„Alles gut, ich hab mir nur das Knie angeschlagen.“ Meine Stimme zittert.
„Das schaue ich mir nachher an. Jetzt müssen wir erst mal hier weg. Kannst du laufen?“
Das Gewitter erinnert mich daran, dass ich laufen muss, deshalb nicke ich tapfer und richte mich auf. Mein Knie schmerzt zwar, aber nicht so sehr, dass ich es nicht bewegen könnte. Ich richte meine Stöcke und versuche, Ethans Schritten genau zu folgen. Er kann offensichtlich besser einschätzen, wo er hintreten kann, ohne auszurutschen.
Wir gehen stetig bergab, aber das Gewitter nähert sich. Der Regen verebbt, sogar der Nebel verschwindet von den Berghängen, als treibe der Wind alles in Richtung Tal, das kaum noch auszumachen ist. Ethan beschleunigt den Abstieg, und ich muss kämpfen, um mithalten zu können. Er dreht sich immer wieder zu mir, um sich zu vergewissern, dass ich noch hinter ihm bin.
Ich realisiere, dass Ethan den Tannenwald ansteuert. „Ist der Wald eine gute Idee, Ethan?“
„Zumindest besser als freie Fläche oder ein einzelner Baum. Vertrau mir.“
Ängstlich sehe ich mich um. Ein Blitz zuckt über den immer düsterer werdenden Himmel. Ich zähle die Sekunden bis zum Donner, der für mein Empfinden viel zu rasch kommt.
Wir tauchen zwischen die Tannen, und prompt fühle ich mich sicherer, obwohl das ein Trugschluss ist. Ethan sieht sich sehr genau um, er geht weiter, scheint etwas zu suchen, denn er ignoriert den Trampelpfad, schwenkt mal nach rechts und wieder nach links. Wir kommen an einen Hain, wo hauptsächlich jüngere Bäume stehen, die von den alten Riesen umrahmt werden.
„Hier! Die Stelle habe ich gesucht.“
Er führt mich in das Gehölz, legt den Rucksack ab und öffnet ihn. Ohne Rücksicht auf den Inhalt räumt er einiges aus, lässt seine Habseligkeiten auf dem Waldboden liegen und zerrt eine flache Tasche hervor. In Sekunden hat er den Reißverschluss geöffnet, den Inhalt hervorgeholt und in der Luft ausgeschüttelt. Ich staune, als ich erkenne, dass es ein niedriges Zelt ist.
„Rasch, geh rein, ich mache die Heringe fest, damit es nicht wegfliegt.“ Ich klaube seine Sachen auf, stopfe sie in seinen Rucksack zurück und krabble damit ins Zelt, das nur so hoch ist, dass man sitzen kann, ohne mit dem Kopf oben anzustoßen.
Der nächste Donner lässt mich zusammenzucken. „Ethan, beeil dich!“
Durch die helle Zeltplane sehe ich die Blitze und knete nervös meine Hände. Als Ethan zu mir ins Zelt kommt, atme ich erleichtert auf. Er zieht den Reißverschluss zu und sperrt das Unwetter aus.
Wir hocken nah beieinander auf dem dünnen Zeltboden, der trotz des durchnässten Bodens darunter keine Feuchtigkeit zu uns durchlässt.
„In diesem Fall ist das die sicherste Lösung“, erklärt Ethan und räumt seinen Rucksack auf. „Ein Felsüberhang oder eine freie Fläche sind ein zu starker Angriffspunkt. Hier in dem niedrigen Hain ist es am Unwahrscheinlichsten, dass ein Blitz einschlägt, obwohl ich mir im Wald nie sicher bin. Setz dich deshalb auf deinen Rucksack. Es ist gut, Bodenkontakt zu vermeiden.“
Ich befolge, was er sagt, Ethan schließt seinen Rucksack und verfährt ebenso.
Dann greift er nach meiner Hand. „Verdammter Wetterbericht!“, schimpft er leise.
„Der Wind hat gedreht, oder?“
„Ja.“ Er schüttelt missmutig den Kopf. „Ich hab die Veränderung in den Wolken wegen diesem scheiß Nebel nicht gesehen. Wir hätten viel eher umkehren müssen.“
„Jetzt gib dir doch nicht die Schuld am Wetter. Außerdem wollte ich unbedingt zum Gipfelplateau, und der Nebel hat alles verschleiert. Sieh es positiv. Wir prüfen direkt, ob deine Tour auch wirklich abenteuerlich ist. Na ja, bisher sieht es doch ganz gut aus, oder?“
Ethan schnauft amüsiert, doch die Heiterkeit hält nicht an. „Ich habe dich in Gefahr gebracht.“
„Das sehe ich nicht so. Weißt du, wie ich das empfinde?“
Er sieht mich mit ernstem Gesicht an.
„Du hast uns aus den Schwierigkeiten rausgeboxt.“
„Es wäre besser gewesen, wir wären gar nicht erst hineingeraten. Ich bin ein toller Fremdenführer.“
„Ach, jetzt komm schon. Dies ist eine Abenteuertour.“
Ich stupse ihn sachte an, um ihn aufzuheitern, doch er beißt nicht an.
„Zeig mir lieber dein Knie.“
Ich hab für die Wanderung ebenfalls eine Regenhose angezogen und öffne nun den Reißverschluss am Knöchel, der es ermöglicht, die Hose von unten aufzuziehen. Vorsichtig schiebe ich den Stoff übers Knie. Eine üble Schramme verunstaltet die Haut, das Gewebe ist etwas geschwollen und bläulich verfärbt. Ethan holt eine kleine Notfallkiste aus seinem Rucksack, säubert die Wunde und klebt ein großes Pflaster auf die Verletzung. „Das müsste eigentlich gekühlt werden“, murmelt er.
„Jetzt sag mir nicht, du hast in deiner Zaubertasche auch noch Kühlpacks?“
„Nein, leider nicht.“ Er packt das Kistchen zurück. „Aber ein Mini-Gefrierschrank könnte noch hineinpassen, oder?“ Mit einem Schmunzeln und hochgezogenen Augenbrauen sieht er mich an.
Ich lache leise auf, doch mir bleibt der fröhliche Laut förmlich im Hals stecken. Denn von draußen ertönt ein klagender Schrei, den ich nicht einordnen kann.
„Verdammt, das hört sich wie ein Lamm an“, sagt Ethan.
„Um diese Jahreszeit?“, frage ich ungläubig.
„Viele werden schon im Winter geboren, obwohl es ungewöhnlich ist für Tiere, die ganzjährig draußen sind.“
„Vielleicht ist bei dem Wetter ein Unterstand zerstört worden?“
„Höchstens weiter unten in Richtung Tal. Eigentlich sind die Schafe im Winter ungerne hier oben.“
„Woher weißt du das?“
„Auf meinen Touren treffe ich oft Schäfer, und sie erzählen wirklich gerne von ihrer Arbeit. Die Touristen lieben solche Begegnungen.“
„Arrangierst du da manchmal was?“
„Ja, ab und zu schon. Aber ich lasse es wie einen Zufall aussehen.“ Er grinst schelmisch.
Wieder dieser ängstliche Ruf, und ich höre kein Mutterschaf antworten. Wir sehen uns nervös an.
Das Gewitter ist noch hörbar, aber nicht mehr so nah. Offensichtlich ist es weitergezogen.
„Komm, sehen wir nach, Ethan.“
„Ja, es würde uns ja doch keine Ruhe lassen. Außerdem glaube ich, weiß ich, wessen Schaf das ist. Der Schäfer wohnt unten in Cullentragh, am Fuß der Berge.“
Ich ziehe den Reißverschluss auf und registriere, dass es wieder regnet. Trotzdem gehen wir auf die Suche nach dem kleinen Schaf. Es blökt jetzt dauerhaft und weist uns so die Richtung. Allerdings ist es nicht so nah wie gedacht. Der Berg hat seinen Ruf weit getragen, als wolle er uns zu Hilfe holen. Immer noch grollt entfernt der Donner des Wintergewitters, und auch der Regen wird wieder stärker. Andere Schafe sehen wir nicht. Ob das Kleine in Panik ausgerissen und herumgeirrt ist?
Wieder hören wir es blöken, und diesmal sieht Ethan durch den Regen eine Bewegung etwas weiter unten am Hang. Ich humple hinter ihm her, versuche zu verbergen, wie sehr mein Knie schmerzt.
Wir finden das arme Ding in einem Schlammloch. Panisch versucht es zu entkommen, aber es ist noch sehr jung und wirkt schon sehr geschwächt. Mit vereinten Kräften schaffen wir es, das Lamm zu befreien. Es ist so leicht, dass ich es problemlos in den Armen halten kann. Es zittert und wehrt sich nicht, als ich es an mich drücke. Völlig erschöpft lässt es das Köpfchen sinken.
„Mir scheint, es ist etwas zu früh geboren, und der Schäfer hat es vielleicht noch gar nicht mitbekommen“, mutmaße ich. „Wo ist nur das Muttertier? Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.“
„Manchmal passiert das. Nehmen wir es erstmal mit. Hier draußen erfriert es. Soll ich es tragen?“
„Ja, das wäre gut.“
Meinem Knie möchte ich kein zusätzliches Gewicht zumuten, zumal wir wieder ein ordentliches Stück bergauf müssen. Ethan ist ja doch ausdauernder.
Bei jedem Schritt sticht es leicht im Knie, und ich beiße die Zähne zusammen, weil ich es vor Ethan nicht zugeben möchte. Er sorgt sich sonst nur wieder.
Als wir zurück im Zelt sind, strecke ich vorsichtig das Bein aus. Ich verziehe schmerzhaft das Gesicht. Ethan bemerkt es, sagt aber nichts dazu.
Er reicht mir das Lamm, das wir in eine unserer Decken einhüllen. Es lehnt sich schwer an mich und gibt ein leises Rufen von sich. Ich streichle sein Köpfchen und rubble es ein wenig trocken. Nach einer Weile strampelt es herum und legt sich in eine bequemere Lage.
„Hoffentlich hat es nicht zu großen Hunger.“
„Daran können wir nichts ändern. Lass uns noch ein bisschen ausruhen. Dann gehen wir zurück ins Tal, Richtung Cullentragh.“
Sanft kraule ich dem Kleinen die Ohren. „Wir bringen dich nach Hause“, flüstere ich dem Lämmchen zu.
Das Kleine wird jedoch zunehmend unruhig, ist nach einiger Zeit kaum mehr zu halten. Es ruft nach seiner Mutter und strampelt wild herum. Ethan und ich entschließen uns, aufzubrechen und den Schäfer zu suchen, denn wir wissen nicht, wie lange das Kleine unversorgt ist.
Erstaunt sehe ich zu, wie Ethan unser Notzelt faltet und binnen Sekunden verstaut.
„Das muss aber auch gelernt sein“, bemerke ich.
Er zuckt mit den Schultern. „Man muss nur wissen, wie, dann ist es ganz leicht.“
Ich denke an einen Urlaub mit Thomas zurück, wo wir mit einer dieser Strandmuscheln gekämpft haben. Schlussendlich hat Thomas es aufgegeben und die Muschel wütend in den Mülleimer geknüllt. Selbst das erwies sich als schwierig, weil die biegsamen Gestänge sich nicht der Form des Mülleimers fügten.
Ethan schnallt sich den Rucksack um und nimmt mir das Lamm ab. Er hat es viel besser im Griff als ich, aber es blökt nun ohne Unterlass. Sein Rufen lässt mich nervös werden. Zumindest hat der Regen mittlerweile aufgehört.
Halte durch!
„Weißt du, was das für ein Schaf ist?“
„Von der Wolle her könnte es ein Crossbred sein.“ Ethan lächelt mich an. „Also kein Osterlamm, falls du das wissen willst.“
„Ein Wollschaf“, murmle ich erleichtert. Die Vorstellung, das Kleine könnte als Braten enden, hätte ich furchtbar gefunden.
Über eine Stunde gehen wir bergab, mit einem Lamm, das kaum mehr zu bändigen ist und verzweifelt nach seiner Mutter ruft. Ethan muss es fest an sich pressen. Mein verletztes Knie rebelliert gegen die zügige Wanderung.
„Ich frage mich, ob es uns zu seiner Mutter führen könnte.“
Ethan schüttelt den Kopf. „Nicht in dem Alter. Es würde fortlaufen, und wahrscheinlich könnten wir ihm nicht folgen. Wir ständen wieder am Anfang, wo wir es aus dem Schlammloch geholt haben.“
„Das Kleine tut mir nur so leid“, sage ich leise.
„Wir helfen ihm ja und … Da, siehst du den Hof? Das ist der Bauer, den ich meine.“
Wir kommen auf den Hof. Eine ältere Frau bemerkt uns. Sie hält in ihrer Arbeit inne und kommt auf uns zu.
„Was ist passiert?“, fragt sie erstaunt, als sie das strampelnde Lamm bemerkt.
„Wir haben es aus einem Schlammloch befreit“, antwortet Ethan. „Ein Muttertier war nicht zu sehen.“
„Gütiger Gott, es muss das Lamm von Christy sein!“
„Christy?“, frage ich verwundert.
„Kommt erstmal rein! Ihr seid ja völlig durchnässt.“
„Das Lamm …?“
„Nehmt es mit. Ich habe für den Notfall immer etwas Schafsmilch eingefroren.“
Die Dielen knarren, als wir ins warme Hausinnere treten. Ich seufze ob der angenehmen Temperatur und ziehe direkt meine Jacke aus.
„Lassen Sie es nicht los, junger Mann!“, sagt die Frau und eilt davon.
Wir folgen ihr in eine altertümliche Landhausküche, wo sie rasch die gefrorene Milch aus dem Gefrierfach holt und sie in einem Topf auftaut.
Unser kleines Lamm liegt nun ruhig in Ethans Armen, es ist völlig geschwächt, ruft aber immer noch leise.
„Ist ja gut, Kleines“, spreche ich dem Tier zu und streichle ihm sanft über den Kopf.
Die Bäuerin füllt die Milch nun in eine Flasche und schraubt einen Sauger auf. Es dauert einen Moment, bis das Lamm versteht, was zu tun ist, dann trinkt es gierig die Milch. Ich schaue völlig fasziniert zu.
Ein Mann betritt die Küche und schaut uns verwirrt an. Er wirkt verschlafen. Das graue Haar steht an einer Seite ab, und er reibt sich über die Augen. Sein Arm liegt in einem Gipsverband.
„Was ist denn hier los?“
„Die beiden haben wohl Christys Lamm gefunden“, erklärt die Bäuerin.
Nun scheint er hellwach zu sein. „Wo habt ihr es gefunden?“
„Unterhalb des Arts Lough.“
„So weit oben …“ Er setzt sich auf die Eckbank und beäugt Ethan. „Ich kenn dich doch.“
„Ich bin Ethan Clarke, der Touristenführer. Das ist meine Freundin Sínead.“ Ethan wendet sich mir zu. „Das sind die Dohertys“, stellt er mir die beiden vor.
„Brenda und Declan, um genau zu sein“, sagt die Bäuerin mit einem Lächeln und nimmt dem Kleinen geschickt die leere Flasche aus dem Mäulchen. Es schmatzt laut.
„Ich wusste, dass Christy trächtig ist, eigentlich viel zu früh. Aber mir ist der verdammte Bock ausgebüchst. Na ja, ihr könnt euch vorstellen, was er getrieben hat. Christy ist mein bestes Wollschaf und furchtbar eigensinnig. Wenn die Geburt naht, zieht sie sich oft in die Berge zurück. So lange es warm genug ist, kann mir das egal sein. Sie kümmert sich gut um ihre Lämmer, und ich finde sie für gewöhnlich, um nach dem Rechten zu sehen.“
„Und diesmal nicht?“
„Doch, ich hab sie gefunden, kam aber nicht an sie heran.“
„Außerdem ist der Trottel ausgerutscht und hat sich den Arm gebrochen“, wirft Brenda ein. „Und Christy musste vorerst oben bleiben.“
Declan rollt mit den Augen und zieht eine Grimasse, widerspricht seiner Frau aber nicht. „Das Lamm ist nicht neu geboren. Eine Woche ist es mindestens alt.“
„Aber wo ist Christy?“, fragt Brenda besorgt.
„Das gilt es herauszufinden.“ Declan sieht zu seiner Frau. „Und diesmal hältst du mich nicht zurück wegen des blöden Arms. Ich bin ja jetzt nicht mehr allein.“ Er sucht Ethans Blick. „Du kommst doch noch mal mit hoch, oder?“
„Ja, natürlich. Sínead, aber du bleib besser hier und schone dein Knie.“
„Bist du hingefallen, Kind?“, fragt Brenda besorgt.
„Ist nicht so schlimm“, beschwichtige ich.
„Sie ist bei dem Gewitter fast einen Abhang runtergefallen und hat sich übel das Knie verletzt.“ Ich will protestieren, es herunterspielen, aber Ethan sieht mich scharf an. „Du solltest es kühlen.“
„Kein Problem, ich kümmere mich darum, junger Mann“, sagt Brenda entschlossen. „Deine Frau ist bei mir in den besten Händen.“
Wir sehen sie verdutzt an, aber keiner von uns widerspricht ihr. Ich sehe, wie Ethan ein Lächeln übers Gesicht huscht. Er beugt sich zu mir und haucht mir einen Kuss auf die Lippen. „Ruh dich aus.“
„Und du pass auf dich auf.“
Ich werde umsorgt wie eine Prinzessin, Brenda lässt nichts anderes zu. Mein Bein ist hochgelagert, auf dem Knie liegt ein Tuch mit Eisbeuteln. Sie hat mir Tee aufgebrüht und mich mit selbstgebackenem Brot und Marmelade versorgt. Ich gebe zu, ein bisschen genieße ich Brendas Fürsorge.
Das Lamm ist in der Zwischenzeit wie umgewandelt. Es läuft erst neugierig durch die Küche und legt sich schließlich auf den Teppich nahe der Heizung.
Brenda setzt sich zu mir, gießt sich ebenfalls einen Tee ein und füllt drei Teelöffel Sahne hinein.
„Und jetzt erzähl doch mal, wieso ihr im Dezember auf die Berge wolltet.“
„Ethan ist Reiseleiter, und wir proben eine neue Tour, die seine Chefin anbieten möchte.“
„Stimmt, ich glaube, dein Ethan hat mit meinem Mann telefoniert. Er soll den Urlaubern ein bisschen von dem Leben hier erzählen. Im Gegenzug bringt Ethan die Leute alle hierher, wo sie eine gute Mahlzeit bekommen. Damit verdienen wir uns im Sommer ein kleines Zubrot. Die Zeiten sind nicht immer einfach. Wir werden nicht jünger, und Declan besteht auf Wollschafe. Er hängt unglaublich an den Tieren.“ Sie seufzt. „Obwohl wir mit dem Verkauf von Fleisch viel mehr verdienen würden.“
„Wissen Sie was? Halten Sie daran fest, sonst gibt es bald keine irische Wolle mehr. Ich werde in Galway mit meiner Mum reden. Wir haben ein Souvenirgeschäft und bieten auch Merinowolle an. Eigentlich erwerben wir es von einem kleinen Bauern aus Kerry, aber wir könnten unser Angebot erweitern. Es sind Crossbredschafe, oder?“
„Das sind sie. Ich könnte euch auch Pullover verkaufen. Die fertige ich manchmal selbst.“
„Das klingt gut. Ich rede zu Hause mal mit meiner Mum.“
Brenda lächelt, Hoffnung schimmert in ihrem Blick. Es ist sicher nicht einfach, hier in der Einsamkeit zu überleben. Ich sehe aus dem Fenster, schaue auf die wunderschöne Landschaft und verstehe, wieso sie sich dennoch für ein Leben in den Wicklow Mountains entschieden haben.
Mich überkommt Müdigkeit. Ich lehne mich zurück, bette meinen Kopf auf die weichen Sofapolster. Meine Augen fallen zu, und ich kämpfe nicht dagegen an. Hier bei Brenda fühle ich mich wohl. Ich höre, wie sie aufsteht. Ihre Schritte lassen das Dielenholz leise knarzen. Sie räumt ein wenig auf, Geschirr klappert leise.
Ich schrecke auf, als Männerlachen durch das Haus hallt.
„Brenda? Wir haben das kleine Mistvieh“, ruft Declan.
„Geht es Christy gut?“
„Wie man’s nimmt. Sie steckte zwischen zwei Felsen fest, hat ein verletztes Bein, aber das wird schon wieder.“
Ich schaue mich suchend nach Ethan um. Wo ist er?
Draußen blökt mit tiefer Stimme ein Schaf, und der Ruf zeigt Wirkung. Das Lamm kommt ungelenk auf und stakst in Richtung Tür. Ich folge ihm.
Ethan hält das Muttertier an einem Strick mit eiserner Hand fest. Christy steht nur auf drei Beinen und beschnuppert ihr Kind ausgiebig.
„Ich ruf mal den Tierarzt an. Vielleicht kann er heute noch rauskommen“, sagt Brenda und geht zurück ins Haus.
Declan nimmt Ethan den Strick ab. Christy drängt zur Herde, die sich weiter hinten, eingesäumt von Trockenmauern, in einen Unterstand drängt. „Ja, ja, ich bring dich zum Futter.“
Ethan sieht aus, als hätte er einen harten Kampf ausgefochten. Seine Kleidung starrt vor Schmutz, selbst im zerzausten Haar sehe ich Schlammspritzer.
„Du bist jetzt also ein Schafheld?“, frage ich ihn amüsiert.
„Adventure Man war im Einsatz“, kontert er. „Declan hat mir angeboten, dass wir die Nacht über hierbleiben können. Ich denke, das wäre das Beste, es dämmert schon, und in kaum einer Stunde wird es stockdunkel sein.“
Seine Nachricht erleichtert mich, und er scheint es mir anzusehen. „Wie geht es deinem Knie?“
„Besser.“
„Wirklich?“
„Ja, das Kühlen hat gutgetan. Wir können morgen weitergehen. Du willst sicher nach Glendalough, oder?“
Ethan nickt. „Für die meisten Touristen ist das ein Muss, wenn sie in den Wicklow Mountains sind.“
Ein Bild blitzt in meinen Erinnerungen auf. Ich sehe mich vor dem hohen Rundturm stehen, während Krähen die grauen Mauern umkreisen.
„Ethan, erinnerst du dich noch an diesen Ausflug nach Glendalough?“
Er überlegt kurz. „Ja, wie alt waren wir da? Acht?“
„Genau weiß ich es nicht mehr, aber ich erinnere mich daran.“ Ich suche seinen Blick. „Ich freue mich, dass ich diesen Ort wiedersehe. Der Tag damals war wirklich schön.“
Wir setzen uns auf die Bank vor dem Haus, beobachten, wie Declan die beiden Schafe zur Herde führt.
Ich wende mich Ethan zu, betrachte sein Profil. Auf seinen Lippen liegt ein fast unmerkliches Lächeln. Er ist völlig entspannt, trotz der ganzen Aufregung. Sein Blick gleitet über die Tannenwälder, hoch in die Berge. Mit einem leisen Laut, der mir sagt, dass er sich wohlfühlt, lehnt er seinen Kopf gegen die Hauswand, schließt die Augen und genießt die letzten Sonnenstrahlen, die sich durch die Wolken kämpfen.
Ich weiß, dass er sich in der Stadt oft unwohl fühlt. Und dass das hier seine Welt ist, das erkenne ich deutlich.
Mich durchströmen unterschiedlichste Gefühle, und alle laufen auf eines hinaus: Er gehört zu mir. Nie zuvor habe ich es klarer gesehen. Ich begreife, dass ich für ihn alles aufgeben würde. Mein Stadtleben, die Bequemlichkeit, die Nähe zu meiner Familie. Es ist eine Erkenntnis, die mich völlig überrascht, denn bei Thomas habe ich mich geweigert, nach Dublin zu ziehen, also gab er zähneknirschend klein bei, und wir blieben in Galway. Damals sagte ich Thomas, ich wolle den Job im Laden nicht aufgeben und bei meiner Familie sein. Jetzt sitze ich in den Wicklow Mountains und begreife endlich, dass ich mir einfach nur nicht vorstellen konnte, nicht in Ethans Nähe zu sein.
Ich küsse seine unrasierte Wange. Er blinzelt und sieht mich so intensiv an, dass sich mein Puls erhöht. Seine Hand greift in meinen Nacken, und dann küsst er mich, dass mir schwindelig wird. Er streicht mir durchs Haar, als er sich löst.
„Weißt du eigentlich, dass ich dich liebe?“, flüstert er mir zu.
Ich bin so ergriffen, dass ich kein Wort hervorbringe. Er lehnt sich wieder zurück und zieht mich an seine Brust. Ich umarme ihn, schmiege mich eng an ihn.
Ich liebe dich auch.