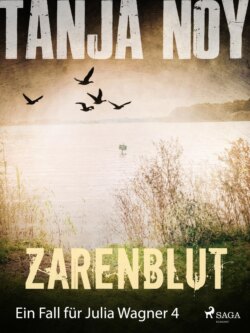Читать книгу Zarenblut - Ein Fall für Julia Wagner: Band 4 - Tanja Noy - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KAPITEL
ОглавлениеSo empfängst du mich …
Hannover
Ungefähr zur selben Zeit kam Susanne Grimm mit zwei Stunden Verspätung wieder in Deutschland an – ebenfalls vollkommen ahnungslos, wohin diese Geschichte sie noch führen würde.
Sie fand eine schneegepeitschte Stadt vor, die völlig konturenlos schien. Die Menschen in der Flughafenhalle drückten und schoben und stießen mit ihren Koffern um sich. Aus den Lautsprechern erklang Jingle Bells. Bunte Lichter, die überall von den Decken hingen, kündigten Weihnachten an, das Fest der Liebe.
Nach fünf Monaten in der Einsamkeit Norwegens war die überwältigende Menschenfülle ein Angriff auf jeden einzelnen von Susannes Sinnen. Sie war überhaupt nicht mehr an die beklemmende Dichte von Geräuschen, Gerüchen und Gesichtern gewöhnt, und einen Moment lang wünschte sie sich zurück und dachte an das letzte Telefonat mit Jo und Edda, kurz vor ihrem Abflug nach Deutschland.
„Du brauchst mich wirklich nicht alle zehn Minuten anzurufen, Jo“, hatte sie gesagt. „Du hast doch bestimmt Wichtigeres zu tun.“
Aber Jo hatte nichts Wichtigeres zu tun. „Hast du dir das auch wirklich gut überlegt?“, fragte er sie noch einmal.
„Wir haben jetzt wirklich oft genug darüber gesprochen.“
„Hast du auch genügend Geld?“
„Du warst doch dabei, als die fünfzigtausend Euro vom Konto meines Vaters auf mein Konto gebucht wurden.“
„Illegal.“
„Ich konnte ihn leider nicht fragen.“
„Und er kann es ja nun wirklich verkraften“, erklang Eddas Stimme aus dem Hintergrund.
„Jo“, sagte Susanne, „du machst dir zu viele Gedanken. Wirklich. Warum setzt du dich nicht auf die Couch, legst die Beine hoch und entspannst dich ein bisschen?“
„Du wirst mich nicht dazu zwingen können, mich zu entspannen, solange ich nicht weiß, wohin das führt, was du da vorhast.“
„Ich danke dir für alles, was du in den letzten Tagen für mich getan hast. Danke auch dir, Edda. Ihr seid zu meinen zwei besten Freunden geworden.“
„In Zeiten der Freude wie der Not, so sagt man doch, nicht wahr?“ Das war wieder Eddas Stimme aus dem Hintergrund.
„Ja“, sagte Susanne. „In der Freude wie in der Not.“
Dann hatten sie sich verabschiedet. Sie war in den Flieger gestiegen, und nun war sie hier. Und erst jetzt bemerkte sie, wie nervös sie tatsächlich war. Tief atmete sie durch, zwang sich zur Ruhe.
Niemand starrt mich an. Niemand erkennt mich.
Aber konnte sie da wirklich sicher sein?
Unauffällig suchte Susanne mit den Augen die Ankunftshalle ab.
Mit allem hätte sie gerechnet, aber nicht damit, von einer derartigen Angst übermannt zu werden. Nicht damit, derart zu schwitzen. Denn eigentlich kannte sie sich inzwischen mit Angst aus. Schließlich lebte sie seit Monaten permanent mit der Angst, und da sie auf der Flucht vor der Polizei war, war das wohl auch kein Wunder. Ihr Foto hing vermutlich in allen Polizeistationen der Stadt. Vielleicht sogar im ganzen Land. Und ganz bestimmt auch hier.
Susanne zwang sich, nicht weiter darüber nachzudenken, doch merkwürdigerweise schien es so, als sei die Fähigkeit, an nichts zu denken, in diesem Moment ganz besonders schwierig zu meistern. Während sie sich in Richtung Ausgang bewegte, überschlugen sich die Gedanken förmlich in ihrem Kopf. Sie hatte in ihrem Leben einige Bücher gelesen, in denen die Hauptfigur ständig auf der Flucht war. Der Flüchtige war seinen Verfolgern immer einen Schritt und einen Gedanken voraus, und für sie als Leserin war das stets recht unterhaltsam gewesen. Inzwischen konnte sie aus Erfahrung sagen, dass es in Wahrheit alles andere als lustig war. Sie steckte ihre Hand in die Manteltasche und überzeugte sich davon, dass ihre neuen Papiere noch da waren. Claudia Müller, das war der Name, den Edda für sie ausgesucht hatte. Hervorragend gefälschte Papiere. Dazu die neue Frisur, ein Pagenkopf, die neue hellbraune Haarfarbe, hellrotes Rouge und Kleidung, die so teuer und elegant war, dass sie sie vor ein paar Monaten nicht einmal angesehen hätte. Nein, kein Mensch von früher hätte Susanne, die Punkerin, sofort wiedererkannt.
Großartige Edda, dachte Susanne, wunderbare, großartige Edda. Dann sah sie auf und … erstarrte.
Ein paar Meter von ihr entfernt stand ein Polizeibeamter, der sie aufmerksam musterte. Zu aufmerksam.
Vermutlich hatte sie sich zu schnell in Richtung Ausgang bewegt, vielleicht auch zu hektisch. Auf jeden Fall hatte sie seine Aufmerksamkeit erregt, und jetzt sahen sie sich direkt in die Augen.
Alles Blut sackte aus Susannes Kopf in die Füße. Sie zwang sich, ganz langsam weiterzugehen, während sie überlegte, was sie jetzt tun sollte. In die Toilette verschwinden? Sich in Bewegung setzen und rennen? Vermutlich keine gute Idee. Man würde sie zur Strecke bringen, noch ehe sie den Ausgang erreicht hatte.
Also ganz langsam weitergehen.
Der Beamte wandte sich jetzt mit dem ganzen Oberkörper in ihre Richtung, und sein Blick bohrte sich regelrecht in sie hinein.
Susanne grüßte ihn freundlich, aber er grüßte nicht zurück. Doch dann wandte er den Blick ab, und sie atmete erleichtert durch.
Jetzt hatte sie es fast geschafft.
Nur noch etwa zehn Meter.
Obwohl ihre Reisetasche so klein und leicht war, grub sich der Riemen tief in Susannes Schulter. Sie hatte nur wenig eingepackt, denn falls sie etwas benötigte, konnte sie es hier in Deutschland nachkaufen. Über der anderen Schulter baumelte lediglich ihre Handtasche.
Noch fünf Meter.
Gleich war sie draußen. Susanne war so sehr in Gedanken, dass sie den Mann, der seitlich auf sie zukam, gar nicht wahrnahm. Bis zu dem Moment, in dem sie mit ihm zusammenstieß.
Hatte sie ihn angerempelt oder er sie? Sie hätte es hinterher nicht mehr sagen können. Auf jeden Fall stolperten sie gegeneinander, und er sagte aufgeregt: „Entschuldigung, tut mir leid. Habe ich Ihnen wehgetan? Ist alles in Ordnung?“
Susanne wollte antworten, doch alles, was sie zustande brachte, war, ihn erschrocken anzustarren.
„Hallo?“, sagte er.
„Nein.“ Sie riss sich zusammen. „Es ist … alles in Ordnung.“
„Tut mir wirklich leid.“ Der Mann ging um sie herum und war kurz darauf mit seinem Rollkoffer in der Menge verschwunden.
Susanne sah ihm einen Augenblick hinterher, dann wandte sie sich wieder in Richtung automatische Tür.
Ein Schritt.
Noch ein Schritt.
Die Tür glitt vor ihr auf, und Dunkelheit kam dahinter zum Vorschein.
Jetzt wusste sie, dass sie es geschafft hatte.
Erleichtert trat Susanne hinaus und sog die eisige Luft ein. Dann sah sie sich um und blinzelte. Hannover, meine Stadt, so begrüßt du mich also, dachte sie. Mit Schnee und Kälte. Und als würde die Stadt ihr antworten, fegte ein steifer Wind ihr Schnee ins Gesicht, der sich anfühlte wie eine Mischung aus Eis und Sand. Schaudernd zog sie die Schultern hoch, drückte den Kragen ihres Mantels enger an den Hals und ließ den Blick erneut über das Areal streifen. Ein paar Taxifahrer saßen in ihren Wagen und ließen die Motoren laufen, um die Heizung anzutreiben.
Einen Fuß vorsichtig vor den anderen setzend, um nicht mit ihren teuren und wenig bequemen Schuhen auf dem Schnee auszurutschen, bewegte Susanne sich auf einen davon zu – und wäre dabei fast in ein Auto gelaufen. Eine Hupe dröhnte, und sie hob entschuldigend eine Hand.
Erst als sie im Fond einer der Taxen saß, spürte sie, wie sich etwas in ihr entspannte. Sie nannte dem Fahrer, einem alternden Hippie, die Adresse, zu der sie wollte. Er nickte, gab Gas, und der Wagen machte einen so schnellen Satz nach vorne, dass Susanne tief in den Sitz gedrückt wurde. „Meine Güte!“, entfuhr es ihr.
„Tut mir leid“, sagte der Hippie und konzentrierte sich auf die Straße. Die Heizung lief auf Hochtouren, es war brütend heiß im Wagen. „So ein Wetter hab ich schon lange nicht mehr erlebt“, sagte er. „Eigentlich habe ich so ein Wetter überhaupt noch nie erlebt. Das wirkt irgendwie bedrohlich, finden Sie nicht auch? Also, wer spätestens jetzt keinen warmen Unterschlupf hat, der krepiert, das steht fest.“
Susanne antwortete nicht darauf. Während sie aus dem Seitenfenster blickte, hatte sie das Gefühl, dass das Taxi nicht vorwärts, sondern rückwärts fuhr. Zurück in die Vergangenheit. Sie sah Restaurants und Fastfoodläden, hässliche Bürobauten inmitten riesiger Parkplätze. Tankstellen. Ein Einkaufszentrum. Noch ein Einkaufszentrum. Da bin ich wieder, dachte sie.
Zwanzig Minuten später verlangsamte der Hippie mit einem leichten Schlingern und brachte den Wagen schließlich zum Stehen. „Da sind wir.“ Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, die Fahrt hatte höchste Konzentration von ihm gefordert.
Es schneite so sehr, dass Susanne keine Ahnung hatte, ob dies tatsächlich ihr gewünschtes Ziel war. Sie nahm es aber einfach mal an und bezahlte. Nachdem sie ausgestiegen war, stand sie im gelblichen Licht einer Straßenlampe inmitten von unzähligen Schneeflocken und hörte, wie ein Fremder mit lauter Stimme ein anderes Ziel nannte und in das Taxi einstieg. Gleich darauf war es im Schneegestöber verschwunden.
Willkommen daheim, dachte Susanne. Sie wandte sich um, und was sie dann sah, wirkte wie eine Vision aus einem amerikanischen Weihnachtsspielfilm. Das Hotel war ein weitläufiger Bau, dessen Mauern irgendwie von innen heraus zu leuchten schienen. Es war sehr elegant, manche Menschen hätten es dekadent genannt, sie selbst hätte das vor ein paar Monaten auch noch getan. Am Haupteingang waren zwei uniformierte Pagen damit beschäftigt, die wenigen Autos der Gäste zu parken und die zu empfangen, die mit einem Taxi kamen.
Unwillkürlich fiel Susanne ein Satz ein, den ihr Vater irgendwann einmal zu ihr gesagt hatte: „Die Menschen brauchen Klassensysteme.“ Und als sie hatte wissen wollen, warum, hatte er geantwortet: „Weil das Klassensystem den Menschen ein Ziel gibt. Einen Antrieb, der über Essen und Schlafen hinausgeht. Etwas, das sie dazu bringt, gewisse Leistungen zu vollbringen. Verstehst du das?“
Nein, Susanne hatte es nicht verstanden. Vielleicht hatte sie es auch nicht verstehen wollen. „Wenn ich einen dicken Mercedes fahre“, hatte sie geantwortet, „heißt das noch lange nicht, dass ich besser bin als jemand, der mit dem Fahrrad fährt.“
„Das mag sein“, hatte ihr Vater geantwortet. „Aber ein Mercedes ist ein wichtiges Symbol der Leistung, der Position. Ein Fahrrad ist das nicht.“
„Ein teures Auto, eine Villa, eine hübsche Frau, das sind die Symbole, nach denen du schon immer gestrebt hast, Vater, ich weiß. Aber ich werde das nie tun.“ Davon war Susanne absolut überzeugt gewesen.
„Doch, das wirst du.“ Ihr Vater klang nicht weniger überzeugt. „Und ich sage dir auch, warum: weil niemand gerne ein Verlierer ist. Weil niemand gerne mit Verlierern arbeitet und weil sich niemand gerne mit Verlierern umgibt.“
„Es mag sein, dass ich in deinen Augen ein Verlierer bin, Vater, aber ich wette, ich bin jeden einzelnen Tag glücklicher als du.“
Blinzelnd kam Susanne in die Gegenwart zurück. Alles in ihr sträubte sich dagegen, das Hotel zu betreten. Sie wollte sich nicht zu einem Klon ihres Vaters machen, aber sie wusste auch, dass man sie hier am allerwenigsten suchen würde.
„Hohoho!“
Sie fuhr herum und sah den Weihnachtsmann, der an ihr vorbeiging. Ein bärtiger Hüne mit einem Jutesack über der Schulter, der verdächtig nach Schnaps roch. Der Hüne, nicht der Sack.
„Frohe Weihnachten.“
„Frohe Weihnachten“, gab Susanne zurück.
„Die schönste Zeit des Jahres.“ Der Weihnachtsmann lächelte unter dem weißen Bart. „Das Fest der Liebe.“
„Wenn Sie das sagen.“ Sie sah ihm einen kurzen Moment lang hinterher, beobachtete, wie er durch die dichten Schneeflocken davonstapfte. Dann wandte sie sich wieder dem Hotel zu, gab sich einen Ruck, trat durch die verspiegelte Glastür und buchte wenig später am Empfang ein Zimmer.
Ihr Gepäck brachte sie selbst hinauf. Sie hatte ohnehin nicht vor, lange zu bleiben. Sie hatte heute Abend noch etwas vor.
Vorher jedoch schrieb sie noch eine kurze SMS an ihren Bruder: Hallo Jörg, bin wieder da. Treffen uns morgen früh. Komm vorbei. Dazu schickte sie ihm die Adresse des Hotels, ehe sie sich noch einmal auf den Weg machte.