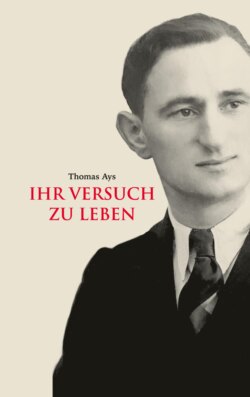Читать книгу Ihr Versuch zu leben - Thomas Ays - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
ОглавлениеJohanns Entscheidung stand fest. Nach der heutigen Kundenbelieferung würde er sich mit Frieda auseinandersetzen. Es war vorbei. Wahrscheinlich schon länger, die letzte Nacht, die schlaflos gewesen war, hatte den Entschluss in ihm reifen lassen, dass es keinen Zweck hatte mit ihnen beiden. Er hörte schon seine Mutter in seinem Kopf, die etwas von „Ewigem Junggesellen“ und „Denk an den Hof“ schimpfte. Es war schon ein Graus mit ihm. Immer musste er gegen den Strom schwimmen, anders sein und vor allem andere Wünsche haben, als das gängige Männerbild. Er hatte kein Interesse an der Armee, am Krieg sowieso nicht und eine Heirat stand nun auch nicht gerade ganz oben auf seiner Liste. Alles, was er wollte war, dass es seiner Familie gut ging. Dass sie alle glücklich waren und sich sicher fühlten.
Sicher.
Hier.
Mit dem Krieg vor der Türe. Es war viel Verantwortung. Eine Frau hätte da nur bedeutet, diese Verantwortung ein Stück weit aufzuteilen. Wenn er eine Frau und noch dazu Kinder haben würde. Was würde dann aus den anderen werden? Würden sie darunter leiden, dass seine Aufmerksamkeit nicht mehr nur ihnen galt? Seine Schwestern würden eine Frau an seiner Seite vermutlich nur schwer akzeptieren, seinem Bruder wäre es vermutlich egal, solange er auch eine abbekam. Doch Frieda. Frieda war keine Option mehr. Sie würde mit ihrer Ideologie seine gesamte Familie in eine neue Richtung führen. Das kam nicht in Frage – unter keinen Umständen.
Seine Waren gingen langsam zur Neige, als er vor dem großen Anwesen der Schmids hielt. Es war die letzte Adresse und er hoffte, dass er alles hatte, was die mürrische Köchin wollte. Es klappte in der Regel gut seinen Charme einzusetzen, doch bei ihr biss er auf Granit. Umso erfreulicher war es, als nicht sie, sondern Christel die Tür öffnete.
„Johann.“, sie lächelte ihr schönstes Lächeln und sah sich schnell um. Offenbar hoffte sie, dass Maria nicht in der Nähe war. „Schön, dich zu sehen.“
„Gleichfalls, Christel. Wie geht es dir? Du siehst bezaubernd aus.“
Sie schlug ihm spielerisch auf die Schulter. „Hör schon auf.“
„Was? Es ist so. Du bist die Königin der Dienstmädchen. Schau dich an, wie sich die Uniform an dich schmiegt. Keine kann es so gut tragen, wie du.“
Obwohl Christel errötete, schlug sie ihn wieder. „Hör auf, hab ich gesagt.“
„Gut, was brauchst du?“, lächelte er sie an „Ich meine, außer meinen Komplimenten.“
Christel versuchte klar zu denken, ganz offensichtlich, und Johann freute sich innerlich wie ein kleines Kind. Er grinste verschmitzt und wartete auf eine Reaktion. Doch Christel schien sich nur bruchstückhaft an die benötigten Waren erinnern zu können.
„Kartoffeln vielleicht?“, versuchte er es ohne sein Lächeln aufzugeben.
„Weißt du, Johann.“, begann Christel und lehnte sich gegen die Küchentür. „Du mit deinen Segelohren und deiner viel zu großen Nase hast ein ernsthaftes Problem.“
„Ah ja?“, jetzt begann es spannend zu werden, Johann war in seinem Element: Frauen, die sich spielerisch zur Wehr setzten.
„Ja. Du denkst du bist unwiderstehlich.“
„Ich bin unwiderstehlich.“, und beide lachten.
„Gut, ähm, wir brauchen Kartoffeln, Salat und Gurken.“
„Hab ich alles. Noch was?“
Christel überlegte. „Nein, ich glaube nicht.“
„In Ordnung. Ich hole alles. Soll ich anschreiben?“
„Ja, bitte. Maria ist gerade nicht da und ich darf nicht an die Geldkassette.“
„Kein Problem.“
Als Johann das Gemüse abgegeben hatte, lächelte er Christel noch einmal an. „Wie immer ein Vergnügen.“, rief er ihr laut zu, als er sich vom Haus entfernte. Christel lächelte, als sie die Türe schloss. Und wieder eine zufriedene Kundin, dachte Johann und der Schelm in ihm lachte.
Bevor er sich der Auseinandersetzung mit Frieda stellte und die Metzgerei ihres Vaters besuchte, klapperte er noch drei weitere Kunden ab, bevor er am Markt hielt. Anna und Margareta hatten heute wieder den Stand übernommen. Er wühlte sich durch die Kunden und sah seine Schwestern schon von weitem. Margareta hievte gerade einen Sack Kartoffeln zu einem stämmigen Mann hinüber und Anna bediente eine Kundin. Johann blieb kurz stehen und beobachtete sie. Sie war schön, aber nicht im klassischen Sinne. Sie hatte braunes Haar, das sie hochgesteckt trug und sie steckte, wie Christel, in einer Dienstmagd Uniform. Sie war nicht schlank, aber auch nicht dick, sie hatte wohl das, was man eine weibliche Figur nannte und noch dazu ein ansteckendes Lächeln, das sie gerade seiner Schwester schenkte. Wer sie wohl war? Er wollte es gerade herausfinden, als Frieda neben ihm auftauchte.
„Johann.“, unterbrach sie seine Gedanken und er zuckte zusammen. „Alles in Ordnung? Habe ich dich erschreckt?“
„NEIN!“, sagte er etwas zu laut. Er fühlte sich ertappt und schämte sich plötzlich. „Nein.“, sagte er leiser. „Ich war nur in Gedanken.“
„Wir müssen miteinander sprechen, Johann. Können wir uns später treffen? Am Waldrand? Auf unserer Bank? Gegen 8?“
„In Ordnung. Wir treffen uns dort.“
Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und verabschiedete sich. Als Johann zu seinem Stand zurückschaute, war die Unbekannte verschwunden. Mist! , fluchte er innerlich und drängte sich zu seinen Schwestern durch.
„Johann!“, begrüßte ihn seine Schwester Anna „Was tust du hier?“
„Nach euch sehen, was denn sonst?“, er grinste beide an „Braucht ihr noch was?“
„Nein, wir haben genug. Sie sind heute nicht unbedingt in bester Kauflaune.“, sagte sie etwas leiser.
„Und es ist viel Militär hier.“, mischte sich Margareta ein. „Ungewöhnlich viel. Und sie sehen alle gleich aus.“
„Gut. Haltet noch etwas durch und kommt dann nach Hause.“
Johann ging zu seinem Wagen zurück, setzte sich auf und trieb die Pferde an. Auf dem Nachhauseweg dachte er darüber nach, was er Frieda wohl sagen wollte. Und er fragte sich, warum sie ihn sprechen wollte. Vielleicht wollte sie ihm ja sagen, dass sie eine neue Bekanntschaft gemacht hatte und ihn verlassen würde? Das wäre das Beste überhaupt. Doch Johann wusste, dass er nicht so glimpflich davon kommen würde. Wahrscheinlich machte sie ihm entgegen jeder Tradition einen Heiratsantrag. Er schluckte und musste kurz lachen. Das würde wirklich passen. Er wollte es beenden und sie fühlte sich noch enger an ihn gebunden. Vielleicht war es wirklich das Allerbeste, wenn er sich in Zukunft von Frauen fernhielt. Es hatte ja doch alles keinen Sinn. Doch dann musste er wieder an die junge Frau vom Markt denken. So natürlich schön und mit einer schüchternen Art, die Johann unweigerlich in ihren Bann zog. Während ihn seine zwei Pferde in Richtung heimatlichen Hof zogen, flogen noch einmal seine Eroberungen an ihm vorbei. Er war keiner dieser Männer, der eine Art Erfolgserlebnis hatte, je mehr Frauen er heimlich glücklich machte. Es war eher so, dass sich diese Frauen ihm an den Hals warfen. Ohne Verpflichtungen und ohne Hintergedanken – er hatte ja nichts, wofür es sich zu lügen lohnte. Es war sein Charme, sein Witz und der Schalk, der ihm offen im Nacken saß. Er war eigentlich ganz froh, dass es nie ernster wurde. Es ersparte ihm viel Zeit, die er für seinen Hof und seine Geschwister brauchte. Unterm Strich war ihm sein eigenes Leben nicht so wichtig. Er war jedoch ein Lausbub mit Verantwortung, was dem Ganzen den Spaß raubte. Frieda war da das perfekte Beispiel. Sie war eine ernsthafte Kandidatin, die im heiratsfähigen Alter und bereit war Kinder zu bekommen. Die sich mit harter Arbeit auskannte und sich für einen Hof sicher nicht zu schade war. Von außen gesehen also eine perfekte Konstellation. Doch Johann wollte nichts Perfektes und schon gar nicht etwas, das nur danach aussah. Denn er wusste, dass es zwischen ihnen nicht funktionieren würde. Wenn es mit dem Krieg so weitergehen würde und sich alles noch mehr veränderte, wenn er sogar selbst eingezogen werden würde, wäre Frieda diejenige, die zuhause auf ihn warten würde. Und wenn sich bei einer Sache ganz sicher war, dann darin, dass er nicht wollte, dass sie auf ihn wartete.
Als er kurz vor acht Uhr bei der Bank eintraf, auf der sie so oft wild herumgeknutscht hatten, war Frieda bereits dort. Sie lächelte, als sie ihn sah und Johann lächelte zurück. Er setzte sich zu ihr und sie nahm sofort seine Hand.
„Danke, dass du gekommen bist.“, begann sie „Ich komme gleich zur Sache, sonst sag’ ich es vermutlich nie.“ Sie war nervös. Er bemerkte ihre feuchten Handflächen in seiner.
„Bitte verzeih mir, dass ich versucht habe, dich zu etwas zu drängen, was du nicht willst. Es war nicht in Ordnung.“
Sie machte es ihm wahrlich nicht einfach.
„Aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht zusehen, wie du in dein Unglück rennst, Johann.“
Jetzt war er verwirrt.
„Verstehst du denn nicht, dass es nur eine Zukunft gibt? Ganz egal, was wir alle davon halten und denken. Die Nazis sind zu viele. Es ist besser mit dem Strom zu schwimmen, als darin zu ertrinken.“
In Johann stieg wieder die Wut auf und er ließ ihre Hand los.
„Lass uns heiraten und zumindest auf dem Papier gute Deutsche sein. Wir schreiben uns in die Partei ein und verhalten uns unauffällig. Nur so können wir ein schönes Leben haben. Wenn wir den Krieg gewinnen, was glaubst du wohl, wird passieren mit denen, die sich den Nazis in den Weg gestellt haben?“
„Ich stelle mich ihnen ja gar nicht in den Weg, Frieda. Ich will damit einfach nur nichts zu tun haben!“ Er wurde lauter.
„Du verstehst nicht, dass du schon längst etwas damit zu tun hast. Wir sind schon lange mittendrin. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen...“
Er unterbrach sie und stand auf. „Wer spricht hier eigentlich mit mir, Frieda?“
Sie sah ihn verwirrt an „Was meinst du?“
„Na wer? Du bist es nicht. Du hast keine politische Ahnung. Wie ich auch nicht. Und dennoch redest du. Also musst du mit jemandem gesprochen haben. Was war es, Frieda? Ein Flugblatt? Wer? Hm? Die Soldaten auf der Straße? Dein Vater?“
Frieda sah weg und ihr Blick wurde schwer.
„Dein Vater also. Gut. Richte ihm aus, dass seine Tochter gerne einen angehenden Offizier oder SS-General heiraten kann. Sie hat meinen Segen. Aber ich...“ er beugte sich zu ihr vor und zwang sie damit, ihn wieder anzusehen. Sein Blick war hart, „ich werde es nicht sein.“
Er ging zu seinem Fahrrad zurück und sah noch einmal zu Frieda zurück, die sich nicht bewegt hatte. „Leb wohl, Frieda.“, rief er ihr zu und fuhr zurück in Richtung altem Leben. Eine Zukunft mit Frieda hatte er soeben unwiderruflich begraben.