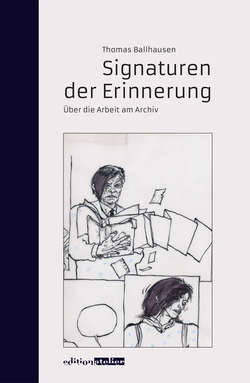Читать книгу Signaturen der Erinnerung - Thomas Ballhausen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.2 Erinnerungsdiskurs und Archivsystem
ОглавлениеErinnerungsdiskurs und Archivsystem – das sind die beiden Gesichter eines janusköpfigen Kindes der Moderne, die uns im besten und vielfältigsten Sinne des Wortes als Depots unterschiedlicher, doch miteinander verknüpfter Wirkungsweisen entgegentreten. Basierend auf antiken Quellen hat die Auseinandersetzung mit Gedächtnis und Erinnerung zwar eine lange Tradition, doch wesentliche Veränderungen kamen hier – ebenso wie die aus ihrem wirtschaftlichen oder juristischen Primärumfeld herausgelösten Archive – erst im frühen 20. Jahrhundert. Bedingt durch zeitgeschichtliche Zäsuren und die Entwicklungen auf dem Feld der Technik sind diese beiden Bereiche wieder verstärkt in den Blickpunkt unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen gerückt – geprägt nicht nur von konstruktiven Auseinandersetzungen, sondern auch von oft schwierigen, doch dringend notwendigen Diskussionen um wissenschaftsgeschichtliche Aspekte der wesentlich weniger erfreulichen Art: Vergessen, Verdrängung, Verzerrung.
Der Wunsch nach einer Verlebendigung des Bewahrten und einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist in unserer (Diskurs-)Gegenwart, die auf eine angenommene Zukunft hinarbeitet, durchaus unterstützenswert:
„Der Wunsch von Individuen oder Gemeinschaften, sich eine andere Vergangenheit zu geben oder Teile der eigenen Vergangenheit neu zu entdecken und zu bewerten, macht aber auch auf eine andere Möglichkeit der Archive im Umgang mit Vergangenheit aufmerksam, nämlich jene, die Teile des kollektiven Gedächtnisses, über die sie verfügen, neu anzuordnen und in einen neuen Sinnzusammenhang einzufügen“ (Auer, 2000, 62).
Diese Arbeitsweise war besonders für Aby Warburg, der neben Maurice Halbwachs als einer der wichtigsten Vertreter des uns heute vertrauten Erinnerungsdiskurses gelten kann, von Bedeutung. Während der Soziologe Halbwachs in seinen Schriften zum Erinnerungsdiskurs die soziale Bedingtheit des kollektiven Gedächtnisses in das Zentrum seiner Überlegungen stellte, vertrat der Kunsthistoriker Warburg die Auffassung einer auf Symbolen basierten Kultur, deren daran angeschlossenes kollektives Gedächtnis je nach Zeit und Ort aktualisiert und verändert werden würde. In seiner induktiven, vom Material diktierten Herangehensweise kann Warburgs Ansatz als postmodernes Vorzeichen eines – im homonymen Sinne – überaus modernen Vertreters gelten, auf den auch noch neueste erinnerungsspezifische Theorien rekurrieren. Besonders deutlich wird dabei die Methode einer fächerübergreifenden Herangehensweise, die sowohl Halbwachs als auch Warburgs Methoden kennzeichnet und auch das Verhältnis von Erinnerungsdiskurs und Archivsystem ganz deutlich mitbestimmt:
„Gedächtnis und Depot verweisen aufeinander, so wie Erinnerung und Exponieren aufeinander verweisen. Das aber heißt, daß Akte des aktiven Erinnerns in Form des Exponierens und des Aktivierens von gespeichertem und magaziniertem Material eines aktuellen Rahmens […] bedürfen. Mit der Rahmung erfolgt eine Redimensionierung von Relikten der Vergangenheit aus der Sicht und der Interessenskonstellation einer jeweiligen Gegenwart: Erst das Exponieren macht aus dem Zeugs den Zeugen, erst in der Auf- und Gegenüberstellung wird der Zeuge aussagefähig, erst im Kreuzverhör der Ex-, Juxta- und Kontraposition wird der Zeuge zur Auskunft veranlasst“ (Korff, 2000, 45).
Das Archiv steht für eine geordnete Sammlung, die, abseits ihrer stark auf den wirtschaftlichen Bereich fokussierten Ausrichtung, in den letzten Jahrzehnten immer häufiger in konstruktiver Verbindung zu den Bereichen des Museums und der Bibliothek gedacht und konzipiert wird. Dies liegt neben der Praktikabilität der Verknüpfung wohl zu einem Gutteil auch daran, dass diese Institutionsformen zumeist ebenfalls interne Archive ausbildeten, um heterogene Teilbestände adäquat aufarbeiten und verwalten zu können. Abseits der klassischen Sammlungsinhalte, wie etwa dem Medium Buch (für die Bibliothek) oder dem mehr oder minder singulären Objekt (für das Museum), fanden etwa Nachlässe oder nicht-publiziertes Material ihren Weg in diese Institutionen. Die Herausforderung der Datenerfassung, der Bewahrung und sachgerechten Aufarbeitung verlangte und verlangt nach einem archivalischen Zugang innerhalb erwähnter sammlungsspezifischer Strukturen. Die Bewahrung der Bestände kann dabei als die wohl dringlichste Aufgabe verstanden werden:
„Ungeachtet aller Zufälle und Wechselfälle der Überlieferung bleibt das Bewahren natürlich konstitutives Element und wesentlichste Funktion der Archive. Darin besteht ihr wichtigster Beitrag zur Bewahrung von Gedächtnis, daß sie Vergangenes erhalten und Vergessenes neu ans Licht bringen“ (Auer, 2000, 61).
Dieser wissenschaftlich unterfütterte Vorgang der Rückgewinnung des Vergessenen, Vergangenen und auch Verdrängten kann nur im Sinne einer Balance zwischen Bewahren und Zugänglichmachen der Bestände – so ihre Beschaffenheit dies zulässt – gedacht und gelebt werden.
Das Archiv – das gleichermaßen System der Ordnung und eigentliche Sammlung ist, die durch ein differenzschaffendes Scharnierelement administrativer, submedialer Prozesse verbunden sind – kann auf diesem Weg als Ort der intellektuellen Wertschöpfung begriffen werden, der durch seine heterogenen Bestände vor-geprägt ist. Die unterschiedlichsten Arten des Bestandes sind dabei eben nicht nur wesentliches Kennzeichen, sondern vielmehr auch eine positiv wirksame Rahmenbedingung für den Umgang mit dem jeweiligen Material und Vorgabe gewisser Grundlinien diskursiver Arbeiten und Herangehensweisen. So kann abseits von fälschlich unterstelltem Selbstzweck über eine andauernde Neubewertung nicht nur ein umfassenderes, besseres Verständnis der eigenen Disziplin und neuerer Entwicklungen, sondern auch ein kritisches Analyseinstrumentarium umfassenderer sozialer Prozesse gewonnen werden. Die konsequente Befragung der gegebenen Sammlungsbestände – was also etwa noch als Ausstellungsexponat tauglich ist oder aber eben schon Teil einer disziplinhistorischen Auseinandersetzung gilt – kann eben nicht im engen Verständnis einer als allumfassend missverstandenen Hermeneutik der endgültigen und immerwährenden Ergebnisse stattfinden. Vielmehr verlangt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Erinnerung und Archiv nach einer – im poststrukturalistischen Sinne – Kette miteinander verknüpfter Auslegungen, die auch die Geschichte des eigenen Arbeitsfeldes befruchten und vorantreiben. Trotz der mitunter kritisch zu betrachtenden Ausrichtung dieser interpretativen Verfahrensweise, ist diese doch die geeignetste, um die Veränderung des Stellenwertes des erfassten Materials in Bezug zu einer – im Sinne von Hans Robert Jauß – in narrativen Formen organisierten (Disziplin-)Geschichtsschreibung und hinsichtlich aktueller Fragestellungen aufzuzeigen: „Der wissenschaftliche Wert eines Untersuchungsgegenstandes erschließt sich erst in Bezug auf jenes Fragenfeld, auf das zu antworten es erlaubt und damit die Grenzen seiner Aussagekräftigkeit bestimmt“ (Ernst, 2002, 119). Zu berücksichtigen bleibt dahingehend auch die disziplininterne Bedeutungszuschreibung im Rahmen einer zweifachen Bewegung: Die erste dieser Bewegungen ist die Herausentwicklung des jeweiligen Artefakts aus einer der Entropie verhafteten Phase der Unordnung, des Chaos’, vielleicht sogar des Mülls (Thompson, 2003) in einen Zustand der Aufwertung. Die zweite, daran wohl zumeist anschließende Bewegung ist die einer – auch mnemotechnisch relevanten (Yates, 1990, 336ff.) – Zirkulation von Semantisierungsleistungen im Rahmen der Auseinandersetzung mit Sammlungsbeständen und Einzelobjekten, einem Diskurs im Sinne eines Oszillierens zwischen zwei Spannungspunkten: „Archivalien sind also keine Frage von Vergangenheit, sondern einer Logistik, deren Koordination quer zur Beobachterdifferenz von Gegenwart und Vergangenheit liegt – eine kybernetische Funktion von Latenz und Aktualisierung“ (Ernst, 2002, 120f.).
Diese intellektuell-logistische Leistung schließt auch Bedeutungsverschiebungen und (Neu-)Bewertungen mit ein: „Charakteristisch für diese Archivästhetik ist die Semantisierung einer institutionellen Organisation durch die Hermeneutik des Organismus, mithin also die Anthropomorphisierung eines Apparates durch Lebensphilosophie […]“ (Ernst, 2002, 88). Auch hinsichtlich der (metaphorischen) blinden Flecken, die sich durch die Eingebundenheit in ein System ergeben – also im weitesten Sinne eine quantenmechanische Bezüglichkeit im Sinne von Position, Beobachtung und zu verrichtender Arbeit –, kann das Erkennen dieser Position, ganz im Sinne einer weiterführenden Verbindung von Rationalität und Sammlung, zu einer Erkenntnis der Teilhabe an historischen bzw. historisierenden Prozessen führen. Dabei ist es ja durchaus erstrebenswert, die Gegenwärtigkeit dieser mnemotechnischen Archivarbeit dabei nicht aus den Augen zu verlieren, also an aktuellen Diskursen zu partizipieren und dem dringlichsten Wunsch der Archive nachzukommen: einem delirierenden Zustand zu entkommen und auf eine Ordnung zuzusteuern, die in der Lage ist, sich selbst kritisch zu befragen und der eigenen Disziplin sinnvolle Möglichkeiten der Unterstützung und der (Selbst-)Reflexion im Sinne einer metaphorischen Registratur bieten zu können. Dies gilt auch in einem umfassenden Sinne für die in den Institutionen tätigen Personen, die durch ihre Tätigkeit immer auch im Archivdiskurs mitgemeint und miteingeschrieben sind. Sie sind somit die Verantwortlichen, die mit ihrer Leistung dazu beitragen müssen, dass – ganz im Sinne des zitierten Calassos – Kultur und Blätterrauschen unterscheidbar bleibt:
„Archive stellen einen wichtigen Teil des kollektiven Gedächtnisses dar oder vielmehr, sie enthalten die Bausteine, aus denen dieses Gedächtnis immer wieder neu zusammengesetzt und zum Leben erweckt werden kann. […] Daß Archive nur einen wenn auch wichtigen Teil des kollektiven Gedächtnisses darstellen, gilt in mehrfacher Hinsicht. Sie teilen sich diese Funktion mit anderen Institutionen, mit Bibliotheken, Museen, der lebendigen Tradition, kurz mit allem, was Erinnerung stiften und bewahren kann. Teil sind sie aber auch in einem anderen Sinne. Archive bewahren den schriftlichen Niederschlag von Geschehenem, der, wie es in einer gängigen Definition heißt, bei Personen oder Institutionen in Ausübung ihrer Funktionen erwächst“ (Auer, 2000, 57).