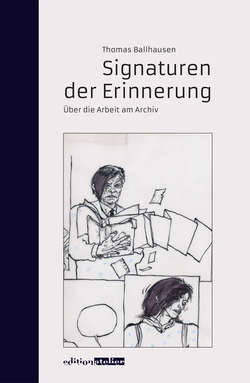Читать книгу Signaturen der Erinnerung - Thomas Ballhausen - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4.3 Körper/Relationen/Codes
ОглавлениеSchon der frühe Film bringt die Tanzenden auf die Leinwand, ist er doch besonders an Körpern in Ausnahmesituationen interessiert. Erotik und Exotik mischen sich, wenn Bauchtänze zu sehen sind und das Publikum ebenso – wenn nicht sogar mehr – zu begeistern wissen, wie marschierende Soldaten in ersten dokumentarischen Versuchen. Thomas Edison selbst definierte Kinematographie als die Erfindung, die die Bilder zum Tanzen bringen würde, und begründete eine fruchtbare, andauernde Beziehung zwischen Tanz und Film bzw. Tanz im Film. Der Kinematograf bannte und projizierte ab seinen ersten Momenten nicht nur das angeblich Faktische, Dokumentarische, sondern auch – und vor allem, möchte man meinen – das Außergewöhnliche, das Schreckliche und das Verführerische. Film- und Tanzgeschichte erweisen sich einmal mehr als Körperhistorie, als Geschichten der Bewegung und des Lichts. Tanz entwickelte sich vom allgemeinen, zutiefst menschlichen Bewegungswunsch und seiner zumeist sakralen Konnotationen – der Beschwörung mythischer Mächte und mystischer Transzendenz – zur hochreflexiven Kunstform. Die Übersetzung dieses Zaubers unter den Bedingungen des anbrechenden 20. Jahrhunderts ist retrospektiv als eines der notwendigsten Projekte einer dynamischen Moderne zu verstehen. Innerhalb der historischen Darstellungen ist Tanz aufgrund seiner Realisationsformen abwesend, bleibt er nach der Aufführung nur über die Erinnerung, über ausdifferenzierte Notationssysteme oder Speichermedien abrufbar. Hinsichtlich der filmischen Kontexte ist zumindest als bemerkenswert anzusehen, dass die Erneuerung mit der vorletzten Jahrhundertwende angesetzt werden kann und sich somit der Hinweis auf eine weitere Parallelgeschichte des Mediums Film und seines sich ausbildenden, baulich verfestigenden Aufführungskontextes Kino anbietet. Tanz nahm zu Beginn klassische Strukturen – etwa auch aus dem filmverwandten Gebiet des Vaudevilles – auf, um daraus neue Optionen der Belebung zu schöpfen. Waghalsige Abläufe und Motivsequenzen fördern in diesen aktuellen choreografischen, medienreflexiven Arbeiten radikale ästhetische Praxen im Umgang mit tanzenden Körpern und Repräsentationsmustern zutage.
Der Körper wird im Tanz in eine Bedeutung an sich transferiert, der Tanz wird zur Übertragung, der aus der alltäglichen Bewegungsbeliebigkeit ausschert. Das choreografierte Subjekt strukturiert den Raum, bewegt sich anhand vorgegebener Codes, es stiftet die Umgebung, Bindungen und Verbindlichkeiten. Aufbauend auf der Kondition des Athletischen und Artistisch-Künstlerischen, wird der Körper zum Instrument, zum Faktor der Situation. Aus dem grundsätzlich rhetorischen Gefüge aus ausgestaltender elocutio und darbietender actio wird nicht nur ein Repertoire herausgeschält, das mit seinen Zugängen ein Werk erneuert; vielmehr kann auch ein gänzlich neues Werk geschöpft und vorgestellt werden. Aus dem produktiven Abhängigkeitsverhältnis zur Choreografie – oder der Problematisierung desselben – kann der Körper mit seinen Bewegungen im Raum tänzerisch vorausgehen, er kann Bilder vor-stellen. Aus einer Außenperspektive eröffnet sich mit dem (modernen) Tanz deshalb wohl auch die paradox anmutende Herausforderung, sich mit dieser Kunst ganz in den Dienst der Vervollkommnung zu stellen – und doch auch spielerischen Umgang mit dem aristotelisch zu lesenden Pathos zu pflegen. Durch diesen gefühlsbetonten Appell kann die Integrität des Tänzers und seiner Schritte – also: die Sache selbst – sinnvoll ergänzt werden. Die Intensität, die dabei in den Augenblick gelegt wird, trägt neben der erwähnten Strukturierung auch zu einer Veränderung der Räume bei, in denen der Körper sich bewegt. Welt, Bühne und Leinwand geraten in eine Austauschsituation, Strategien der Permutation erzeugen Entwürfe, die in ihrer Dimension einer klassischen Bühnensituation mitunter gar nicht mehr entsprechen und in ihrem Streben nach Verwirklichung den Film förmlich (auf-)fordern. Es ist also für den Betrachter nicht zuletzt auch die Vertauschung, in der sich die eingangs betonte Ausnahmesituation der Körper als Anknüpfungspunkt anbietet: sich also zu fragen, ob man lieber ein Tänzer oder ein Marschierender wäre.