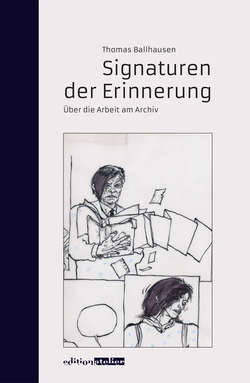Читать книгу Signaturen der Erinnerung - Thomas Ballhausen - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.6 Preservation und Präsentation
ОглавлениеDie Restauration, die ja eigentlich eine individuelle Lösung zur sachgerechten Behebung einzelner Schäden meint, wird im Filmbereich oft mit Preservation umschrieben, womit ein wesentlich umfassenderes Programm zur Sicherung des Bestandes gemeint ist: „[P]reservation incorporates all the measures which in the long run guarantee a maximum of safeguarding, protection of and access to film“ (Klaue, 1990, 88). Der Bereich Preservation wird von vielen Filmarchiven als einer der wichtigsten Arbeitsbereiche erachtet, was sich auch durch das Filmmaterial und dessen Beschaffenheit erklären lässt, das gleichermaßen eine schwierige Herausforderung und ein schützenswertes Gut darstellt. Film ist ein überaus heikles, sogar gefährliches Material, wie in der unlängst erschienenen Aufsatzsammlung zur Geschichte des Nitrozellulosefilms, die nicht zu Unrecht den Titel This Film is Dangerous (Smither, 2002) trägt, nachgewiesen wird. Die Erklärung dieser Gefahr liegt aber weniger im Inhalt der jeweiligen Filme als in der physischchemischen Beschaffenheit des Materials. Film wurde bis Mitte der Fünfzigerjahre auf sogenanntem Nitrozellulosefilm gedreht – einem haltbaren, doch überaus problembelasteten Material. Alterungs- und lagerungsbedingte Schrumpfungsprozesse beeinträchtigen den Filmstreifen ebenso wie ein endogener Zerfallsprozess, also ein chemischer Vorgang, der durch die Zusammensetzung des Materials bedingt ist. Das wohl bekannteste Problem dieses Materials ist die extreme Brennbarkeit, die bei bereits vom Zerfall bedrohten Nitrofilm auch zu Fällen von Selbstentzündung bei Temperaturen von wenig über 40 Grad Celsius führen kann.
Schon kurz nach dem ersten großen, opferreichen Kinobrand 1897 in Paris wurde der Ruf nach einem alternativen Filmmaterial laut. Bereits 1902 fanden erste Versuche in dieser Richtung statt, und laut einer entsprechenden Notiz der New York Evening Times vom 15. Juni 1909 wäre der sicherere Azetatzellulosefilm erhältlich gewesen. Belege für die Verwendung dieses neuen, weniger brennbaren Filmmaterials gibt es aber erst für das Jahr 1912 durch den Kinopionier George Eastman und das Jahr 1914 im Rahmen einzelner Pathé-Wochenschauen (Fordyce, 1976). In der Zwischenkriegszeit war der neue Azetatzellulosefilm durchaus schon regelmäßig in Verwendung, der Versuch, dieses Material als generellen Ersatz für Nitrofilm durchzusetzen, wurde aber durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhindert. Erst nach Ende des Krieges konnten gesetzliche Verordnungen bezüglich des Azetatfilms und der verbesserten Variante des Triazetatfilms – beide werden gemeinhin als Sicherheitsfilm bezeichnet – durchgesetzt werden. In der Bundesrepublik Deutschland wurde eine entsprechende Verordnung 1957 erlassen, in Österreich 1966.
Prinzipiell hat ein Filmarchiv bei der Restauration eines Films mit zwei Schadensarten zu tun: Beschädigungen des Materials, die bei der Produktion passiert sein können oder durch den Gebrauch des Films zustandegekommen sind, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung verursacht wurden. Preservation geht somit Hand in Hand mit der Konservierung, also der Aufbewahrung des Materials in Hinblick auf Bewahrung und die regelmäßige Überprüfung bereits aufgenommener Filmbestände. Je umfangreicher der Bestand, desto umfassender und auch zeitintensiver gestalten sich die Arbeiten an bereits angesammelten Materialien (Regel, 1998). Zur sachgerechten Lagerung gehören wiederum geeignete Räumlichkeiten, die besondere Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse garantieren müssen. Die ideale Filmdeponierung muss zwei klimatischen Lagerungsprinzipien gehorchen: kühl, weil damit die im Material ablaufenden chemischen Prozesse verlangsamt werden, und trocken, um Feuchtigkeit zu vermeiden, die die Gelatineschicht des Materials angreift oder in Verbindung mit Wärme filmschädliche Bakterienkulturen hervorbringt. Das Archivieren restaurierter Bestände ist aber nicht mit der artgerechten Verwahrung einer Kopie gegeben. Vielmehr ist die Gestaltung und Lagerung eines Sicherungspakets vonnöten, um einen Film tatsächlich als „gesichert und archiviert“ bezeichnen zu können: Ausgehend von einem Originalpositiv, soweit man unter quellenkritischen Aspekten von einem Original sprechen kann (Usai, 1994, 84f.), wird ein sogenanntes Dupnegativ erstellt, das wie alle weiteren erstellten Duplierungen aus Sicherheitsfilm besteht. Dieses Negativ stellt einen sichernden Zwischenschritt zwischen weiteren Kopien und dem Original dar und ist aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit für eine technische Weiterverarbeitung bestens geeignet. Von diesem Dupnegativ werden zwei Arbeitspositive gezogen. Eine Kopie steht dann zur Verwendung im Archiv zur Verfügung, die zweite Kopie dient als Ersatz – denn Benutzung heißt eben immer auch Abnutzung des Materials.
Mit der intellektuellen Erschließung der Bestände wächst nicht nur die Übersicht über das jeweils im Zentrum der Sammlung stehende Filmmaterial, denn mit reiner Katalogisierungsarbeit ist es in diesem Bereich schon lange nicht mehr getan. Besonders in Hinblick auf die bereits angesprochene Akquisitionspolitik ist auf lange Sicht die intensive Auseinandersetzung mit historischen Materialien und Dokumenten ebenso notwendig wie nationale und internationale Projekte zur (Tiefen-)Erschließung neuer, bisher unberücksichtigter Quellen. Für eine solche aufwendige Auswertung von Quellen ist die aktive Einbindung einer spezifischen Fachbibliothek, einer wissenschaftlichen Abteilung und einer leistungsfähigen Filmdokumentation unentbehrlich. Letztere
„[…] zielt auf die systematische Erfassung der Informationen über die Filmproduktion ohne Unterschied auf einzelne Gattungen oder Provenienzen. Abendfüllende Spielfilme sind ebenso zu beschreiben wie die jüngste Ausgabe einer der gerade noch überlebenden Wochenschauen, ein Dokumentarfilm amtlicher Provenienz wie der Werbefilm eines Industriekonzerns“ (Kahlenberg, 1978, 147).
In Bereitstellung und Aufarbeitung zeigt sich der Unterschied zu den klassischen Kinematheken ganz deutlich, da „Filmarchive neben ihrer unmittelbaren archivischen Aufgaben durchaus auch in der Lage sind, die eigenen Filmbestände zu präsentieren, […] Kinematheken bleiben stets von den Arbeitsergebnissen leistungsfähiger Filmarchive in aller Welt abhängig“ (Kahlenberg, 1978, 146). Kinematheken sind aus diesem Grund auch eher versucht, über Quantität im Angebot zu punkten, thematische Akzentuierungen bilden hier eher die Ausnahme denn die Regel. Mit dem Zeigen von archivspezifischem Filmmaterial sind mehrere relevante Aspekte in der Programmierung zu berücksichtigen (Schulte Strathaus, 2004, Sætervadet 2006, 57ff.), die ja auch auf die Gestaltung des jeweiligen Programms selbst einwirken (Roumen, 1996, 156): Mit der Projektion auf die Leinwand wird nicht nur das Medium lebendig gehalten, mit sinnvollen Rahmenveranstaltungen, wie Einleitungen und kommentierte Filmschauen, ergibt sich darüber hinaus auch die Möglichkeiten der (Neu-)Belebung von Filmgeschichte und dem Hinführen einer größeren Öffentlichkeit zu einem anspruchsvollen Diskurs. Schlussendlich kann auf diesem Weg auch zu einer klaren Profilierung des Films gegenüber anderen Kunstformen beigetragen werden, ohne medienüberschreitende Phänomene von vornherein zu disqualifizieren. Die erwähnten kommentierten Filmschauen erweisen sich besonders dann als notwendig, wenn im Rahmen der Programmarbeit auch solche Filme und Materialien gezeigt werden, die für Kinematheken als unprogrammierbar gelten müssen: etwa das Zeigen von Filmfragmenten, restaurierten Kostbarkeiten aus den Archivbeständen oder sensiblen Materialien. Gerade solche Reihen laden ja durchaus zu historischen Inszenierungsformen ein, also etwa die Begleitung von Stummfilmen mit Live-Musik.
Das Feld der Publikationen ist ein weiterer Bereich, der die Tätigkeit der Filmarchive für eine größere Öffentlichkeit sichtbar werden lässt. In den Sechzigerjahren war eine erste Phase verstärkter Archivveröffentlichungen spürbar geworden: Damals waren vor allem nationalspezifische Filmografien, Kataloge, Nachschlagewerke und Findbücher veröffentlicht worden. Ab den Neunzigerjahren ist eine verstärkte Publikationstätigkeit über bestandsspezifische Werke hinaus spürbar geworden, die zumeist in klarer Verbindung mit archiveigenen Forschungstätigkeiten zu sehen ist. Die neuen Grundlinien für spezifische Publikationen, die neben der Zugänglichmachung von Sammlungen und der Verbreitung grundlegender Kenntnisse zu Ästhetik und Geschichte des Films vor allem weiterführende Studien biografischer oder theoretischer Art mit einschließen, können mithelfen, ein umfassenderes und detaillierteres Verständnis der Kinogeschichte und ein vollständigeres Bild einer (nationalen) Filmhistorie zu erlangen. Publikationen stellen im neuen Selbstverständnis der Filmarchive einen wesentlichen Pfeiler dar, der auch einen nicht zu unterschätzenden Renommeegewinn für die jeweilige Institution darstellt. So ist es durchaus sinnvoll, Mitarbeiter zur Arbeit an weiterführenden Publikationen – etwa in Fachzeitschriften – zu ermutigen und sie in dieser Hinsicht besonders zu unterstützen. Die Vermittlerfunktion des filmwissenschaftlichen Archivars zwischen Material und Benutzer gewinnt durch den Aspekt der Publikation eine zusätzliche Facette: Durch eigene Rechercheprozesse können Benutzerwünsche noch besser nachvollzogen und effektiver unterstützt werden. Diese offenere Form der Unterstützung von Forschungsvorhaben geht konform mit der Ausbildung von Kompetenzzentren und wissenschaftlichen Abteilungen, die abseits von klassischen Dokumentationsaufgaben auch die Gelegenheit zur eigenständigen Forschungstätigkeit und Partizipation an Lehrveranstaltungen der benachbarten Universitäten haben sollten: Nur durch gemeinsames Gestalten eines integrativen Zugangs, in dem medienpädagogische und fachspezifische Zugänge sinnvoll verbunden werden können, kann auch eine fruchtbare Auseinandersetzung mit den audio-visuellen Medien stattfinden (Krucsay, 1998).