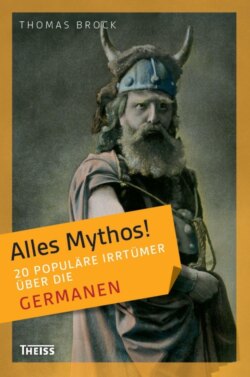Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Germanen - Thomas Brock - Страница 8
Erfinder oder Entdecker
Оглавление„Germanien“, so nannte erstmals der römische Feldherr Gaius Iulius Caesar das Land zwischen Rhein, Weichsel und Donau. „Germanen“, so nannte er all die Menschen, die es besiedelten. Genauso, wie die antiken Historiker in den zweihundert Jahren danach auch.
Es war wohl das Jahr 51 v. Chr., als Caesar die Bezeichnung schuf, oder sagen wir besser, in die Welt setzte. Er hatte von 58–52 Gallien erobert und war bei den unzähligen militärischen Operationen in Frankreich, Belgien und am Rhein auf Stämme gestoßen, die er nicht zu den Kelten oder Galliern zählen wollte. In seinem Bericht von dem Krieg „Commentarii de bello Gallico“ (Über den gallischen Krieg) widmete er ihnen zwei Exkurse.
Niemand bei ihnen besitze Land, schrieb der Feldherr, sondern dieses werde jährlich von der Stammesleitung neu zugewiesen. Außer im Krieg gebe es keine gemeinsame Regierung. Recht und Streitfälle schlichten die „führenden Männer der einzelnen Gaue“. Raubzüge, so schrieb Caesar, seien häufig und keine Schande – vielmehr hielten sie die Jugend vom Müßiggang ab: „Ihr ganzes Leben besteht aus Jagen und militärischen Übungen: Von klein auf streben sie danach, Härte und Anstrengung zu ertragen.“ Von den Galliern, so notierte Caesar, unterschieden sich die Germanen vor allem dadurch, dass sie keine Druiden haben, wenig Ackerbau betrieben und sich zum größten Teil von Käse, Milch und Fleisch ernährten.
Rechts des Rheins nannte Caesar als germanische Stämme unter anderen die Haruden, Markomannen, Sedusier, Ubier, Cherusker sowie Sugambrer. Einige, wie die Triboker, Vangionen und Nemeter seien einstmals keltisch gewesen. Nur wenige, wie die Ubier, seien aufgrund ihres Kontaktes mit Händlern zivilisierter als die übrigen germanischen Stämme. Sie hätten gallische Sitten angenommen und besäßen städtische Ansiedlungen.
Andere Stämme wären einst wegen der Fruchtbarkeit des Bodens von der rechten Rheinseite in das Land der Gallier gekommen. So stammen etwa die meisten Belger von Germanen ab, die die Gallier vertrieben hätten. Dazu zählte Caesar auch Reste der Kimbern, Teutonen, Ambronen aber auch die Condrusen, Eburonen, Caeroser, Caemanen und Segner. Einige, wie die Atuatuker, sollen gerade einmal 6.000 Menschen umfasst haben.
Manch einer dieser Stämme verschwand schon bald wieder: Die Eburonen, die bedeutendsten linksrheinischen Germanen, hatte Caesar gleich nach ihrem ersten Auftritt in der Geschichtsschreibung, 53 v. Chr., bis auf geringe Reste vernichtet, ebenso die Usipeter und Tenkterer. Die Sedusier, Caeroser, Caemanen und weitere tauchen in der Geschichtsschreibung nicht wieder auf. Den Sugambrern war wenigstens noch eine Lebensdauer bis um 8 v. Chr. beschieden, dann siedelte man sie auf die linke Seite des Rheines um und sie gingen in der provinzialrömischen Bevölkerung auf.
Andere, wie die Cherusker und Markomannen, die Caesar nur beiläufig erwähnte, standen erst am Anfang eines langen und ereignisreichen Weges durch die Geschichte. Die Sueben waren die ersten Germanen, auf die Caesar stieß. In seinem vierten Buch beschrieb der Feldherr den Stamm ausführlich: „Er soll aus 100 Gauen bestehen, deren jeder jährlich jeweils ein Heer von 1000 Mann aufstellt, um außerhalb ihres Gebietes in den Krieg zu ziehen. Der Rest, der in der Heimat bleibt, sorgt für die Ernährung der Gemeinschaft. Im nächsten Jahr stehen diese wieder ihrerseits unter Waffen, und die anderen bleiben zu Hause.“
Unter ihrem „König“ Ariovist, ein Titel, der ihm von den Römern verliehen worden war, hatten die Sueben sich um 72 v. Chr. in Gallien als Söldner der Haeduer gegen die Arverner und Sequanern verdingt. Zuerst waren es 15.000. Nach und nach kamen weitere Stammesangehörige über den Rhein, so dass sie im Jahre 58 bereits 120.000 waren. Schließlich hätten sie alle Gallier bei Magetobriga 61 v. Chr. geschlagen und unterworfen.
Es war der Haeduer Diviciacus, der Caesar diese Klage im Namen aller Gallier im Jahre 58 v. Chr. in einer geheimen Versammlung vortrug. Ein Drittel ihres Landes hätten die Sequaner freimachen müssen und Ariovist hätte alle ihre Städte in seine Gewalt gebracht. Ariovist regiere grausam und jähzornig, klagte der Haeduer. Er verlange ständig neue Geiseln, die er foltere. Gerade sollten die Sequaner ein Drittel ihres Gebietes freimachen um Platz für 24.000 neu eingetroffene Haruden zu schaffen.
Um den 14.9.58 v. Chr. schlug Caesar den Germanenkönig vermutlich in der Nähe von Mühlhausen. Ariovist konnte sich, wie wenige andere Germanen auch, über den Rhein retten. Seine beiden Frauen, eine Suebin und eine Norikerin, sowie eine seiner Töchter wurden getötet. Ariovist starb spätestens 54 v. Chr.
Viele hatten unter den Sueben zu leiden. Nur die Ubier konnten sie nicht aus ihrem Siedlungsgebiet am Rhein vertreiben. Jahrelang hatten sie etwa die Usipeter und Tenkterer mit Krieg überzogen. Nach dreijähriger Wanderung hatten schließlich auch diese im Jahr 55 v. Chr. den Rhein nahe der Mündung in die Nordsee überschritten und ihre Streifzüge auf das Land um den Fluss Maas ausgedehnt.
Caesar schlug die Bitte der Usipeter und Tenkterer nach Siedlungsland aus, nutzte einen Vorwand, überrumpelte zuerst die Krieger und dann auch die Frauen und Kinder am Niederrhein. Die Masse floh zum Rhein. Ein Teil von ihnen wurde schon in der Schlacht getötet, ein anderer auf der Flucht, die Übrigen fanden den Tod, als sie sich unweit der Einmündung der Maas in die Fluten stürzten.
Die meisten der 430.000 Usipeter und Tenkterer kamen so ums Leben. Lediglich ein Teil der Reiterei konnte sich in das Gebiet der Sugambrer absetzen. Caesar ließ in nur zehn Tagen eine Brücke ins Land der Germanen bauen und sugambrische Dörfer und Gehöfte in Brand setzen.
53 v. Chr., dem sechsten Jahr der gallischen Kriege, traf Caesar ein letztes Mal auf Germanen. Sugambrer plünderten das verwüstete Land der Eburonen und versuchten ein römisches Lager anzugreifen. Im selben Jahr schickten die Sueben noch einmal ihre Männer über den Rhein, diesmal als Hilfstruppen für die Treverer.
Der Feldherr baute eine zweite Brücke, die, etwas oberhalb der ersten, in das Gebiet der Ubier führte. Doch die Sueben waren aus den angrenzenden Landstrichen gewichen. Caesar zog sich nach Gallien zurück. Die Brücke ließ er, bis auf Reste, die als Mahnmal dienen sollten, abreißen. 51 oder 50 vor Christi Geburt veröffentlichte er die „Commentarii de bello Gallico.“