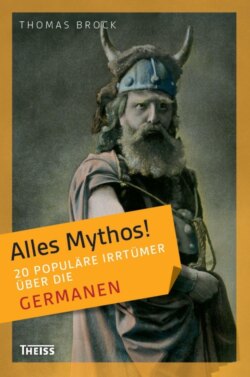Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Germanen - Thomas Brock - Страница 9
Eine frühe Ethnographie
ОглавлениеWas Caesar da eigentlich entdeckt hatte, ist heute noch umstritten. Manche seiner Passagen wirken schon auf den ersten Blick kurios. Archäologen konnten den antiken Feldherrn so manches Mal Lügen strafen. Manche Textstelle stammt nicht einmal aus seiner Feder. So ist beispielsweise das gesamte 8. Buch von Aulus Hirtus Pansa, einem politischen Weggefährten Caesars, geschrieben worden. Andere Passagen der heutigen Commentarii stehen im Verdacht, nachträglich verändert worden zu sein. Der dänische Altphilologe Allan A. Lund meinte sogar, das gesamte Volk der Germanen sei mehr oder weniger eine Erfindung des römischen Feldherrn gewesen.
Entdecker oder Erfinder – was war der Feldherr? Als Caesar seinen Bericht über die Eroberung Galliens verfasste, hatte er natürlich großes Interesse daran, seine Feldherrenschaft in Gallien möglichst positiv darzustellen. Im Jahr 50 v. Chr. standen in Rom Konsulatswahlen an und Caesar war innenpolitisch umstritten. Sicherlich war er kein neutraler Kriegsberichterstatter. Schon der römische Politiker Asinius Pollio, ein Freund des Feldherrn, bemängelte, dass Caesars Commentarii zu ungenau und zu wenig wahrhaftig seien. Der Feldherr hätte sich bei der Abfassung leichtgläubig auf Gewährsmänner verlassen und er hätte sein Buch gewiss korrigiert, wenn er nur genügend Zeit dafür gehabt hätte. Pollio rügte vor allem sachliche Ungenauigkeiten, die durch ungenügende Recherche und Quellenprüfung entstanden seien.
Gelehrte wie Gerold Walser haben in den 1950er Jahren Caesars Berichten die ethnographische Aussagekraft fast vollständig abgesprochen. Ihm zu Folge stützte sich die Beschreibung der Germanen nicht auf Caesars eigene Beobachtungen, sondern lehnte sich an vorhandene Klischees über die Nordvölker an. Caesars Germanenbild sei „von der politischen Tendenz geformt“ die Aggression der Germanen nachzuweisen, um so einen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Caesar, so urteilte Walser, stellte aus propagandistischen Zwecken den Rhein als Völkerscheide dar.
Sollten die Germanen, Ariovist, die Sueben, alles das, eine Lüge Caesars gewesen sein? Gab es da östlich des Rheins wirklich ein neuartiges Volk? Oder nicht? Nannten sie sich Germanen? Oder nicht? Oder hatte der Feldherr, trotz aller Zweifel an den Details seines Berichtes, tatsächlich in groben Zügen etwas erkannt, was vor ihm noch keiner erkennen konnte: Dass da im europäischen Norden noch ganz andere Völker lebten als Gallier und Kelten.
Sicher ist, dass vor Caesar der Name Germanen für eine größere Volksgruppe nördlich der Alpen in den Schriftquellen nicht vorkommt. Das aber ist einfach zu erklären: Kaum ein Römer und Grieche hatte diese Gegend zuvor bereist. Immerhin war Caesar nach Pytheas der erste, der das Land östlich des Rheins betreten hatte und davon berichtete.
Er hatte selbst in den Jahren 55 und 53 v. Chr. Fuß auf seine Rheinbrücken gesetzt. Und niemals zuvor hatten so viele Römer das Land der Barbaren gesehen, wie zur Zeit der gallischen Kriege Caesars. Damit gab es reichlich Zeugen der Ereignisse, die grobe Fälschungen widerlegen hätten können, so dass Caesar nicht willkürlich lügen konnte.
Vor allem eines könnte den Römern in den 50er Jahren vor Christi Geburt bei den Menschen am Rhein aufgefallen sein: Dass sie anders sprachen als Gallier, Römer und andere bekannte Völker. So betonte Caesar ausdrücklich, dass der Germanenkönig Ariovist nicht nur germanisch spräche, sondern darüber hinaus auch das Gallische erlernt hätte.
Über die Sprache definiert auch die Sprachwissenschaft die Germanen – zwar als Sprachgemeinschaft, nicht jedoch als Volksgemeinschaft. Als Ur-Germanisch bezeichnen sie diese. Sie soll sich aus dem Indoeuropäischen gebildet haben, als „p“ zu „v“, „k“ zu „ch“ und „t“ zu „th“ wurden. Statt „Pater“ sagte man „Vater“. Diese so genannte 1. germanische Lautverschiebung ist durch den Begründer der historisch-vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft Franz Bopp in seinem Werk „Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache“ beschrieben worden. Sie soll sich, der heute gängigen Lehrmeinung zufolge, vor ca. 1000 v. Chr. bis 500 v. Chr., möglicherweise in Norddeutschland und Dänemark vollzogen haben.
Einer jüngeren Untersuchung der Sprachwissenschaftler Konrad Badenheuer und Wolfgang Euler zufolge könnte sich die Lautverschiebung aber weit später vollzogen haben. Denn die Kimbern und Teutonen werden von den antiken Historikern als „cimbri teutonique“ wiedergegeben. Hätte die erste Lautverschiebung sich zur Zeit ihrer Wanderung vollzogen, wären sie als „chimbri theudonique“ bezeichnet worden. Möglicherweise entstammte ihr Name einem späten Prägermanisch und erst nach der Kimbernwanderung setzte sich die neue Sprechweise durch. Demzufolge vollzog sich die Lautverschiebung kurz bevor Caesar die Germanen „entdeckte“.
So ganz unrecht scheint der Feldherr wohl nicht gehabt zu haben. Auch die Archäologie scheint Caesar in Teilen Recht zu geben. Im Verlauf der jüngeren vorrömischen Eisenzeit vollzieht sich auf den Friedhöfen, die Hauptquelle für jene Zeit, ein auffallender Wandel. Besonders gegen Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, als Kimbern und Teutonen nach Süden zogen, änderten sich die Bestattungsweisen. Einige Friedhöfe wurden um das Jahr 100 v. Chr. aufgelassen, neue wurden angelegt. Die Familienareale wurden aufgegeben, Kinder vom Begräbnis ausgeschlossen und verstorbenen Männern Waffen in die Gräber gelegt. Bestimmte Typen an Grabbeigaben und Bestattungssitten breiteten sich in den Jahrzehnten unmittelbar vor Caesars Gallischen Kriegen von östlich der Elbe über Mittelgebirge, Rheinland bis ins heutige Frankreich aus. Ein Zusammenhang mit der von Caesar geschilderten Suebenwanderung liegt in diesem Fall auf der Hand.
Einen weiteren Hinweis darauf, dass die Bezeichnung Germanen jung war, liefert Publius Cornelius Tacitus mit seinem – in der Forschung so genannten – „Namenssatz“. Ihm zu Folge wäre die Bezeichnung Germanen erst wenige Jahrzehnte vor Caesar entstanden und allmählich auf alle Stämme und Völker rechts des Rheins übergegangen. Tacitus schrieb:
„Die Bezeichnung Germanien sei übrigens neu und erst vor einiger Zeit aufgekommen. Denn die ersten, die den Rhein überschritten und die Gallier vertrieben hätten, die jetzigen Tungrer, seien damals Germanen genannt worden. So habe der Name eines Stammes, nicht eines ganzen Volkes, allmählich weite Geltung erlangt: zuerst wurden alle nach dem Sieger, aus Furcht vor ihm, als Germanen bezeichnet, bald aber nannten auch sie selbst sich so, nachdem der Name einmal aufgekommen war.“
Was „Germanen“ überhaupt heißt, hat sich bis heute einer schlüssigen Deutung entzogen. Eine häufig erwogene, vorwissenschaftliche Deutung war es, die „Ger-Mannen“ als die „Speer-Träger“, aufzufassen. Dagegen spricht aber, dass der „Ger“ (Speer) in dieser Zeit „gaisaz“ hieß. Einer anderen populären Leseweise folgt Strabon, der schrieb: „Deshalb haben, glaube ich, die Römer ihnen diesen Namen gegeben, weil sie sie die ‚echten‘ Gallier nennen wollten. Denn in der Sprache der Römer bedeutet ‚Germanen‘ ‚die Echten‘.“ Eine andere Ableitung ist: die „einen Zaun hegen“, also Leute einer Hegung, eines „Dings“ seien. Doch Wanderzüge, Kriege oder politische Veränderungen ließen damals schnell viele neuen Namen entstehen. Diese konnten auf den oft positiv belegten Eigenbezeichnungen (die Starken, Großherzigen, Freien) beruhen oder auf negativ-besetzten Fremdbezeichnungen (die Unverständlichen, Trägen, Bösen). Die Lebensdauer solcher Namenszuweisungen war nicht selten kurz. Der Begriff Germanen blieb.