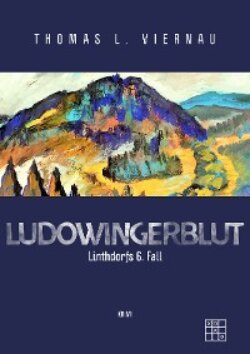Читать книгу Ludowingerblut - Thomas L. Viernau - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVeritas et reverie
Veritas et reverie quis potest dicere
Quod verum est somnium,
et quod Verbum quod scriptum
est semper verum.
Saltem ut’quam sempere a dictur.
Wahrheit und Träumerei,
Wer kann sagen, ob ein Traum immer wahr ist.
Das geschriebene Wort ist immer wahr,
so wird es jedenfalls immer gesagt.
Aus den Aufzeichnungen des Kaplans Berthold, Chronist des edlen Grafen Otto von Botenlauben
Caput Primum
Frühsommer, Anno Domini 1235
Castrum Novum, Civitas Slusungen,
Grafschaft Henneberg im Thüringerland
Hoerstu, friunt, den wwvvahter an der zinnen
wvves siîn sanc verjach?.?
wir müuezen unsich scheiden, lieber man.
alsôo schiet dîin liîp ze jungest hinnen,
dôo der tac uûf brach
und uns diu naht soô vlueühtecliîche entran.
naht giît senfte, wêvve tuot tac.
ovvewê, herzeliep, in mac
dîin nuû verbergen nieht:
uns nimt der froöiden vil daz gravvâwe lieht.
stant ûuf, ritter!
Hörst du, Liebster, den Wächter auf der Zinne
und was sein Lied verkündet hat?
Wir müssen Abschied voneinander nehmen, lieber Freund.
Genauso musstest du vor kurzem fortgehen, als der Tag anbrach
und die Nacht uns so schnell zerronnen war.
Die Nacht schenkt Angenehmes, der Tag bringt Leid.
Ach, Herzallerliebster, ich kann dich nun nicht länger verbergen.
Das Morgengrauen nimmt uns unser ganzes Glück.
Steh auf, Ritter!
Otto von Botenlauben, Codex Manesse , um 1300, Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen aus »Deutsche Gedichte des Mittelalters«, ausgewählt und übersetzt und erläutert von Ulrich Müller u. Gerlinde Weiss, 1993
Die Begräbnisfeierlichkeiten für Jutta von Thüringen waren vorüber. Alle Gäste hatten sich noch einmal im Großen Festsaal der Burg versammelt. Graf Poppo war in eine tiefe Trauer gefallen, stierte nur auf seinen großen Becher, der unberührt vor ihm stand. Seine Bediensteten waren allesamt etwas unsicher, ob sie ihm dennoch von den zahlreichen Speisen etwas antragen sollten. Die Gäste jedenfalls langten beherzt zu. Direkt an der linken Seite des Grafen saß Otto von Botenlauben in seinem leuchtend blauen Gewand. Auf der rechten Seite waren die direkten Verwandten Juttas versammelt.
Ganz oben, direkt neben dem trauernden Witwer, saß der Ludowinger Heinrich Raspe, der anstatt seines unmündigen Neffen als Landgraf auftrat. Er war ein nachdenklicher, stiller Mann mit dunklen Augen und dichtem Haupthaar. Sein aus edlem, rotgoldenem Tuch gewebtes Gewand umhüllte ihn vorteilhaft. Heinrich Raspe war kein Hüne, eher ein schmaler, fast unauffälliger Vertreter seines Hauses. Die meisten Ludowinger waren große, kräftige Kriegernaturen, deren Auftritt schon auf ihre exponierte Stellung hinwies.
Ludwig IV. war so ein hünenhafter Held, auch sein Vater, Hermann I., war ein großer, stämmiger Mann, ebenso sein Oheim, Ludwig III., der auch als Kreuzfahrer gestorben war.
konrad Raspe
von Thueringen
Heinrich Raspes Bruder, Konrad, der mit zum Gefolge der Ludowinger gehörte und gleichberechtigt mit ihm den Titel Landgraf führte, überragte Heinrich fast um Haupteslänge. Beide galten als Hoffnungsträger der Landgrafschaft. Ihr minderjähriger Neffe, der eigentliche Landgraf Herrmann II., war ein kränkliches Bürschchen, der den Weg von seiner Residenz Creuzburg an der Werra nach Slusungen nicht angetreten hatte.
Die beiden Ludowinger hatten stets zu ihrer älteren Schwester Jutta ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Beide waren Anfang Dreißig und hatten die Streitigkeiten ihres älteren Bruders Ludwig mit ihr nicht gut geheißen. Sie waren damals jedoch einfach noch zu jung, um wirklich dagegen zu intervenieren.
Natürlich wussten sie schon lange Bescheid über die lang währenden Unstimmigkeiten zwischen Jutta und Ludwig, die in einen kriegerischen Überfall des ehrgeizigen Ludwig auf das von den Wettinern beherrschte Erzbistum Meißen mündeten und dessen unglücklicher Ausgang letztendlich Ludwigs Teilnahme am Kreuzzug nach sich zog.
Konrad von Marburg, ein finster dreinblickender, religiöser Fanatiker, der lange auch Vormund der früh verstorbenen Gattin Ludwigs, der berühmten Elisabeth von Ungarn, war, drängte ihn im Namen des Stauferkaisers und des Papstes dazu. Deren Unterstützung bei Ludwigs ehrgeizigen Expansionsbestrebungen Richtung Osten war wichtig. Ohne tatkräftige und finanzielle Hilfe waren die Pläne des Landgrafen nicht durchführbar.
Doch Ludwig starb viel zu früh in Sizilien kurz vor der Überfahrt ins Heilige Land. Er wurde gerade einmal siebenundzwanzig Jahre alt. Unter was für Umständen der Landgraf genau dahin schied, blieb vielen ein Geheimnis. Es gab das Gerücht, dass die Pest auf den Schiffen der Kreuzfahrer gewütet habe.
Auch ruchloser Mord kam als Todesursache in Frage. Ludwig hatte gewiss viele Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten. Von den Rückkehrern des letzten Kreuzzugs kamen sehr widersprüchliche Angaben über seinen Tod.
Graf Otto von
Henneberg-Botenlauben
Auch Graf Otto von Botenlauben war auf Kreuzzug im Heiligen Land, bereits vierzig Jahre früher, noch mit dem Onkel des letzten Ludwig, Landgraf Ludwig III. Damals galt es, Jerusalem zu befreien. Das hatten die vereinten Kreuzfahrer mit ihren Verbündeten vor Ort auch geschafft. Warum dennoch ein neuer Kreuzzug organisiert wurde, blieb ihm rätselhaft. Was wollten die Ritter noch erobern?
Sultan Saladin war tot. Jerusalem war in der Hand der Christen und es gab ein christliches Königreich und mehrere christliche Grafschaften im Orient, die über die heiligen Stätten wachten.
Otto schwieg, sobald die Rede auf des jungen Ludwigs unrühmliches Ende kam. Er verwies stets auf die anderen Kreuzfahrer, die im thüringischen Kontingent unter Ludwig mitgezogen waren. Viele von ihnen hatten ihre Abenteuerlust mit dem Leben bezahlen müssen. Nur wenige Ritter waren heil und gesund wiedergekommen.
Otto war als wohlhabender Mann zurückgekommen. Dazu hatte er noch eine bildhübsche und reiche Frau an seiner Seite. Gott hatte es gut gemeint mit ihm.
Sein Ansehen innerhalb des Hauses Henneberg war nach seiner Rückkehr stark gestiegen. Unter den Thüringern und Franken war er nicht mehr nur der arme Verwandte und Minnesänger, er gehörte mit zu den Henneberger Grafen, deren Urteil und Wort Gewicht hatte.
Otto von Botenlauben, Graf von Henneberg, fand sich nun in einer Reihe mit den Grafen von Gleichen, den Vögten von Weida, den Orlamünder und den Beichlinger Grafen sowie den Kevernburg-Schwarzburgern. Allesamt waren zwar den Landgrafen von Thüringen, also den Ludowingern, unterstellt, aber aufgrund ihrer starken Hausmacht und ihrer durch Heirat und Erbfolgen ständig vermehrten Einkünfte ziemlich unabhängig und ließen dies die Ludowinger auch spüren. Der Landbesitz der Ludowinger war zerstreut und ließ sich nur schwer verwalten. Überall grenzten die ludowingischen Besitztümer und Alloden an andere Grafschaften. Deren Burgen und Klöster waren denen der Ludowinger ebenbürtig und ohne ihre Zustimmung konnten die Landgrafen nichts erreichen.
Charismatische Persönlichkeiten waren glücklicherweise bei den Ludowingern die Regel und nicht die Ausnahme. So konnten sie ihre Vormachtstellung in Thüringen bewahren und ausbauen. Der plötzliche Tod des vierten Ludwigs jedoch hinterließ eine Lücke. Sein Sohn Hermann, war ein schwacher Jüngling, der meist kränkelte und die Macht seinen beiden Oheimen, Heinrich und Konrad Raspe überließ. Der gegenwärtige Landgraf war benannt nach dem Vater Ludwigs, dem listigen Taktierer und Musenfreund Hermann I., der seine Residenz, die Wartburg, zu einem Musenhof verwandelt hatte und die Staufer und Welfen vorführte wie Bären am Nasenring. Der zweite Herrmann war nur ein Schatten des Ersten. Schmerzlich spürten die Ludowinger das Machtvakuum und nannten verklärend ihren zu früh verstorbenen Landgrafen bereits Ludwig, den Heiligen.
Auch seine Witwe, Elisabeth, die sich ins Kloster Marburg zurückgezogen hatte, war an der Heiligenverklärung ihres Gatten beteiligt. Dennoch wussten alle hier Versammelten, dass Ludwig alles andere als ein Heiliger war. Der Tod seiner Halbschwester Jutta, die lange Zeit seine Widersacherin war, galt als Zäsur im Expansionsstreben der ehrgeizigen Ludowinger.
Die Landgrafen von Thüringen waren stolze Leute, stets darauf bedacht, ihre Vormachtstellung auszubauen und alle möglichen Gegenspieler um die Vorherrschaft in dem zentral gelegenen und damit strategisch wichtigen Land auf Abstand zu halten.
Die übrigen Thüringer Grafengeschlechter, ob nun die Henneberger, die Schwarzburger, die Beichlinger oder die Orlamünder mussten sich bisher mit den Ludowingern arrangieren. Ihre Vormachtstellung war seit über vier Generationen unangetastet.
Heinrich Raspe, der Bruder Ludwigs IV., hatte ebenfalls keinen Zweifel daran gelassen, wer das Sagen in Thüringen hatte.
Der schwächliche Herrmann II. wurde zwar nominell als Landgraf geführt, aber die laufenden Geschäfte besorgten Heinrich Raspe und sein Bruder Konrad Raspe. Den beiden ehrgeizigen Ludowingern wurden sogar Ambitionen nachgesagt, nach der Königskrone zu greifen.
Doch davon wollte Otto nichts mehr wissen. Ihm waren die Händel und Streitereien um Grund und Boden, sowie um Macht und Geld über. Er war inzwischen über sechzig, dankte seinem Schöpfer so alt geworden und dazu noch im Vollbesitz seiner nicht unerheblichen geistigen und physischen Kräfte zu sein.
Herrmann II.
Landgraf von Thueringen
Einer der Söhne Juttas war gestern an ihn herangetreten als der letzte Klang seiner Lyra verstummt war. Es war ein Wettiner Grafensohn, Heinrich war sein Name, und er würde wohl bald die Herrschaft über Meißen und die Lausitz antreten. Otto interessierte es nicht wirklich.
Aber der junge Wettiner hatte ein Anliegen, über das er nachdenken sollte. Er war sichtlich angetan von den Versen Ottos, fragte ihn, ob die Verse irgendwann einmal bereits niedergeschrieben worden seien.
Der junge Wettiner versuchte sich ebenfalls in der hohen Kunst der Minne und hatte bereits erste Meriten erworben.
Otto überlegte, ob der junge Meissner ihm schon einmal begegnet war. Er konnte sich nicht erinnern. Natürlich, die Sängerwettstreite waren inzwischen schon Legende. Seit dem Tod Herrmanns I. war es ruhig geworden um die berühmten Minnesänger. Möglicherweise waren damals vor dreißig Jahren auf der Wartburg zu Eisenach auch ein paar schreibkundige Männer zugegen, die einige der vorgebrachten Lieder und Verse zu Pergament brachten.
So genau wusste er das jedoch nicht mehr. Er konnte sich jedoch noch gut an Wolfram von Eschenbachs Spott über die Schreibkundigen erinnern. Wolfram war stolz auf seine Gedächtnisleistung. Über tausend Verse konnte er ohne Stocken aufsagen. Ganze Erzählungen wie den »Parzival« oder den »Willehalm« hatte er im Kopf. Ein ungewöhnlicher Mann.
Dazu war Wolfram auch ein erprobter Turnierkämpfer, der mit dem Schwert und mit der Lanze ebenso vortrefflich umgehen konnte wie mit den Worten.
Sein ihm ebenbürtiger Freund, Hartmann von Aue, war aus ähnlichem Holz geschnitzt. Auch Hartmann verfügte über ein geniales Gedächtnis, deklamierte den viele hundert Verse langen »Iwein« ohne Pause, sang, trank und focht wie ein furchtloser Ritter, war aber von einer geistigen Sensibilität und Denkweise wie ein Mann des Klosters.
Er und Wolfram machten sich lustig über die wenigen Ritter, die lesen und schreiben konnten. Beide waren Hünen, maßen jeweils über sechs Fuß und waren in ihrer Rüstung groß und mächtig anzusehen. Ihnen entgegenzutreten war nicht ratsam. Dennoch gab es jemanden, der sich das wagte.
Walther von der Vogelweide war so einer. Der hatte fein säuberlich seine Spottverse und seine Liebeslyrik auf diversen Pergamentrollen festgehalten. Trug er etwas vor, entrollte er vorab bedächtig seine Pergamente und deklamierte würdevoll seine wunderbaren Verse: Ek saz uf eyme steyne …
Vielleicht war es wirklich eine gute Idee, die Verse festzuhalten. Otto dachte in letzter Zeit schon öfter über den Tod nach. Was blieb von ihm, wenn er nicht mehr war?
Seine Burg hatte er den Kreuzrittern vermacht. Es war nicht mehr lange Zeit bis zum Weltuntergang. Er erinnerte sich während des Sizilienfeldzugs gegen den Normannenkönig Guillermo III., dem Nachfahren des berühmten Königs Tankred, auch den betagten Gioacchino da Fiore in seinem Kloster in den kalabrischen Bergen besucht zu haben. Er war tief beeindruckt von dem altersweisen Abt, der ihn und seine Begleiter über seine Weltsicht unterrichtet hatte und vom bevorstehenden Zeitalter des Heiligen Geistes erzählte.
Dafür müsste jedoch das gegenwärtige Zeitalter in einem großen Feuer untergehen. Viele Omen waren von den Gelehrten bereits gesichtet worden, der Untergang der alten Welt sei nahe. Es lohne nicht mehr, dieser sündigen und unchristlichen Zeit nachzutrauern und man solle sich doch eher auf das neue Zeitalter des Lichts und des Heiligen Geistes vorbereiten.
Gioacchino verwies darauf, dass bereits mehrfach der Weltuntergang prophezeit wurde, aber aufgrund der vielen Zeitrechnungen und Chroniken war es schwierig, den Zeitpunkt genauer einzukreisen. Papst Silvester II. verkündete bereits vor über zweihundert Jahren, dass die Welt zum Milleniumswechsel untergehen würde. Als dies nicht geschah, ließ er verkünden, nur dank seiner Gebete wäre die Welt verschont geblieben.
Nur dreiunddreißig Jahre später verkündete ein Benediktinermönch aufgrund einer Sonnenfinsternis erneut den Weltenuntergang. Silvester II. habe sich geirrt, nicht Christi Geburt war der Ausgangspunkt für die Zählung sondern Christi Kreuzigung …
1186 verkündete ein Astronom aus Toledo in Spanien, dass die Welt mit großem Getöse spätestens sieben Jahre später untergehen sollte. Alle Planeten wären dann im Sternbild der Waage vereint, was ein ganz sicheres Zeichen für den drohenden Weltuntergang wäre.
Wieder brachen in der ganzen Christenwelt hysterische Aufstände aus, Leute verließen die Städte, suchten Zuflucht in den unwegsamen Bergen oder gruben tiefe Höhlen. Die Paläste der Herrscher wurden vermauert und man wartete ängstlich auf die Vorboten des Untergangs, die Reiter der Apokalypse. Untergangspropheten zogen durchs Land und verkündeten mit pathetischen Worten, was passieren würde. Doch wieder geschah absolut nichts.
Skeptisch lauschte Otto den Ausführungen des alten Mannes. Gioacchino verkündete, dass höchstwahrscheinlich um 1260 der wirkliche Zeitpunkt für den Weltuntergang herangerückt sei. Dann würde das Zeitalter des Gottessohnes enden. Doch man bräuchte keine Angst zu haben, denn das Zeitalter des Lichts würde dann anbrechen, in dem der Heilige Geist regieren würde. Eine glückselige Zeit wäre das.
Wie der alte Mann auf das Jahr 1260 gekommen wäre, konnte er seinen wissbegierig lauschenden Besuchern nicht genau erklären, aber es würde sich anhand der großen Weltharmonien so ergeben. In der Offenbarung des Johannes wären alle Fakten verborgen. Otto von Botenlauben war sichtlich beeindruckt.
Er kannte die Offenbarung des Johannes. Sein Beichtvater und Kaplan Berthold hatte ihm die furchtbare Untergangsprophezeiung mehrmals vorgelesen. Überhaupt, Berthold mochte solche düsteren Geschichten.
Seine beiden Söhne waren wahrscheinlich wegen solcher Prophezeiungen ins geistliche Fach gewechselt, würden deshalb auch keine Ambitionen auf den Grafentitel haben.
Er bedauerte es jetzt, damals abgelehnt zu haben, das Lesen und das Schreiben zu erlernen. Wichtige Order hatte stets Berthold zu Pergament gebracht, ebenso die Briefe, die es galt zu verschicken. Er hatte jedes Mal voller Respekt daneben gestanden, wenn der zierliche Kaplan mit einer angespitzten Feder die seltsamen Zeichen, die Berthold Minuskeln nannte, kunstvoll aufs Pergament setzte.
In der Sammlung des Kaplans befanden sich ein paar gebundene Pergamentsammlungen, Fibuli, oder auch Bücher genannt, die wundersame Geschichten bewahrten. Auf eine war der Kaplan sehr stolz, er hatte Otto daraus in jungen Jahren vorgelesen.
Es war die Geschichte eines alten Königreichs namens Burgund, das nach vielen Schicksalsschlägen unterging. Darin waren Helden, die gegen Drachen kämpften, die aus fernen Ländern Prinzessinnen raubten und es ging um Verrat, um Rache und Niedertracht. Berthold hatte die Handschrift von einem Reisenden erworben, der sie aus dem fernen Schwaben mitgebracht hatte. Es sei die Abschrift einer Abschrift, also nicht mehr das Original. Aber das Original wäre in einer Sprache verfasst worden, die heutzutage niemand mehr verstünde. Hoch oben im Norden soll sich vor ein paar Jahrhunderten die Geschichte zugetragen haben. Damals gab es Seepiraten, Wikinger genannt, es sollten die Vorfahren der kampfeswütigen Normannen sein, die kunstvoll miteinander verwobenene Geschichten aufschrieben und aufbewahrten. Die blutige Erzählung vom Untergang der Burgunden wurde die »Saga von den Nibelungen« genannt.
Otto ließ sich immer wieder die Saga vorlesen, grübelte über die Helden und die Kämpfe nach, die beschrieben wurden, und natürlich über das Ende des stolzen Geschlechts der Burgunder Könige. Es schien so, als ob sich die Geschichte wiederholte.
Waren die Ludowinger nicht auch ein vom Schicksal gezeichnetes Geschlecht? Zwei der besten Vertreter dieses Hauses waren bereits bei Kreuzzügen ums Leben gekommen. Der gegenwärtige Landgraf war ein Schwächling und die Feinde der Ludowinger standen schon an den Grenzen auf Habacht, zuzuschlagen, sobald sich nur eine Möglichkeit bieten würde.
Otto musste wieder an diese alte Mär denken, als er über die Zeitenläufe nachdachte. Vielleicht sollte man über alles, was er erlebt hatte, eine ähnliche Pergamentsammlung zusammenstellen. Berthold würde alles in kunstvolle Zeichen umsetzen und so der Nachwelt erhalten.
Capitulum Secundum
Spätsommer, Anno Domini 1235
Monasterio Novalis Sanctae Mariae
(Zisterzienserkloster Frauenroth) im Frankenland
Die Luft flimmerte vor Hitze. Es war einfach unerträglich heiß im diesjährigen Spätsommer. Otto von Botenlauben saß mit seiner Frau Beatrix, einer zierlichen Französin aus dem edlen Haus der Seigneure von Courtenay, unter dem Laubdach des Klostergartens von Frauenroth.
Alles machte noch einen provisorischen Eindruck. Erst vor vier Jahren hatte Otto das Kloster gründen lassen. Noch waren die Gebäude in einem eher unfertigen als funktionsfähigen Zustand. Dennoch war absehbar, dass dieser Ort eine wirkliche Investition für die Zukunft sein sollte. Ottos Vermächtnis an die Nachwelt sollte es werden. Er wollte als gottesfürchtiger Mann in der Erinnerung bewahrt bleiben.
Seine Zeit als Minnesänger und seine Abenteuer als Kreuzfahrer waren in seinen Augen nicht wert, der Nachwelt von ihm zu künden. Eine Klostergründung jedoch würde sein Andenken bestens bewahren.
Beatrix, die schon die Fünfzig überschritten hatte, aber immer noch einen Glanz ihrer Schönheit aus Jugendtagen bewahren konnte, musste lächeln, wenn sie ihren Gatten über seine Visionen reden hörte.
Nein, sicherlich war eine Klostergründung etwas durchaus Ehrenwertes. Aber sie liebte ihn nicht wegen seiner Frömmigkeit, sondern wegen seiner sensiblen Verse und Gesänge. Damit hatte er sie damals vor mehr als dreißig Jahren überrascht.
Ein Kreuzritter in voller Rüstung, der vor ihr niederkniete und ihr ein Lied vortrug, in dem er ihr indirekt einen Antrag machte. So etwas hatte sie nicht erwartet. Ein wallonischer Ritter aus dem Gefolge ihres Vaters, des Seneschalls de Courtenay, übersetzte ihr die kunstvollen Verse ins Französische und sie war entzückt.
Als Otto seinen prächtigen Helm abnahm, war sie es noch mehr. Ein junger Ritter stand da plötzlich vor ihr und sah sie mit leuchtend blauen Augen an.
Dieses Bild hatte sie verinnerlicht und sie folgte ihm nur allzu willig ins ferne, kalte Thüringen, von dem sie nichts weiter wusste, als das dort wilde Tiere in dunklen Wäldern hausten und es dauernd Fehden und Scharmützel gab.
Sie hatte ihren Gatten schon lange gedrängt, seine Versdichtungen aufschreiben zu lassen. Kaplan Berthold, der ihnen nahestand und sich um alles kümmerte, was mit Schriften und Verträgen zu tun hatte, wäre sicherlich der geeignete Mann dafür.
Bisher hatte Otto stets abgewunken, doch nach seiner Rückkehr vom Begräbnis Juttas in Slusungen gab es bei ihm ein Umdenken. Er hatte Berthold rufen lassen.
Der Kaplan, ein ernsthafter Mann, dessen Antlitz keinerlei Regung zeigte, kam gemessenen Schrittes herangetrippelt, darauf bedacht, nicht auf seine etwas zu lang geratene Soutane zu treten.
Beatrix musste stets lächeln, wenn sie ihn sah. Berthold hatte etwas Würdiges und gleichzeitig etwas Kauziges in seinem Benehmen.
Seine grünen Augen leuchteten auf, als Otto ihm erläuterte, was er vorhatte. Ja, das war so wirklich nach seinem Gusto. Berthold hatte ähnlich wie Beatrix schon lange vor, als Chronist von den vielen wundersamen Ereignissen in seinem Leben zu berichten und alles für die Nachwelt in eine große Form zu bringen. Auch er war vom nahen Weltuntergang beeindruckt und wollte so viel wie möglich den wenigen Überlebenden hinterlassen, die es schafften, den Transit ins neue Zeitalter zu überleben.
Ob es nun die vornehme Welt der Ludowinger oder der Henneberger betraf, oder die aufregende Zeit auf der Wartburg, als sich vor nunmehr dreißig Jahren alle wichtigen Dichter und Sänger am Hofe des damaligen Landgrafen Hermann versammelten, oder die Reisen seines Herrn nach Sizilien und in den Orient, alles erschien Berthold berichtenswert.
Otto hatte sich bereits in Gedanken mit dem Textwerk auseinandergesetzt. Seine besten Minneverse sollten als Erstes aufgeschrieben werden. Er hatte Angst, sie zu vergessen. Im Laufe der Jahre hatte er immer wieder an den Versen gefeilt und teilweise ganze Wortgruppen ausgetauscht bis sie letztendlich das waren, was er sich unter einem wirklich harmonischen Versmaß vorstellte. In Gedanken verglich er sich dabei immer mit dem außergewöhnlichen Walther von der Vogelweide, dessen Kunst eine unbestreitbare Höhe und Vollkommenheit erreicht hatte.
Alle verfielen in eine andächtige Ruhe, wenn Walther seine Lieder deklamierte, dabei sparsam mit der Lyra Klänge erzeugte, die den Text noch verstärkten. Ihm war es auch so ergangen, als er den eher unscheinbaren Ritter aus der fernen Ostmark das erste Mal erlebte. Walther trug ein Lied* vor, dessen Einfachheit und Schönheit ihn sofort in seinen Bann zog:
Unter den Linden bei der Heide, wo unser zweier Bett gemacht. Da mögt ihr finden, wie wir beide pflückten im Grase der Blumen Pracht. Vor dem Wald im tiefen Tal, Tandaradei! Lieblich sang die Nachtigall.
Ich kam gegangen hin zur Aue, mein Trauter harrte schon am Ort. Wie ward ich empfangen, oh Himmelsfraue! Des bin ich selig immerfort. Ob er mich küsste? Wohl manche Stund, Tandaradei! Seht, wie ist so rot mein Mund.
Da tat er machen uns ein Bette aus Blumen mannigfaltig und bunt. Da wird lachen, wer an der Stätte Vorüberkommt, aus Herzensgrund. Er wird sehn im Rosenhag‘, Tandaradei! Sehen, wo das Haupt mir lag!
Wie ich da ruhte, wenn man es wüsste. Barmherziger Gott – ich schämte mich. Wie mich der Gute herzte und küsste, keiner erfahr es als er und ich, und ein kleines Vögelein. Tandaradei! Das wird wohl verschwiegen sein!
*(ins Hochdeutsche übertragen
von Richard Zoozmann)
WW
Ualther
von der VVVUogelvveide
Als Otto später noch einmal mit Walther über dieses Lied diskutierte, winkte der nur lächelnd ab. In seiner großen Pergamentsammlung, auf denen in kunstvollen Minuskeln alle seine Lieder und Verse aufgeschrieben waren, hatte er auch ein paar Blätter mit Gedichten, die sich mit den Zuständen am Hofe auseinandersetzten.
Walther lächelte spitzbübisch, als er diese deklamierte. Otto spürte sofort, was für ein Affront diese Lieder waren. Walthers Verse waren scharfzüngig, richteten sich vor allem gegen die Scheinheiligkeit der Päpste und Kirchenfürsten, aber auch weltliche Herren bekamen ihren Teil ab. Er machte sich über sie lustig, stellte ihren Geiz und Hochmut zur Schau und ließ kein gutes Haar an ihnen. Ob sie ihn nicht entsprechend seines Könnens entlohnt hatten?
Otto war verwirrt. Konnte ein Mann solch wunderbare Liebeslyrik schreiben und gleichzeitig so ätzende Verse und Spottlieder auf die Welt der Edlen und Ritter, von der er letztendlich ebenfalls ganz gut lebte?
Er jedenfalls zog es vor, mit Walther von der Vogelweide auf respektvollen Umgang zu achten. Zu groß war die Bewunderung für sein Können. Was aus ihm wohl geworden war?
Es wurde erzählt, er sei zu Würzburg vor ein paar Jahren gestorben. Der Kaiser hätte ihm wohl ein Lehen übertragen, so dass er endlich frei von Sorgen seinen Lebensabend genießen konnte.
Am Thüringer Hof auf der Wartburg hatte Walther von der Vogelweide einen schweren Stand. Dort gaben Wolfram von Eschenbach und Hartmann von Aue den Ton an. Große Heldenepen waren gefragt und nicht die feine Lyrik und Spottverse eines Mannes wie Walther von der Vogelweide.
Nein, auch Otto konnte mit keinem Heldenepos für sich punkten. Zu komplex und zu langatmig waren solche Großkunstwerke. Er war nicht ein solches Gedächtnisgenie wie die beiden Meister dieses Fachs.
Hermann gab höchstpersönlich neue Heldenepen in Auftrag. Er schwelgte in diesen Ritterwelten, die mit der tristen Realität nicht viel zu tun hatten. Es war wohl mehr eine Flucht aus dem Alltag aus Intrigen und Fehden. Die Helden der Ritterepen waren edel und gut. Sie kämpften gegen das Böse und gewannen immer. Was war jedoch in der heutigen Welt das Böse?
Welche der beiden Kaiserparteien waren die Bösen?
Die Staufer mit ihren kampfeswütigen Männern oder die listigen und verschlagenen Welfen?
War der Papst im fernen Rom wirklich der Vertreter Gottes auf Erden oder ebenfalls nur ein gieriger und bösartiger Mann?
Und was war mit den vielen Grafen, die in Thüringen nur darauf lauerten, dass die Ludowinger schwächelten?
Die Kevernburg-Schwarzburger, die Vögte von Weida, die Beichlinger und Orlamünder und die Grafen von Gleichen verfolgten allesamt eigene Ziele, nicht zu vergessen seine eigenen Leute, die Henneberger. Waren sie deshalb böse?
Otto zweifelte an sich, wenn er darüber nachdachte. Gehörte er als Henneberger auch mit zu den Bösen?
Doch wer waren dann die Guten?
Seine Minnelieder und Verse wurden geschätzt und geliebt. Es gab genügend Publikum für seine Dichtkunst. Sein Name wurde mit genannt, wenn es um die feine Kunst des Dichtens ging. Sowohl am Hofe der Henneberger, als auch bei den übrigen Thüringer Grafen war er stets ein gern gesehener Gast. Sicherlich ein Hinweis darauf, dass er nicht zu den finsteren Gestalten des Bösen zählte.
Capitulum Tertium
Wintersonnenwende, Anno Domini 1235
Burg Gleichen, Thüringerland
Wenn man, von Erfurt kommend, sich der Herrnhuter-Colonie Neudietendorf nähert, so erblickt man, scharf vom westlichen Horizont sich abhebend, drei hochragende Burgen: die thüringischen »Drei Gleichen«. Sie nehmen unter den durch die Traditionen der Geschichte und Sage ausgezeichneten Schlössern des Thüringer Berglandes einen hohen Rang ein, und mit Recht – denn ihre Geschichte ist nicht allein ein gut Stück thüringischer – sondern auch deutscher Geschichte überhaupt. Auf dem Boden, auf welchem sich die »Drei Gleichen« wie Wahrzeichen erheben, wurde der Kampf zwischen den das Reich erschütternden Gegensätzen des Mittelalters ausgefochten; hier hallte der Feldruf »Hie Welf, hie Waibling!«, hier zeigt uns die Geschichte die tragische Gestalt Heinrich des Vierten, wie er im Kampf mit den rebellischen Fürsten unter der Burg Gleichen eine schwere Niederlage erleidet; hier erscheint im Bund mit den Fürsten die massive Macht der Städter auf dem Plan, und ihre Karrenbüchsen brechen den Übermut kleiner Herren; hier vor allem feiert der Feudalismus in endlosen Fehden blutige Orgien. Der Name der »Drei Gleichen«, unter dem die Burgen in ganz Deutschland bekannt sind, hat keine historische Berechtigung; denn nur der beim Flecken Wandersleben gelegenen kommt der Name Burg Gleichen zu. Die beim Dorfe Holzhausen heißt die Wachsenburg, und die dritte trägt mit dem unten liegenden Flecken Mühlberg den gleichen Namen. Wie sehr aber der engere, im gemeinsamen Namen zum Ausdruck gebrachte Zusammenhang dieser drei Burgen vom Volke empfunden wurde, darauf deutet die Sage, laut welcher ein Blitzstrahl im Jahre 1230 alle drei Burgen zugleich entzündet haben soll.
Die Thüringer »Drei Gleichen«, Artikel in der »Leipziger Illustrierten Zeitung« von Ferdinand Lindner, 1898
GrafErnst-Ludwvvig
zu Gleichen
Frost lag in der Luft und Schnee bedeckte das Land. Dunkle Wolken trieben am Himmel, bereit immer neue Schneemassen auf die Erde auszuschütten.
Auf einem einsamen Hügel thronte Burg Gleichen, in direkter Nachbarschaft zur Mühlburg und der etwas abseits stehenden Wassinburg. Alle drei Burgen beherrschten das fruchtbare Tiefland zwischen dem mainzischen Erfurt, der Villa Arnistati und der Civitas Gotharti. Burg Gleichen jedoch war die größte und mächtigste der drei Herrschaften. Sie war im Besitz der Grafen zu Gleichen, einem altehrwürdigen Geschlecht, dass seine Herkunft auf die Vögte von Erfurt, die Grafen von Tonna, einer Gegend nördlich von Erfurt, die das Eichsfeld genannt wurde, herleiten konnten.
Otto von Botenlauben war gut befreundet mit Graf Ernst Ludwig zu Gleichen. Beide hatten an dem dritten Kreuzzug von Kaiser Heinrich VI. teilgenommen. Beide waren lebendig und reich zurückgekommen. Der Gleichengraf hatte sogar eine bildhübsche Saraszenin mitgebracht, die bei ihm auf der Burg lebte. Es gab viel Gerede um die Schöne aus dem Morgenland. Neider tuschelten, dass die Schöne des Grafen Zweitfrau sei und mit seiner Erstfrau und dem Grafen zusammen ein Bett teile. Sie wäre wohl eine Sultanstochter und sogar der Papst habe die eigenwillige Dreierbeziehung gutgeheißen.
Otto musste jedes Mal schmunzeln, wenn er solche seltsamen Gerüchte zu hören bekam. Graf Ernst Ludwig zu Gleichen war bestimmt kein Kostverächter, aber hatte sich stets an den christlichen Kanon gehalten. Er trug das Kreuz auf seinem Umhang voller Bewusstsein und hielt sich an die strengen, sittlichen Vorgaben, die ein Leben als Kreuzfahrer mit sich brachten.
Es war auch wahr, dass der Gleichengraf unweit der Kreuzfahrerfestung Akkon in Gefangenschaft geraten war. Aber er wurde befreit, eingetauscht gegen andere Gefangene, so wie das im Heiligen Land üblich war. Es war ein Nehmen und Geben, man hatte sich arrangiert.
Otto kannte auch Melechsala, die orientalische Prinzessin, die jetzt auf Burg Gleichen als Thüringer Edle lebte. Melechsala war eine gebildete Frau, die fasziniert von den christlichen Rittern war und sich dem Gleichengrafen anschloss, als dieser sich nach acht Jahren im Orient zurück nach Europa einschiffte. Ihr Zuhause war zerstört worden, ihre Verwandten waren allesamt tot, sie hatte nichts mehr, was sie noch im Orient hielt.
Der Kreuzzug war beendet. Sein Ergebnis wurde auf beiden Seiten bejubelt, aber eigentlich war es eine Pattsituation, es gab keine wirklichen Sieger. Viele Ritter waren gefallen, die Verwüstungen im Heiligen Land waren immens. Alles lag im Koma, unfähig, den Kriegszug noch fortzusetzen. Wer konnte, schnürte sein Bündel und versuchte, auf einem der wenigen Schiffe einen Platz zu finden.
Der Weg zurück in die heimatlichen Gefilde war schwierig und gefährlich. Vor der Insel Cyprus warteten Seeräuber aus Edessa, entlang der griechisch-dalmatischen Küste wüteten byzantinischen Söldner und beschossen alles, was sich den schützenden Häfen näherte. Es rächte sich, dass die Kreuzfahrer vor Jahren Byzanz belagert und die stolze Stadt fast dem Erdboden gleich gemacht hatten. Die wendigen Segler der Byzantiner griffen die plumpen und überladenen Kreuzfahrer meist des Nachts an und beschossen sie mit dem berüchtigten »Griechischen Feuer«. Viele der Schiffe gingen dabei in Brand auf und versanken jämmerlich mit Mann und Maus. Nur wenige schafften es bis in den schützenden Hafen von Venedig.
Otto und Ernst Ludwig gehörten zu den Wenigen. Ihr Schiff kam zusammen mit vierzehn anderen an. Über sechzig waren wohl versenkt oder zerstört worden. Was aus ihnen geworden war, wusste niemand und wollte auch keiner wirklich wissen. Leid und Tod hatten die Überlebenden genug gesehen.
Nach weiteren acht Wochen kamen sie vollkommen entkräftet in Thüringen an. Die steilen Bergpässe bei der Alpenüberquerung und die langen Ritte durch die unter einer Dürre leidenden Ländereien der Ostmark und Bayerns hatten ihnen den letzten Rest an Energie geraubt.
Doch sie lebten, hatten gut gefüllte Taschen voller exotischer Mitbringsel und unzählige Goldmünzen, sicher eingenäht in den großen Bündeln voller Gewänder und edler Tuche. Im Gefolge der beiden Grafen waren auch die beiden Frauen, die edle Seigneurin de Courtenay, die inzwischen Ottos Ehefrau geworden war und die bildhübsche Melechsala, die des Gleichengrafen Liebe zu gewinnen trachtete.
Die beiden Männer verloren sich nach ihrer Rückkehr aus den Augen. Otto als Angehöriger des Hauses Henneberg war mehr in den südthüringischen und fränkischen Ländereien unterwegs und der Gleichengraf war als Ministeriale der Mainzer Herrschaft zu Erfurt im Norden Thüringens bis hinauf ins Eichsfeld zugange. Nun waren beide Männer ergraut und schickten ihre Söhne als Vasallen zu ihren übergeordneten Dienstherren.
Es war ein Glück für beide, nicht mehr überall vor Ort sein zu müssen. Reisen war langwierig und gefährlich. Vor ein paar Jahren war die Gleichenburg vom Blitz getroffen worden. Ein Teil der Burg brannte lichterloh. Es war ein Wunder, dass sie nicht ganz ausgebrannt war. In derselben Nacht brannten auch die beiden anderen Burgen in der direkten Nachbarschaft. Das Gewitter hatte ganze Arbeit geleistet. Wie drei Fackeln standen die Burgen in Flammen.
Die kleinere Mühlenburg, direkt gegenüber der Burg Gleichen, wurde vollständig ein Opfer der Flammen. Es lebten jedoch schon lange keine Menschen mehr dort. Sie war seit vielen Jahren schon eine Ruine.
Ebenfalls hatte es die Wassinburg unweit der Civitatis Arnistati erwischt. Sie gehörte den Orlamünder Grafen und galt als uneinnehmbar. Nun war sie erst einmal ein Haufen Trümmer. Ob sie je wieder aufgebaut würde, wusste der Gleichengraf nicht. Er hatte zu tun, die Schäden der Gewitternacht von vor fünf Jahren an seiner Burg auszubessern.
Zudem verlangte sein Dienstherr, der mainzische Vicedominus und Fürstbischof, ebenfalls nach ihm. Er hatte dessen Vertretung zu übernehmen, wenn der Fürstbischof in Mainz weilte und Erfurt keinen direkten Schutz hatte.
Überall lauerten Wegelagerer, tückische Krankheiten warteten in den meist überfüllten Herbergen und die Missionen, die es zu erfüllen galt, waren oftmals brenzlig und kompliziert. Man konnte schnell den Fehdehandschuh hingeworfen bekommen, wenn man sich nur im Ton vergriff oder ein vorschnelles Wort von sich gab.
Beide Männer saßen in bequemen Holzstühlen und tranken Wein, den der Gleichengraf in seinen Ländereien entlang der Unstrut anbauen ließ. Es war ein trinkbarer, leichter Wein, der mit ein paar Gewürzen versetzt, ein wohlschmeckendes Heißgetränk war. Speziell in der finsteren und kalten Winterszeit galt so ein Trunk als heilsames und wärmendes Labsal.
Otto war nicht von Ungefähr zur Gleichenburg aufgebrochen. Es ging ihm um die Ereignisse, die jetzt schon fast vier Dezennien zurücklagen. Er versuchte, nachzuvollziehen, was dem Tode Ludwigs III. vorausging.
Der Gleichengraf war damals in unmittelbarer Nähe des Ludowingers. Auf der Insel Cyprus waren die Kreuzfahrer zu einer Rast angelandet. Die Überfälle der Piraten von Edessa hatten den Schiffen der Kreuzfahrer arg zugesetzt. Verwundete mussten versorgt, die Toten begraben und auch die beschädigten Schiffe ausgebessert werden.
Beide wussten, dass der Ludowinger angeschlagen war. Seit Monaten klagte er schon über diverse Fieberleiden und andere Malaisen, die selbst die besten Medikusse nicht erklären konnten. Fleckfieber gab es, auch Sumpffieber und andere hierzulande unbekannte Krankheiten befielen die Männer und kein Kraut war dagegen gewachsen.
Es wurde auch gemutmaßt, dass ihn ein vergifteter Pfeil getroffen haben könnte. Ludwig war ein mutiger Ritter, der stets in vorderster Reihe focht. Aber auch die vielen Kranken und Aussätzigen, die in den orientalischen Städten vor sich hin vegetierten, könnten ihn angesteckt haben. Jedenfalls kränkelte Ludwig bereits auf der Überfahrt. Der große und kräftige Hüne verfiel zusehends, war meist bettlägerig und aß kaum noch etwas.
Landgraf
Ludvvwig III.
von Thueüringen
Otto erinnerte sich an die Tage auf der Insel Cyprus. Die Byzantiner hatten zahlreiche Burgen und Hafenbefestigungen erbaut. Der Basileios Isaak Comnenus, ein ehemals byzantinischer Vasall, hatte die Insel zu seinem Königreich erklärt. Viele Kreuzfahrer unterhielten in den Städten der Insel eigene Häuser, die von den Templern betrieben wurden. Die Insel war ein strategisch wichtiger Stützpunkt für die Kreuzfahrer. Vor allem, um die Vorräte aufzufüllen, aber auch als Schutz vor den plündernden Piraten und den schnellen Seglern der byzantinischen Herrscher, die immer noch nachtragend waren, dass ein Kreuzfahrerheer ihre Residenz Byzanz belagert und verwüstet hatte.
Die Kreuzfahrer ließen ihren Anführer Ludwig in ein Hospital der Templer bringen. Ihm ging es zunehmend schlechter. Umgeben von seinen Treuen verschied der Ludowinger nach kurzer Zeit. Von dem einst stolzen Mann war nur ein jämmerliches Häufchen Elend auf dem Totenlager übrig geblieben. Er wurde nicht einmal fünfzig Jahre alt. Alle waren erschüttert.
Kurz vor seinem Tode hatte er ein paar seiner treuesten Ritter zu sich kommen lassen. Jeder von Ihnen erhielt von Ludwig ein kleines, kunstvoll gearbeitetes Kästchen mit einem Edelstein darin. Ebenfalls hinterließ er jedem Ritter ein Pergament. Ludwig hatte noch keine Kinder als er zu seiner Kreuzfahrt aufbrach.
Sein jüngerer Bruder Herrmann jedoch war reich gesegnet mit Nachkommen. Aus seiner ersten Ehe hatte er eine Tochter, Jutta, benannt nach seiner Mutter. Jutta hatte der umtriebige Herrmann bereits im jugendlichen Alter von zwölf Jahren mit dem Meißener Markgrafen Dietrich vermählt.
Später folgten noch mit Ludwig, Heinrich Raspe und Konrad Raspe drei Söhne und mit Irmgard, Agnes und Gertrud drei weitere Töchter.
Herrmann, sollte die Landgrafschaft übernehmen. Doch Ludwig scheute wohl diesen Entschluss. Er kannte Herrmanns Charakter. Sein Bruder war kein geradliniger Mann. Er bevorzugte die Kunst des Ränkeschmiedens und Taktierens, war ein scharfsinniger Intrigant und wusste stets seinen Vorteil auszunutzen.
Ludwig hatte bei seiner Audienz am Krankenbett Otto etwas gesagt, was er lange Zeit tief in seinem Inneren versiegelt hielt. Es fiel ihm schwer, die Worte zu finden. Er bezeichnete den knapp fünfundzwanzigjährigen Otto als seinen Sohn. Otto schluckte. Meinte Ludwig das wirklich ernst?
Oder war er bereits im Delirium?
Neben Otto waren noch Ernst Ludwig, der Graf zu Gleichen und der Schwarzburger Graf Heinrich am Totenbett versammelt. Die beiden Grafen hatten ebenfalls die Worte Ludwigs vernommen. Verwundert schauten sie auf den Henneberger Grafen. Wie kam Ludwig dazu, den jungen Otto als seinen Sohn zu bezeichnen? Die drei Kreuzfahrer verließen leise das Totenbett ihres Anführers. Nachdenklich zog sich Otto zurück.
Er wollte jetzt mit dem Gleichengrafen über die letzten Worte Ludwigs sprechen, aber Ernst Ludwig schien nicht in der Laune zu sein, die Ereignisse ihrer Jugend zu bewerten. Er winkte ab.
Was der Ludowinger damit gemeint hatte, als er Otto als seinen Sohn titulierte, würde wohl in den Sternen stehen. Ottos Herkunft als Henneberger Grafensohn sei doch unzweifelhaft. Der nickte, ja, dem wäre wohl so. Die Leute seiner eigenen Familie konnte er schlecht befragen, das würde zu viel Argwohn hervorrufen.
Aber zu dem Schwarzburger Grafen könnte er noch weiterreisen. Das Haus Schwarzburg war in diverse Händel verstrickt. Die Schwarzburger taten sich schwer, die Oberherrschaft der Ludowinger als Thüringer Landgrafen anzuerkennen. Sie fühlten sich als schon viel länger im Lande ansässig und konnten ihren Stammbaum auf Vorfahren zurückführen, die mindestens schon vierhundert Jahre die Gegend zwischen Schwarzatal und Ilmtal beherrschten.
Otto als Henneberger Grafensohn hatte wenig Berührungsängste mit den Schwarzburgern, deren Herrschaftsgebiet weiter östlich in Thüringen lag. Beide Familien waren verschwägert und verwandt. Also wäre ein Besuch bei Heinrich von Schwarzburg eine letzte Chance, etwas mehr darüber zu erfahren, was der Ludowingergraf an seinem Totenbett wohl damit gemeint hatte, als er Otto als seinen Sohn titulierte.
Caput Quattuor
Silvester, Anno Domini 1235
Schwarzburg im Thüringerland
Vom Ursprung der Grafen von Schwarzburg
Viele wollen den Ursprung und die Abkunft der alten Grafen von Schwarzburg vom heiligen Günther nicht gelten lassen. Ein Verwandter und Heerführer des großen Sachsenherzogs Wittekind, genannt Wittekind der Schwarze, soll deren Ahnherr gewesen sein, ebenso jener der Grafen von Gleichen; nach andern sollen wieder jene Brüder von Gleichen, welche die Burgen bei Göttingen hatten und, von dort vertrieben, nach Thüringen kamen und Schloss Gleichen neben Mühlberg und Wachsenburg erbauten, die Stammväter der heutigen Schwarzburger Fürstenhäuser gewesen sein. Noch ein Stück höher hinauf in den nachtdunkeln Schwarzwald der Urgeschichte rückt besagter Ursprung ein dritter Chronist, nämlich bis in die Zeit, da Dietrich von Bern lebte und die Thüringer heftig mit Sachsen und Franken zu streiten kamen. Da habe ein Graf eine Kohlebaude und Meilerstätte auf einem Berge angetroffen und habe auf diesem schwarzen Berg eine Burg erbaut, siehe, da war die Schwarzburg fertig. Nach andern habe Kaiser Lothars sechster Sohn, Gundar, das ist Günther, geheißen, der habe Schloss Käfernburg bei Arnstadt erbaut, und der sei der wahre Stammvater des hohen Geschlechtes, das sich frühzeitig zur Blüte hob und durch die Reihe der Jahrhunderte fortpflanzte, berühmte Klöster gründete, auch Deutschland einen Kaiser gab. Alle Welt weiß von dem Raub der sächsischen Prinzen durch Kunz von Kaufungen, weit minder aber bekannt ist der Raub zweier junger Grafen von Schwarzburg durch Jost Hake, welcher gar ein tapferer Kriegsmann war und im Schmalkaldischen Kriege auch den Grafen Hugo von Mansfeld aus dessen eignem Schlosse zur Nachtzeit gefangen hinwegführte. Erst nach zwei Jahren gab er ihn um tausend Goldgulden wieder frei.
Deutsches Sagenbuch, von Ludwig Bechstein, 1853
Schon von weitem war das Schiefergebirge als bläulich schimmernder Streifen am Horizont zu sehen. Trotz des wenigen Lichts, das an diesem trüben Wintertag für etwas Helligkeit sorgte, waren die Konturen der Berge gut erkennbar.
Otto von Botenlauben war nur selten in dieser Gegend unterwegs. Das Schiefergebirge war ein noch dünner besiedeltes Gebiet als das Waldgebirge. Nur ein paar Schieferklopfer lebten hier, die in mühsamer Handarbeit in den versteckt liegenden Steinbrüchen große Schieferplatten zerkleinerten und zu handlichen Dachschindeln verarbeiteten. Die Schiefernschindeln waren bei den Burgherren beliebt, dienten sie doch vor allem zum Decken ihrer Burggebäude und Türme.
Graf Heinrich
von Schwvvarzburg
Je weiter man Richtung Osten ritt, desto unsicherer wurden die Wege und desto gefährlicher war es, sich dort zu bewegen. Im Land der Grafen von Kevernburg-Schwarzburg waren die Wege schmal und wenig einladend. Unwetter und viel Regen sorgten für tiefe Rinnen, die als Wasserkaskaden aus dem unwegsamen Schiefergebirge herunterflossen.
Das Schiefergebirge war ähnlich dem direkt benachbarten Waldgebirge, das nur durch das Tal der wilden Schwarza voneinander getrennt war, eine Wetterscheide.
Oftmals hingen die tiefziehenden Wolken hier fest, regneten ab, und dann, leichter geworden, schafften sie es, über den Gebirgskamm hinwegzuziehen. Nebel gehörte hier für mehr als die Hälfte des Jahres zum normalen Wetter. Er war meist so dicht und omnipräsent, dass man die normale Landschaft nur sehr selten zu sehen bekam. In der dunklen Jahreszeit war es eher ein Glücksfall, einmal den Himmel zu erblicken.
Die Schwarzburg lag auf einem Felssporn, der von hohen Bergen umgeben war. Unten im Tal schlängelte sich die Schwarza in einem großen Bogen um den langgezogenen Schieferfelsen. Sie war wohl auch namensgebend für die Burg, deren Mauern sich dem Verlauf des Felsens angepasst hatten. Die eigentliche Burganlage war dreigeteilt. Direkt hinter der Zugbrücke zur Burg standen das Torhaus und ein großer Wirtschaftshof, der sich eng an den Schieferfels schmiegte. Daran schloss sich ein mächtiger viereckiger Bergfried an. Dahinter erhob sich ein großes Gebäude, das als »Steinerne Kemenate« bezeichnet wurde und als Zeughaus diente. Es folgte die Vorburg, in der der Kastellan residierte und dann endlich die eigentliche Kernburg, die zusammen mit der Burgkapelle, dem Kornhaus und dem Haus der Burgmannschaft einen großen viereckigen Hof und den Abschluss der Anlage bildete. In der Kernburg lebte die Grafenfamilie. Die Schwarzburg galt als uneinnehmbar und war daher einer der strategisch wichtigsten Orte in ganz Thüringen. Wer sie beherrschte, war in einer bequemen Position.
Die Grafen von Schwarzburg mussten sich nicht verstecken hinter den Ludowingern und anderen Grafenhäusern. Mächtig wie die Wartburg war ihr Sitz und ehrgeizig waren die Ambitionen der Grafen. Sie sahen sich stets auf Augenhöhe mit den Ludowingern und den anderen großen Grafengeschlechtern.
Ursprünglich waren die Schwarzburger auf der nahen Kevernburg ansässig gewesen. Die Kevernburg war verglichen mit der Schwarzburg nur ein kleines Raubnest, das sich oberhalb der Civitas Arnistati (Arnstadt) befand. Ihre Wurzeln konnten sie auf die sagenhaften Sizzonen zurückführen, die bereits lange vor den Ludowingern, den Hennebergern, Beichlingern und Orlamündern über das Land herrschten. Durch Erbteilung hatte sich das Grafengeschlecht kontinuierlich ausgebreitet und diverse Lehen unter seinen Besitz gebracht.
Heinrich von Schwarzburg war auch gleichzeitig Herrscher der Grafschaft Kevernburg und kontrollierte damit die wichtigsten Handelswege, die aus Franken kommend Richtung Norden verliefen.
Otto von Botenlauben wusste das alles. Er hatte auch ein feines Gespür für die Ambitionen der Schwarzburger hinsichtlich der Vorherrschaft in Thüringen, wusste um die heimlichen Aktivitäten Heinrichs von Schwarzburg, wenn es darum ging, neue Allianzen zu schmieden, in denen auch die Henneberger eine Rolle spielen sollten. Aber Otto wusste auch um die Loyalität seiner eigenen Leute gegenüber den Ludowingern.
Die Freundschaft, die ihn nun schon seit fast vier Jahrzehnten mit Heinrich verband, war von dessen Ränkespielen bisher unbefleckt geblieben. Damals im Land der Saraszenen hatte Heinrich ihm oftmals beigestanden, wenn es brenzlig wurde und mit beherztem Mut aus der Bredouille geholfen. Heinrich von Schwarzburg galt als zuverlässiger und tapferer Ritter, dessen Wort Gewicht hatte und der es verstand, unbequeme Situationen mit kühlem Kopf und Verstand zu meistern.
Wenn jemand sein Anliegen richtig einzuschätzen wusste, dann war es eben jener Ritter. Otto war inzwischen im nebligen Tal der Schwarza angekommen und folgte dem Fluss stromaufwärts. Irgendwo musste der Weg dann steil hinauf zur Schwarzburg führen, die man dank des Nebels nur ahnen konnte. Otto weilte schon mehrfach auf der Schwarzburg, meist im Sommer, wenn auch im Schiefergebirge alles blühte und grünte. Er war beeindruckt von der Burganlage und noch mehr von dem imposanten Naturschauspiel, das sich ihm bot, wenn er den Blick über die Mauern hinab ins Tal lenkte.
Er musste daran denken mit einem wehmütigen Lächeln. Damals war er noch jung und die Welt war ihm nicht groß genug. Jetzt mühte er sich, den steilen Weg zu erklimmen, sein Atem ging hörbar zu kurz, oft musste er verweilen, um wieder Luft zu bekommen. Der kalte Nebel schmeckte nach Winter. Eine Mischung aus Rauch, vermodertem Blattwerk und feuchtem Holz, die nur in dieser Zeit in der Luft lag.
Urplötzlich tauchte das mächtige Mauerwerk der Schwarzburg vor ihm auf. Er war angekommen.
Heinrich von Schwarzburg, ein ebenfalls in die Jahre gekommener Mann, dessen Gesicht wettergegerbt war und dessen Bart eisgrau schimmerte, erhob sich mühsam aus seinem Sessel, kam langsam schlurfend Otto entgegen und begrüßte ihn wie einen alten Freund. Lange hatten sich die beiden Männer nicht mehr gesehen. Sichtlich erfreut bot Heinrich dem unerwarteten Besucher Met und Warmbier an. Dankbar trank Otto die heißen Getränke, so dass die Kälte aus seinem Körper wich. Nach dem Austausch der üblichen Höflichkeitsfloskeln fragte er schließlich Otto, was der wirkliche Grund für den Besuch sei.
Otto atmete tief durch, berichtete dem Schwarzburger von seiner Idee, alles was in seinem Leben passiert war, aufschreiben zu lassen, dazu seine Verse und Lieder aus seiner Minnesängerzeit, und letztendlich auch die Orientreise zu dokumentieren. Dabei wäre ihm noch einmal der Tod des Ludowingers aus seinem Gedächtnis hervorgeholt worden und dessen letzte Worte auf dem Totenbett. Er, also Heinrich, und der Gleichengraf Ernst Ludwig waren damals Zeugen gewesen, hätten also die letzten Worte des Ludowingers ebenfalls vernommen.
Heinrich nickte, ja, er könne sich noch genau erinnern. Etwas verwundert war er schon, zumal nichts darauf hinwies, dass dieser Satz stimmen müsse.
Otto zuckte mit den Schultern. Seine Mutter, Sophie von Andechs-Meranien, war schon lange tot. Sie wäre die Einzige gewesen, die das Rätsel wirklich auflösen könne. Sophie war in ihrer Jugend eine schöne Frau, die vielen Männern den Kopf verdrehte. Sein Vater, Poppo VI., erzählte manchmal stolz davon, dass er die schöne Sophie geheiratet hatte, obwohl es viele Verehrer gab, die sie auch gern gewollt hätten. Gut, zu ihr gehörte auch eine entsprechend große Mitgift, sie stammte schließlich aus dem sehr wohlhabenden Hause Meranien.
Heinrich lächelte. Er kannte Sophie auch noch zu Lebzeiten, war damals tief beeindruckt von ihr. Und er wusste auch um die Gerüchte, dass Sophie einen Liebhaber hatte. Es war bekannt, dass die Henneberger Grafen von den Ludowingern stets bevorzugt wurden. Speziell Ludwig III. war mit den Hennebergern sehr eng verbandelt, Poppo VI. gehörte mit zu seinen engsten Vertrauten und weilte daher oft auf der Wartburg. Seine Gemahlin Sophie war stets dabei. Ob nun aber Ludwig …
Er schüttelte den Kopf. Das wäre reine Vermutung. Möglich sei alles, aber er war damals ein Junge, der von solchen Dingen nichts verstand. Zumal in seiner Familie nicht immer freundlich über die Ludowinger gesprochen wurde.
Otto lauschte dem langen Monolog seines alten Weggefährten. Ihm ging es vor allem darum, inwieweit den letzten Worten Ludwigs ihm gegenüber Glauben zu schenken war.
Der Schwarzburger nahm einen großen Schluck Warmbier, lehnte sich zurück und schwieg einen langen Moment. Er räusperte sich und begann in langsamen, wohl überlegten Worten zu sprechen: »Wer Ludwig kannte, weiß, dass er immer großen Wert auf die Wahrheit legte. Nichts war ihm verhasster, als wenn er belogen wurde oder ihm etwas verheimlicht blieb. Nicht umsonst hatte er ein angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder Herrmann, dessen ganzes Leben nur aus Intrigen und Ränkeschmieden bestand.
Er wusste auch, dass er, der keine direkten Nachkommen hatte, wohl durch seinen Bruder und dessen Nachkommen beerbt werden würde. Es bereitete ihm sichtlich Verdruss, darüber nachzudenken.
Wir hatten damals oft darüber gesprochen, als er bereits von der Krankheit gezeichnet war. Ihm war es ein Gräuel, die Landgrafschaft einem Manne zu überlassen, dessen persönlicher Ehrgeiz weit über dem Gemeinwohl stand und der sich nur wenig um die Geschicke des Landes kümmern würde. Sein Argwohn Herrmann gegenüber war nicht unberechtigt, wie sich nach dessen Machtergreifung auch herausstellte. Wir hatten Distanz zu Herrmanns Hofstaat gehalten.
Dennoch waren dessen Versuche, auch die benachbarten Grafschaften seinem direkten Einfluss zu unterstellen, nicht unerwidert geblieben. Es gab zahlreiche Scharmützel zwischen Herrmann und den übrigen Thüringer Grafen. Herrmanns Hauptfeind jedoch waren die mainzischen Fürstbischöfe, die in Erfurt residierten und einem zusammenhängenden Landbesitz der Ludowinger am meisten im Wege standen.
Falls es einen Nachkommen Ludwigs gegeben hätte, wären Herrmanns Ambitionen schon früh zunichte gemacht worden. Er hatte keinerlei Interesse daran, einen Sohn Ludwigs anzuerkennen. Damit waren Ludwigs letzte Worte ungewollt auch so etwas wie ein Todesurteil dir gegenüber. Denn Ludwigs Bruder hätte deine Existenz als Ludowingererbe nicht akzeptiert. Es war wohl das Beste, den Worten Ludwigs keine weitere Beachtung zu schenken. Dein Leben als Henneberger Graf war sicherer als ein mögliches Leben als Ludowingerprinz. Egal, was für Blut in deinen Adern fließt, für dein Leben war es das Beste …«
Heinrich beendete seinen Monolog und nahm erneut einen großen Schluck aus seinem Becher. Otto von Botenlauben war erstarrt. Sein Leben hatte er wahrscheinlich dem Schweigen seiner beiden Kampfgenossen Ernst Ludwig zu Gleichen und Heinrich von Schwarzburg zu verdanken. Er kannte Herrmann, den Landgrafen von Thüringen.
Mehrmals weilte er an dessen Hof, nahm an diversen Sängerwettstreiten teil und tauschte mit dem Landgrafen auch Höflichkeitsfloskeln aus. Ihm war der Landgraf stets etwas unheimlich. Er war zwar den schönen Künsten zugetan, aber er galt als Mann mit zwei Gesichtern. Seine wirklichen Gedanken konnte niemand ergründen. Herrmann sprach zwar immer von Thüringen, meinte aber stets nur seinen eigenen Vorteil. Sein Lavieren zwischen Welfen und Staufern war dafür ein beredtes Zeichen.
Landgraf0
Ludvvwig IUV.
von Thueringen
Nach Herrmanns Tod war das Land verwüstet und zerstört. Sein Ehrgeiz hatte sich nicht ausgezahlt.
Der Graf von Schwarzburg pflichtete ihm bei. Der Lichtblick, der mit dessen Sohn Ludwig IV. aufflammte, war schnell wieder erloschen. Der junge Landgraf starb, ehe er wirklich seine Regentschaft ausüben konnte bei einem sinnlosen Kreuzzug, den er nie hätte mitmachen sollen.
Sein Sohn, Herrmann II., galt nicht als ein starker Regent. Der junge Prinz kränkelte und stand unter Obhut seiner beiden Oheime, Heinrich Raspe und Konrad Raspe.
Herrmann II. residierte auf der Creuzburg, kümmerte sich jedoch wenig um die Landespolitik. Das übernahmen seine beiden Oheime. Sie waren die letzten männlichen Ludowinger. Konrad war als Hochmeister des Kreuzritterordens nicht mehr für das Landgrafenamt prädestiniert, regierte dennoch zusammen mit seinem Bruder. Und Heinrich Raspe versuchte, neue Bündnisse zu schmieden.
Otto war Heinrich dankbar für seine offenen Worte. Das Jahr neigte sich dem Ende. Der alte Graf bat Otto, den Jahreswechsel bei ihm zu bleiben. Er wüsste nicht, wie viel Zeit ihm noch auf Erden beschieden bliebe. Seine Söhne, Heinrich, Günther und Albrecht, standen schon bereit, das Erbe anzutreten.
Vertraute Gesichter zu sehen wäre ein Trost für ihn. Am Abend würde es ein kleines Fest geben, zu dem er ihn einlade. Otto nahm dankbar an. Was er erfahren hatte, würde noch für viele Grübeleien sorgen.