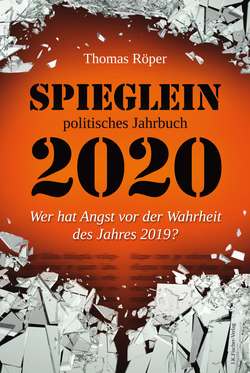Читать книгу SPIEGLEIN politisches Jahrbuch 2020 - Thomas Röper - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEU
Der Westen hatte 2018 Schlagzeilen mit vielen Streitereien gemacht, und die EU war da keine Ausnahme. Daher wollen wir uns einmal die Themen anschauen, um die es dabei unter anderem ging.
Im Februar gab es gleich mehrere Themen, die in der EU für Spannungen gesorgt hatten. Das erste Thema war, dass Italiens Innenminister Verständnis für die Gelbwesten geäußert und sich sogar mit ihnen getroffen hatte. Damals gingen noch hunderttausende an jedem Wochenende auf die Straßen, um gegen Macrons Politik zu demonstrieren, und Macron stand unter großem Druck.
Frankreich zog als Reaktion sogar seinen Botschafter aus Italien ab. Das hatte es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben, und es war innerhalb der „westlichen Wertegemeinschaft“ ein einmaliger Vorgang.
Italien wiederum hatte Probleme mit der EU, die seinerzeit darüber nachdachte, den italienischen Haushalt abzulehnen. Und die EU ihrerseits war sauer, weil Rom ein Veto gegen die Anerkennung von Guaidó als venezolanischen Übergangspräsidenten eingelegt hatte.
Auch zwischen Frankreich und Deutschland gab es Streit, nachdem Emmanuel Macron und Angela Merkel in Aachen gerade erst die deutsch-französischen Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben hatten.
Es vergingen keine zwei Wochen, und die Süddeutsche Zeitung warf Macron einen „Ehebruch“ vor. Die Zeitung teilte mit, dass Frankreich plane, sich gegen „Nord Stream-2“ zu stellen. Einfach so. Wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, dabei hatten sich die beiden gerade erst auf gemeinsame Interessen geeinigt.
Ein offizieller Vertreter des französischen Außenministeriums bestätigte, dass Paris wirklich beschlossen habe, für die Änderungen der EU-Gasrichtlinie zu stimmen, was den Bau von „Nord Stream-2“ erschwert hätte. Das war ein offen anti-deutscher Schritt. Macron, so schien es, „tauschte“ Merkel gegen Trump, ging von der Oma zum Opa.
Oma wollte Macron eigentlich in München treffen. Dort war auf der jährlichen Internationalen Sicherheitskonferenz ein gemeinsamer Auftritt geplant. Dort hätte die verlassene Merkel Monsieur Macron einige klärende Fragen stellen und über ihre Beziehung sprechen können. Aber Fehlanzeige. Macrons Mitarbeiter sagten, dass das Treffen mit Merkel für ihn keine Priorität habe, angeblich gäbe es Schwierigkeiten mit dem Terminplan, Merkel solle ohne ihn beginnen.
Merkel machte enormen Druck und konnte die Gasrichtlinie der EU am Ende so abschwächen, dass die Pipeline weiter gebaut werden konnte.
Doch noch heftiger waren im Februar 2019 die verbalen Schlagabtausche zwischen Brüssel und London wegen dem Brexit. Der damalige Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, erklärte, dass sein Arbeitsplatz in Brüssel aufgrund der Menge an angehäuften Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU zur „Hölle“ geworden sei.
Donald Tusk fragte laut: „Wie sieht der Platz in der Hölle aus?“, der den Unterstützern des Brexit vorbehalten ist. Diese Worte brachten die britische Presse in Rage, und die Mehrheitsführerin im Parlament und Aktivistin für den Brexit, Andrea Ledsom, verlangte von Tusk eine Entschuldigung. Er weigerte sich. Daraufhin nannte ihn der Sprecher der rechten demokratischen Unionspartei Sammy Wilson einen „Euromaniac“ (Übersetzt etwa „Euro-Irrer“).
Ebenfalls im Februar berichtete der Spiegel über eine Umfrage, aus der hervorging, dass nur noch 37 % der Deutschen der Meinung seien, dass die EU ihnen mehr Vorteile als Nachteile bringt.65 Der gegenteiligen Meinung waren 24 %. Damit sah ein Viertel der deutschen Bevölkerung die EU negativ – ein Rekordwert. Dass die größte Gruppe diejenigen waren, die sich nicht entscheiden konnten, war ebenfalls ein Negativrekord. Die EU-Skepsis wächst in Deutschland und ganz Europa.
Die Studie stellte ebenfalls fest, dass es eher die Armen sind, die die EU kritisch sehen, während es die Wohlhabenden sind, die sie gut finden. Das lässt tief blicken, denn trotz aller Bemühungen von Politik und Medien, die EU als Hort des Wohlstandes und der sozialen Errungenschaften darzustellen, sehen gerade die Betroffenen das anders. Dabei sind die Menschen gar nicht gegen die europäische Einigung, sie sind gegen die EU in ihrer heutigen Form. Sie ist ein bürokratisches, undemokratisches und intransparentes Zentrum des Lobbyismus geworden, was sich einfach nicht mehr verdecken lässt.
Diejenigen, denen es wirtschaftlich noch gut geht, finden das nicht weiter schlimm, diejenigen, denen es immer schlechter geht oder die schon von Armut bedroht sind, werden immer skeptischer. Was nützt all die Propaganda in den Medien, wie gut es uns doch geht, wenn viele Menschen merken, dass es ihnen immer schlechter geht?
Das gilt nicht nur für Deutschland. Der Brexit war eine Folge der Entwicklungen in Brüssel. In Italien haben Euroskeptiker die Wahlen gewonnen und stellten die Regierung, bevor sie später zerbrach. Und in Frankreich richtete sich der Protest der Gelbwesten nicht nur gegen Macron, sondern generell gegen die in der EU herrschende Politik, den großen Konzernen die Steuern zu senken und die Rechnung in Form von Steuer- und Abgabenerhöhungen den „kleinen Leuten“ aufzudrücken. Das sind nur Beispiele, in vielen anderen Ländern ist die Stimmung ähnlich.
Vor diesem Hintergrund wurde die Europawahl tatsächlich mit Spannung erwartet. Ein Glück für die „Herrscher“ der Brüsseler Bürokratie, dass das Europaparlament kaum Rechte hat. Wer heute in Geschichtsbüchern liest, dass Deutschland unter dem Kaiser eine Diktatur war, der sollte bedenken, dass der damalige Reichstag mehr Rechte hatte als das EU-Parlament heute. Deutschland unter dem Kaiser war keine Demokratie, nur ist die EU eben noch undemokratischer, als es das deutsche Kaiserreich war. Das sollte jeden nachdenklich machen, der sich für Demokratie einsetzt.
Gleichzeitig wird von Politik und Medien propagiert, dass immer mehr Rechte von den Mitgliedsstaaten an Brüssel abgegeben werden sollen. Immer mehr demokratische Rechte der gewählten nationalen Parlamente sollen an nicht gewählte Bürokraten abgegeben werden. Wo bleibt da die vielgepriesene Demokratie?
Vor diesem Hintergrund war der Artikel von Soros interessant, denn er forderte im Februar genau das, was die EU bei den Menschen unbeliebt gemacht hat: eine weitere Zentralisierung und Abgabe von Rechten an Brüssel. Logisch, denn Soros ist auch nur ein Lobbyist, und seine Interessen kann er im intransparenten Brüssel weit besser durchsetzen als in Ländern, wo Parlamente noch die Macht haben und Abgeordnete sich um ihre Wiederwahl Sorgen machen müssen. Die Brüsseler Beamten hingegen haben diese Sorgen nicht.
Soros, der berühmte Finanzier und Spekulant, Milliardär und Autor des Buches „Die Tragödie der Europäischen Union“ prognostizierte den Zusammenbruch der EU nach dem Beispiel des Zusammenbruches der UdSSR.
Soros warnte in seinem Artikel davor, dass die politischen Entscheidungen, die in den Regierungskreisen des geeinten Europas getroffen werden, bereits jetzt denen ähneln, die im Politbüro getroffen wurden, als es auf die Zukunft der Sowjetunion schon keinen Einfluss mehr hatte.
George Soros, ein konsequenter Verfechter der Globalisierung, versuchte die Europäer davon zu überzeugen, dass sie sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik auf den Kurs der Zentralisierung zurückkehren sollten.
Das persönliche Interesse des Finanziers ist verständlich. Marktkapitalisierung und Vorhersehbarkeit wirtschaftlicher Prozesse leiden, wenn es unmöglich wird, die gesamte globale europäische Infrastruktur zu kontrollieren.
Soros beunruhigten die im Mai anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Er warnte vor einer anti-europäischen Desintegration.
Ihn betrübte die Tatsache, dass die Zentralmacht in der EU nicht über ausreichend Instrumente verfügt, um politische Prozesse in einzelnen Ländern zu kontrollieren. Gleichzeitig werden gegen einige EU-Staaten Maßnahmen eingeführt, die der Bevölkerung nicht gefallen und die die antieuropäische Welle weiter wachsen lassen.
Als Beispiel führte Soros Italien an. Das Dublin-Abkommen, das Rom verpflichtet, die Hauptlast der Kosten für die Aufnahme illegaler Migranten zu tragen, hat einen Sturm der Proteste ausgelöst und dazu geführt, dass die Regierungsmacht im Land in die Hände der Vertreter der „Liga Norden“ und der „Fünf-Sterne-Bewegung “ übergegangen ist.
Und nun schert Italien bei seinen außenpolitischen Entscheidungen aus der gesamteuropäischen Einstimmigkeit aus, so das Fazit Soros.
Den Finanzier beunruhigte auch die politische Instabilität in Deutschland, wo CDU/CSU geschwächt wurden und die Position der „Extremisten“, wie Soros die AfD nannte, stärker wird.
Damit, so schloss der Finanzier, könne die Regierungskoalition nicht mehr rücksichtslos pro-europäisch handeln.
Noch weniger hoffnungsvoll für die Einigkeit des europäischen Kurses war in den Augen von Soros die Lage in Großbritannien, wo der Streit über den Brexit immer härter geführt wurde.
Noch weniger begeistert war Soros von der Europäischen Volkspartei (EVP). Sie bekam von Soros ihre Portion Kritik für ihre Position, die Partei „Fides“ des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban nicht aus der EVP auszuschließen. Die EVP aber brauchte die „Fides“, um ihre parlamentarische Mehrheit zu behalten und die Schlüsselposten in der EU zu kontrollieren.
Am Ende des Artikels versuchte Soros, die Leser davon zu überzeugen, dass die politischen Kräfte, die nicht für eine Zentralisierung der Macht in Europa sind, als Feinde Europas anzusehen seien.
Wenn die „ruhende pro-europäische Mehrheit“ nicht mobilisiert wird, dann „kann aus dem Traum von einem einheitlichen Europa der Albtraum des 21. Jahrhunderts werden“ endete Soros und vergaß dabei, dass die zentrifugalen Tendenzen in vielen EU-Ländern deutlich zeigen, dass längst nicht alle Europäer seine Meinung teilen.
Schäuble sprang auf den Zug von Soros auf und machte am 18. Februar Vorschläge, die Demokratie in der EU endgültig abzuschaffen. Natürlich wurde das so nicht in den Medien berichtet. Dort benutzte man schöne Worthülsen, die das Problem verschleiern sollen. Aber es ging tatsächlich um nicht weniger als um das Ende der Demokratie.
Im Spiegel konnte man folgende Überschrift lesen: „Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip – Schäuble plädiert für Reform der Europäischen Union“.66
Was auf den ersten Blick gut klingt, bedeutet den endgültigen Abbau der Demokratie in der EU. Das Problem in der EU ist, dass nicht gewählte Beamte und von Regierungen im Hinterzimmer ausgesuchte Kommissare die Politik der EU bestimmen. Das einzige demokratisch gewählte Organ in der EU, das EU-Parlament, hat praktisch keine Befugnisse. Wäre ein Parlament in einem Staat im Nahen Osten mit ähnlich wenig Befugnissen ausgestattet wie das EU-Parlament, wäre in der Presse von einem „Scheinparlament“ die Rede. Komischerweise wird dieser Begriff für das EU-Parlament nicht verwendet.
Nun steht es jedem frei, ob man für die weitere Abgabe nationaler Kompetenzen an Brüssel ist oder nicht. Aber worin wir uns alle einig sein sollten, ist, dass es in der EU demokratisch zugehen sollte. Zur Demokratie gehört aber, dass das gewählte Parlament die größte Macht hat und sowohl Gesetze vorschlagen, beschließen und ändern kann, als auch Minister und Regierungschefs absetzen kann. Das EU-Parlament darf praktisch nichts von alledem. Es darf im Grunde nur die „Vorschläge“ der EU-Kommission durchwinken.
Wer in einer solchen Situation für die weitere Abgabe von Kompetenzen nach Brüssel eintritt, ohne eine Reform der Zuständigkeiten zu fordern, spricht sich im Klartext für einen Abbau von Demokratie aus. Solange nationale Parlamente noch die Möglichkeit haben, sich gegen Entscheidungen aus Brüssel zu wehren, ist zumindest indirekt noch eine gewisse demokratische Kontrolle und Korrektur von EU-Entscheidungen möglich. Allerdings längst nicht mehr bei allen Themen, denn viele Kompetenzen sind schon mit den Verträgen von Lissabon nach Brüssel gewandert, wo Entscheidungen nun undemokratisch von nicht gewählten Leuten getroffen werden. Und kein gewähltes nationales Parlament kann daran anschließend noch etwas ändern.
Im Spiegel stand zu Schäubles Ideen: „Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble plädiert dafür, dass bei EU-Entscheidungen der Zwang zur Einstimmigkeit aufgehoben wird. ‚Einstimmigkeitsprinzip heißt, dass der Langsamste alles blockieren kann‘, sagte der CDU-Politiker im Inforadio vom RBB: ‚Deswegen brauchen wir ein System von Mehrheitsentscheidungen, von mir aus qualifizierten Mehrheitsentscheidungen.‘“
„Mehrheitsentscheidungen“ klingt gut und demokratisch. Ist es aber nicht, denn es bedeutet nach Schäubles Lesart, dass Regierungen sich zusammensetzen, etwas im Hinterzimmer ausklabüstern und dann auch denen aufzwingen, die dagegen sind. Von einer demokratischen Mitbestimmung der Bürger in der EU ist dabei nicht die Rede, sondern davon, dass Regierungschefs weniger Rücksicht auf die Länder nehmen müssen, die eine andere Meinung haben. Solange aber Entscheidungen in derart undemokratischen Prozessen entstehen und es kein demokratisch gewähltes Organ gibt, das gefragt werden muss, ist das der Weg in eine Diktatur der Bürokraten.
Mit den Verträgen von Lissabon wurde dieser Weg bereits eingeschlagen und die Folgen sehen wir heute in der ganzen EU: Die EU-kritischen Parteien gewinnen immer mehr an Zulauf. Anstatt aber aus diesem Wählerwillen der Menschen den Schluss zu ziehen, dass die EU wieder demokratischer werden müsste, findet Schäuble das Ganze wohl nur lästig und will einfach die „Bremser“ durch Mehrheitsentscheidungen gefügig machen und ihnen ihr Vetorecht nehmen.
Wenig überraschend findet auch die SPD diesen Abbau von Demokratie gut: „Auch die SPD spricht sich in ihrem Europawahlprogramm, dessen Entwurf der Parteivorstand am Montag beschließen soll, für eine teilweise Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips aus. In der EU-Steuerpolitik soll künftig eine Mehrheit der Staats- und Regierungschefs für Entscheidungen reichen. Zur Begründung heißt es im Programmentwurf, der dem SPIEGEL vorliegt: ‚Die Lähmung durch einzelne Mitgliedstaaten, die nur ihre Pfründe sichern wollen, muss aufhören.‘“
Was das bedeutet, wird einem klar, wenn man die folgende Forderung von Schäuble liest und darüber nachdenkt, welche Folgen sie in der Praxis hätte: „Schäuble sprach sich zugleich dafür aus, Teile der nationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik auf die Ebene der europäischen Institutionen zu übertragen. Nur wenn das gelinge, könne man auch einen EU-Finanzminister einführen.“
Früher war das wichtigste, höchste, sogar „heiligste“ Recht des demokratisch gewählten Parlaments das Recht, über den Haushalt zu entscheiden. Das ist die heilige Kuh der Demokratie, denn über den Haushalt, also die Zuteilung von Geldern, kann man Ideen der Regierung stoppen oder auch fördern. Wer nun die nationale Finanz- und Wirtschaftspolitik auf die Ebene der „europäischen Institutionen“ übertragen will, der sagt nichts anderes, als dass er das wichtigste Feld der Politik, von dem alles andere abhängt, aus der demokratischen Kontrolle herausnehmen und in die Hände von Bürokraten und Beamten überführen will, die niemand mehr demokratisch kontrolliert.
Wie frei sind Sie noch, wenn jemand anderes über Ihr Geld bestimmt? Sie könnten nicht einmal mehr ins Kino gehen, ohne um Erlaubnis zu bitten.
Das Gleiche gilt für Staaten, wie Griechenland aus leidvoller Erfahrung berichten kann. Dort hat die EU die Macht über den Haushalt mit katastrophalen Folgen übernommen. Und wenn Schäubles Idee umgesetzt wird, kann Deutschland nicht mehr über Änderungen bei Hartz 4, bei den Renten, bei den Krankenkassenbeiträgen und so weiter entscheiden, weil die Entscheidungskompetenz für alles, was mit Geld zu tun hat, dann in Brüssel liegen würde. Und egal, wie wenig den Deutschen die Entscheidungen aus Brüssel dann gefallen, sie könnten auch durch Wahlen nichts mehr ändern, weil neue Abgeordnete im Bundestag auch nichts ändern könnten, denn sie dürften über das Geld ja gar nicht mehr entscheiden. Auch das EU-Parlament wäre außen vor. Diejenigen, die dann über unser Geld entscheiden, würden in Brüssel sitzen und von niemandem gewählt sein.
Wie gesagt: Jeder soll über die Abgabe von nationalen Kompetenzen an die EU seine eigene Meinung haben. Aber zuerst müsste die EU demokratisch reformiert werden. Das bedeutet, dass das EU-Parlament die Macht bekommen muss und dass es das EU-Parlament sein muss, das die „EU-Regierung“, also die EU-Kommission, formt. Solange das nicht gegeben ist, dürften keine (weiteren) Kompetenzen an die EU abgegeben werden, weil das diese Kompetenzen der demokratischen Kontrolle entzieht.
Nach einer solchen Reform der EU kann man dann über alles reden. Dies vorher zu fordern, ist – wie gesagt – die direkte Forderung nach Demokratieabbau. Anscheinend fühlen sich unsere „demokratischen“ Politiker vom demokratischen Willen der Bürger mehr und mehr gestört.
Im März sorgte ein Interview in der FAZ für Schlagzeilen. Die FAZ hatte den ungarischen Justizminister und Spitzenkandidaten zur Europawahl der Regierungspartei Fidesz interviewt.67
Für Aufregung sorgte die letzte Frage im Interview, in der es um den Streit zwischen der Fidesz und EU-Kommissionspräsident Juncker ging. Hier zunächst die vollständige Antwort des ungarischen Justizministers: „An dieser Stelle haben wir nicht Juncker als Person angegriffen, sondern die schlechten Entscheidungen der Meinungsführer der Kommission. Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Kommission wie ein Politbüro aufgetreten ist. Wir glauben, die europäischen Verträge formulieren eindeutig. Die politische Richtung muss der Europäische Rat bestimmen, in dem die Staatsoberhäupter und Regierungschefs der Nationen sitzen. Heute sinkt aber immer mehr der Einfluss des Europäischen Rates. Aufgabe der Kommission ist es, den Geist der Verträge zu wahren und in der Richtung, die der Rat vorgegeben hat, zu verfahren. Stattdessen sehen wir, dass der Einfluss des Rates sich verringert und die Kommission die politische Richtung vorgeben will.“
Wer will dem widersprechen? Er hat mit allem Recht. Tatsächlich sollte eigentlich der Europäische Rat die politische Richtung bestimmen, denn dort sitzen gewählte Regierungschefs. Die EU-Kommission schwingt sich aber tatsächlich immer mehr zu einer „europäischen Regierung“ auf, obwohl sie von niemandem gewählt wurde. Demokratie?
Man stelle sich einmal vor, in Deutschland gäbe es keine Bundestagswahlen, sondern nur Landtagswahlen. Und dann würden die Ministerpräsidenten der Länder unter sich bestimmen, wer Mitglied eines „Deutschen Rates“ wird. Dieser „Deutsche Rat“ wiederum würde dann zusammen mit den Landesregierungen bestimmen, wer Bundeskanzler und Bundesminister wird. Der Kanzler und seine Minister wären also nicht gewählt, hätten aber die Macht.
Wäre das demokratisch? Eher nicht.
Aber so ist die EU aufgebaut. Und wenn Ungarn dies kritisiert, hat es in meinen Augen absolut Recht!
Unsere Medien stören sich am undemokratischen Aufbau der EU jedoch überhaupt nicht, sondern greifen jeden an, der diese Zustände kritisiert. In allen Artikeln der deutschen Medien zu diesem Interview konnte man lesen, dass die merkwürdigen Ungarn Rechtsstaat und Demokratie gefährden und die „gute“ EU-Kommission als „Politbüro“ bezeichnen. Pfui Teufel!
Jedoch wurden die Argumente Ungarns nirgendwo zitiert oder erwähnt. Und wer hat schon das ganze Interview in der FAZ gelesen?
Im Spiegel sieht das zum Beispiel so aus:68 „In wenigen Tagen will der EVP-Vorstand über den weiteren Umgang mit der ungarischen Regierungspartei Fidesz entscheiden. Spitzenkandidat Laszlo Trocsanyi provoziert derweil in einem Interview.“
Haben Sie beim Lesen der kompletten Antwort des ungarischen Justizministers eine Provokation erkennen können? Ich nicht.
Der Spiegel kürzte die Aussage des ungarischen Justizministers dann auch so, dass seine Argumente untergingen:
„Auf die Frage: ‚War das Anti-Juncker-Plakat der ungarischen Regierung eine bewusste Provokation der EVP-Parteifreunde?‘ antwortete Trocsanyi: ‚An dieser Stelle haben wir nicht Juncker als Person angegriffen, sondern die schlechten Entscheidungen der Meinungsführer der Kommission. Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Kommission wie ein Politbüro aufgetreten ist.‘“
Die wichtigsten Argumente, mit denen er seinen Standpunkt erklärt, wurden nicht zitiert. Hauptsache, das Pfui-Wort „Politbüro“ wird erwähnt. Ist das vollständige und objektive Berichterstattung?
Stattdessen wird in den Medien immer behauptet, dass in Ungarn Rechtsstaat, Pressefreiheit und Demokratie in Gefahr seien. Dabei ist es Ungarn, das in Wahrheit für mehr Demokratie in der EU eintritt, während unsere Medien Ungarn dafür kritisieren. So sind die deutschen Qualitätsmedien.
Verkehrte Welt.
Übrigens: „Rat“ heißt auf Russisch „Sowjet“. Und so war die „Sowjetunion“ eben auf Russisch „Sowjetski Sojus“. Aber „Sowjet“ klingt natürlich auf Deutsch böser und einprägsamer als „Rat“. Man hätte im Westen anstatt von „Obersten Sowjet“ ja auch vom „Obersten Rat“ sprechen können oder anstatt von der „Sowjetunion“ als der „Räte-Union“.
Noch schöner wird es aber, wenn man die heutigen Begriffe auf Deutsch und Russisch vergleicht: „Europäische Union“ heißt auf Russisch „Evropeski Sojus“, das erinnert an „Sowjetski Sojus“. Auch nicht schlecht, oder? Und „Rat der Europäischen Union“ heißt auf Russisch „Sowjet Evropeskogo Sojusa“. Da haben wir doch tatsächlich – zumindest sprachlich – ein paar interessante Parallelen.
Da die Medien in der ersten Jahreshälfte 2019 eine Riesenshow um die Europawahl veranstalteten, sollte man sich einmal im Detail anschauen, welche Rechte dieses Parlament eigentlich hat. Ich habe das Thema eben schon gestreift.
In einer Demokratie, so lernen wir immer, geht alle Macht vom Volke aus und das Volk wählt seine Vertreter, die es dann stellvertretend regieren. In der EU fanden im Mai 2019 Wahlen zum EU-Parlament statt, und man sollte meinen, dass wir dann von den Abgeordneten regiert werden, die wir gewählt haben.
Stimmt das? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich einmal anschauen, welche Vollmachten und Entscheidungsbefugnisse das Parlament überhaupt hat.
Ein Parlament kann normalerweise Gesetze ausarbeiten, vorschlagen und dann über ihre Annahme abstimmen. Das EU-Parlament darf das nicht. Es darf keine Gesetze einbringen, sondern darf nur über die Gesetze mitentscheiden, die von der EU-Kommission ins Parlament eingebracht werden. Die Betonung liegt auf mitentscheiden, denn das Parlament trifft die Entscheidung zusammen mit dem EU-Rat, in dem die Vertreter der Regierungen der EU-Staaten sitzen. Und da Kommission und Rat ihre Initiativen in der Praxis absprechen, steht das Parlament im Zweifel auf verlorenem Posten.
Wenn das Parlament, was selten genug vorkommt, mal mit einem neuen Gesetz nicht einverstanden ist, dann gibt es einen Vermittlungsausschuss, wo die Fraktionschefs sich hinter verschlossenen Türen mit dem EU-Rat auf einen Kompromiss einigen, der in der Regel vom ursprünglichen Gesetzestext kaum abweicht. Zuletzt gab es das bei den umstrittenen Upload-Filtern, wo sich das Parlament zur Abwechslung einmal auf die Hinterbeine gestellt hat. Das Gesetz ging am Ende trotzdem praktisch unverändert durch.
Da dieses Verfahren sehr zeitaufwendig ist, wird es in der Regel umgangen. Um den hohen Zeitaufwand dieses Verfahrens zu umgehen, werden immer mehr Gesetzesvorschläge im sogenannten informellen Trilogverfahren ausgehandelt, um dann bereits in erster Lesung beschlossen werden zu können: Zwischen 2004 und 2009 etwa traf dies auf 72 % aller Gesetzesentwürfe zu, im Vergleich zu 33 % zwischen 1999 und 2004.69
Das bedeutet in der Praxis, dass Gesetze in der EU von der Kommission in Absprache mit dem Rat vorbereitet werden und das Parlament dann mit dem Rat darüber reden darf. Am Ende hat es keine andere Wahl, als sie durchzuwinken. Eigene Gesetze kann das Parlament nicht einbringen, und Vorschläge endgültig ablehnen kann es auch nicht.
Aber es gibt auch reichlich Bereiche, wo das Parlament praktisch gar kein Mitspracherecht hat. So muss das Parlament im Bereich der Wettbewerbspolitik lediglich konsultiert werden. Auch in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hat es gemäß Art. 36 EUV kaum Mitspracherechte.
Und das wichtigste Recht eines Parlaments ist es in einer Demokratie, über den Haushalt zu entscheiden. Schließlich hängt am Ende alles am Geld. Man kann ein Projekt beschließen, aber wenn es nicht finanziert wird, dann stirbt es einen schnellen Tod. Leider sieht es beim Haushalt ganz düster aus, denn auch der Haushalt wird von der Kommission eingebracht.
Die Europäische Kommission schlägt einen Haushaltsentwurf vor. Im Haushaltsverfahren können dann Parlament und Ministerrat Änderungen beschließen. Sind sich beide einig, tritt der Haushaltsplan mit den Änderungen in Kraft. Gibt es zwischen Parlament und Rat Differenzen über den Plan, wird ein komplexes Verfahren mit gegenseitigen Konsultationen und Abstimmungen durchgeführt. Gibt es auch nach dieser politischen Feinabstimmung keine Einigkeit, wird als letztes Mittel der Vermittlungsausschuss eingeschaltet. In der politischen Praxis führt das dann zu einem Kompromiss und zu einer Einigung.
Auch hier darf das Parlament also nichts alleine bestimmen, sondern muss sich mit dem Rat einigen, der normalerweise den Vorschlag der Kommission unterstützt. Das Parlament darf nicht, wie in einer Demokratie üblich, den Haushalt einfach ablehnen.
Übrigens ist ja auch die Kommission nicht demokratisch gewählt oder legitimiert, vielmehr darf jedes EU-Land einen Kommissar stellen. In der Regel wird auf den Posten irgendein Politiker „weggelobt“, so wie in Deutschland Herr Oettinger, für den man nach seinen verlorenen Wahlen in Deutschland keine Verwendung mehr hatte und ihn auf den gut dotierten Posten eines EU-Kommissars nach Brüssel abschob. Qualifiziert war er für sein Fachgebiet bekanntermaßen nicht, man suchte nur eine Beschäftigung für ihn. Und so läuft es in der ganzen EU, die Kommissare sind also in der Regel abgehalfterte Politiker, denen man einen gut bezahlten Posten besorgen muss.
Die Kommission ist aber auch die „Regierung“ der EU. Und wie gesehen darf das Parlament diese Regierung nicht abwählen, wie es in einer Demokratie üblich ist. Das Parlament darf zwar formell den Präsidenten der Europäischen Kommission wählen, aber der Kandidat wird vom EU-Rat vorgeschlagen. Es gab noch nie einen Fall, dass dieser vorgeschlagene Kandidat abgelehnt worden wäre.
Bei der EU-Wahl haben wir hinterher deutlich gezeigt bekommen, wie ernst man es in Brüssel mit der Demokratie meint. Eigentlich sollte der Spitzenkandidat der größten Fraktion auch EU-Kommissionspräsident werden. Aber weil Herr Weber, dem der Posten demnach zugestanden hätte, einigen Regierungschefs – vor allem Macron – nicht gefiel, setzte man sich darüber hinweg und ernannte Ursula von der Leyen.
Das Parlament wurde damit offen brüskiert, aber nach einigem Murren wurde Ursula von der Leyen vom Parlament bestätigt.
Die Regierungen der EU-Staaten klüngeln hinter verschlossenen Türen einen Kandidaten aus und das Parlament winkt den dann durch. Das konnten wir detailliert beobachten, aber dazu gleich noch mehr.
Außer dem Kommissionspräsidenten bestätigt das Parlament ebenfalls die gesamte Kommission. Auch hier werden die Kandidaten formell durch den Europäischen Rat nominiert, wobei die Entscheidung, wie erwähnt, den nationalen Regierungen überlassen wird. Es kam im 40-jährigen Bestehen des Parlaments seit 1979 ganze zweimal vor, dass das Parlament vorgeschlagene Kommissare ablehnte: 2004 Rocco Buttiglione und 2009 Rumjana Schelewa.
Und es kam nach der Wahl 2019 noch einmal vor. Vielleicht als Zeichen des Protests über die Brüskierung bei der Durchsetzung von Uschi von der Leyen lehnte das Parlament einen Kommissar ab.
Auch hier also entscheidet letztlich nicht das Parlament, sondern die EU-Staaten klüngeln hinter verschlossenen Türen ihre Kandidaten aus und das Parlament winkt sie durch.
Wie man sieht, hat das EU-Parlament keinerlei Machtbefugnisse. Wenn es gegen etwas ist, wird es am Ende trotzdem umgesetzt, es kann sich höchstens ein wenig verzögern. Und das soll demokratisch sein?
Und jetzt möchte ich etwas tun, was man fast schon als Satire bezeichnen kann, wenn es nicht wahr wäre.
Wir lernen doch in der Schule, dass das Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm keine Demokratie, sondern eine Diktatur war. Und eine Demokratie war es ja auch tatsächlich nicht. Aber es hatte ein gewähltes Parlament, den Reichstag. Und der hatte sehr viel mehr Macht als das EU-Parlament heute.
Der Reichstag im Deutschen Kaiserreich durfte Gesetze selbst einbringen und sie auch beschließen, außerdem konnte er den Staatshaushalt ablehnen. Wer sich für Geschichte interessiert, der weiß, wie sehr Bismarck und später Kaiser Wilhelm mit dem Reichstag zu kämpfen hatten, weil er nicht nur auf dem Papier Rechte hatte, sondern diese auch konsequent nutzte.
Wenn man dagegen die Rechte des EU-Parlaments sieht, dann fragt man sich, wie diese EU überhaupt von Demokratie reden kann, wenn sie sich ein Scheinparlament ohne Rechte hält, wie es nicht einmal der deutsche Kaiser Wilhelm gewagt hat.
Wer all dies weiß, dem bleibt das ironische Lachen im Halse stecken, wenn man die Versuche der Medien liest, dem Wähler die Wichtigkeit der Wahl zu erklären. Dort wurde es so formuliert, als habe das Parlament tatsächlich etwas zu melden in der EU. Im Spiegel konnte man zu den Befugnissen des Parlaments lesen:70 „Die Macht des Europaparlaments ist seit seiner Gründung stark gewachsen. Inzwischen ist es bei der Gesetzgebung ein fast gleichberechtigter Gegenpart zu dem mit nationalen Regierungsmitgliedern besetzten (Minister-)Rat. Das Parlament entscheidet in vielen Bereichen gemeinsam mit dem Rat über neue Regelungen und Gesetze.“
Klingt gut, bedeutet aber genau das, was ich ausgeführt habe: Das Parlament hat nichts zu entscheiden, sondern ist „fast“ gleichberechtigt mit dem (Minister-)Rat. Der ist aber gar nicht demokratisch gewählt, was bedeutet, dass das Parlament beim Erlassen von Gesetzen weniger Rechte hat als ein nicht gewähltes Organ der EU. Wo ist hier die Demokratie?
Weiter stand im Spiegel: „Die Abgeordneten haben zwar kein Initiativrecht für Gesetze. Sie können aber die Kommission auffordern, Gesetze zu bestimmten Themen zu erarbeiten.“
Genau. Nur wie die Gesetze aussehen, die die Kommission dann erarbeitet und dem Parlament zur Entscheidung vorlegt, darauf hat das Parlament keinen Einfluss. Und wie gesehen hat es auch keine Möglichkeit, solche Gesetze endgültig abzuschmettern. Was aus der nicht frei gewählten Kommission kommt, wird auch Gesetz. In der 40-jährigen Praxis gibt es dafür kein Gegenbeispiel.
Um uns zu zeigen, wie gut und wichtig das EU-Parlament ist, fragte der Spiegel dann: „Wie bestimmen Entscheidungen des Europaparlaments unseren Alltag?“
Als Antwort wurden diverse positive Beispiele aufgezählt, wie zum Beispiel die weitgehende Abschaffung der hohen Roaming-Gebühren im EU-Ausland. Nur wir erinnern uns: Diese Gesetze stammen ja nicht vom Parlament, sie kamen aus der Kommission und wurden vom Parlament durchgewunken. Das gilt für alle im Spiegel genannten Beispiele, sie alle wären auch ohne das Parlament entstanden. Das Parlament hat kein Recht, selbst Gesetze einzubringen.
Bleibt eine Frage: Wozu wählen gehen, wenn das Parlament ohnehin nichts bewegen oder entscheiden kann?
Nun, das hat rein politische Gründe. Wenn man den etablierten Parteien eins auswischen wollte, dann machte man sein Kreuz bei einer „Protestpartei“. Wer gegen die „Protestparteien“ war, machte sein Kreuz bei einer etablierten Partei. Bei welcher, war völlig egal, sie haben ja sowieso nichts zu entscheiden im EU-Parlament.
Es ging bei der Wahl also nur darum, zu sehen, wie die Stimmung in Europa ist. Gewinnen die euroskeptischen Parteien, führt das zu Unruhe bei den Regierungen und vielleicht sogar zu Veränderungen. Gewinnen die etablierten Parteien, geht es weiter wie bisher.
Um mehr ging es nicht, es macht – aufgrund der fehlenden Rechte des EU-Parlaments – keinerlei Unterschied, ob Sie CDU, SPD, FDP oder Grüne gewählt haben. Die Abgeordneten dort haben nichts zu sagen und stimmen sowieso praktisch immer identisch ab.
Besonders deutlich zu sehen war das bei der TV-Debatte der EU-Spitzenkandidaten, wo alle Kandidaten im Grunde einer Meinung waren. Eine russische Nachrichtenagentur kommentierte das zutreffend:71
„Diese Gemeinsamkeit der Ansichten ließ nur eine Frage offen: Warum sechs Kandidaten nominieren, wenn die gemeinsamen Positionen auch einer allein verkünden kann?“
Daher waren folgerichtig auch die Wahlplakate und Slogans so gleich, dass man nicht wüsste, von welcher Partei sie kommen, wenn es nicht draufstehen würde. Nur was ist das für eine Wahl, wenn man nicht zwischen verschiedenen Positionen wählen kann?
Der Vollständigkeit halber wollen wir uns auch die Wahlergebnisse anschauen, wobei uns der Blick ins EU-Ausland mehr interessieren sollte, denn über viele dieser Trends in anderen Ländern wurde in Deutschland nicht berichtet.
In Frankreich hat Macron trotz allen Einsatzes verloren und kam nur auf Platz zwei, auf Platz eins landete Le Pen. Für Macron war das eine herbe Niederlage, die seine politische Situation weiter schwächt.
In Großbritannien gewann die Brexit-Partei, die nicht einmal ein Programm hatte, aber einen Namen, der alles sagt. Die etablierten Parteien lagen weit hinter ihr. Und auch wenn die „Qualitätsmedien“ danach weiterhin auf ein Ende des Brexit warteten, war klar, dass die Mehrheit der Briten den Brexit wollte. Das zeigte sich dann ja auch im November, als Johnson mit seinem kompromisslosen Brexit-Kurs die vorgezogenen Neuwahlen haushoch gewann.
In Österreich gewann die ÖVP von Kanzler Kurz hinzu, und die FPÖ ist trotz des medialen Dauerfeuers gegen sie im Zuge der Strache-Affäre nicht abgestürzt. Alle Bemühungen der Medien haben nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Man darf sich fragen, wie es wohl ausgegangen wäre, wenn nicht genau zum „richtigen“ Zeitpunkt das Strache-Video aufgetaucht wäre. Die EU-Wahl wäre zu einem Triumph der Regierung auf ÖVP und FPÖ geworden, aber diese Regierung wurde gerade noch rechtzeitig vom Strache-Video hinweggefegt.
In Italien haben die regierenden EU-Kritiker von Liga Nord und 5-Sterne ca. die Hälfte der Stimmen bekommen. Obwohl das eigentlich ihre Position hätte stärken müssen, ist die Koalition nur ein paar Monate später zerbrochen.
Im kleinen Slowenien führten ebenfalls die oppositionellen Euroskeptiker von rechts.
In Griechenland bekam Tsipras mit seiner Partei einen derartigen Denkzettel verpasst, dass er sofort Neuwahlen ankündigte, die er dann später verloren hat.
In Schweden haben die Nationalisten den größten Zuwachs erzielen können und landeten auf Platz drei, während die etablierten Parteien Platz eins und zwei halten konnten und nur leichte Verluste eingefahren haben. Das macht die politische Situation in dem Land nicht einfacher, wo die Nationalisten schon bei den letzten Parlamentswahlen die politischen Karten neu gemischt haben.
In Ungarn hat die Partei von Orban klar gewonnen und über 50 % eingefahren.
Europaweit konnte man ein Wachstum der EU-Kritiker beobachten. Und zum ersten Mal haben die großen Blöcke EVP (mit CDU/CSU) und Sozialisten (mit der SPD) ihre Mehrheit im EU-Parlament verloren. Die Stimmung ist also auf den ersten Blick nicht gut für den klassischen „Weiter-so“-Kurs. Aber natürlich haben die Befürworter von „Weiter-so“ immer noch eine satte Mehrheit, denn der Kurs wird auch von den Fraktionen der Liberalen und der Grünen gestützt.
Die Liberale Fraktion im EU-Parlament wächst stark, allerdings nicht aufgrund von Wahlerfolgen, sondern weil Macrons Partei sich den Liberalen angeschlossen hat. Diese zur französischen Präsidentschaftswahl aus dem Nichts entstandene Retortenpartei war bisher nicht im EU-Parlament vertreten, und ihr Einzug stärkt daher automatisch die Liberalen.
Die wirklichen Gewinner waren die EU-Kritiker und die Grünen, wobei die EU-Kritiker klarer gewonnen haben. Sie teilen sich in zwei Fraktionen auf, in die „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ und in „Europa für Freiheit und Demokratie“. Sollten sie sich vereinen, wären sie mit 111 Mandaten drittstärkste Kraft im EU-Parlament, denn trotz Macrons Anschluss an die Liberalen kommen die Liberalen nur auf 105 Mandate.
Die Grünen sind zweiter Sieger. Während die beiden EU-kritischen Fraktionen zusammen von 78 auf 111 Plätze gewachsen sind, sind die Grünen von 52 auf 69 gewachsen.
Die Neubesetzung aller Schlüsselposten in der EU, die auf eine solche Wahl folgt, hat sehr dubiose Figuren nach oben gespült. Bei demokratischen Wahlen hätten die wohl keine Chance gehabt, aber wie demokratisch die EU ist, haben wir ausführlich durchgekaut.
Die EZB wird zukünftig von jemandem geleitet, die rechtskräftig wegen fahrlässigem Umgang mit Steuergeldern verurteilt worden ist. Das war immerhin eine Verurteilung in einer Strafsache. Und gegen die neue Kommissionspräsidentin der EU laufen staatsanwaltliche Ermittlungen. Herzlich willkommen in der EU-Demokratie!
Christine Lagarde sollte nun die EZB führen und damit für unser aller Geld verantwortlich sein. Aber würden Sie jemandem Ihr Geld anvertrauen, die rechtskräftig verurteilt wurde, weil sie mit anvertrauten Geldern fahrlässig umgeht? Nein? Tun Sie aber, weil die EU-Regierungschefs es so beschlossen haben.
Folgendes ist geschehen: 1990 kaufte ein französischer Unternehmer die Mehrheit von Adidas und wollte sie 1994 wieder verkaufen. Er beauftragte zunächst eine Bank damit und verkaufte die Anteile schließlich an die Bank, die sie kurz darauf mit großem Gewinn weiterverkaufte.
Das fand der Unternehmer nicht gut, fühlte sich betrogen und klagte auf einen Anteil an dem Gewinn. Er gewann den Prozess und sollte 135 Millionen Euro bekommen, aber ein anderes Gericht hob das Urteil wieder auf.
Die Bank gehörte übrigens dem französischen Staat. Bei einem Schiedsgerichtsverfahren traf dann die damalige französische Wirtschaftsministerin 2008 die Entscheidung, dass dem Geschäftsmann nicht nur 135, sondern 285 Millionen zustehen. Inklusive Zinsen wurden ihm 403 Millionen zu Lasten des französischen Staates überwiesen. Und wer war diese Wirtschaftsministerin? Richtig, Christine Lagarde.
2011 begann die französische Justiz zu ermitteln, und 2016 gab es einen Schuldspruch. Dazu konnte man in der „Zeit“ lesen:72
„Der Strafprozess gegen Christine Lagarde geht mit einem Schuldspruch für die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Ende. Die Richter vom Sondergericht für amtierende und ehemalige Amtsinhaber sahen es als erwiesen an, dass die 60-Jährige in ihrem früheren Amt als französische Finanz- und Wirtschaftsministerin fahrlässig gehandelt hat. Von einer Strafe sahen die Richter aber ab und begründeten dies mit der ‚Persönlichkeit‘ Lagardes, ihrem ‚internationalen Ansehen‘ und der Tatsache, dass Lagarde 2007 und 2008 mit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte.“
So funktioniert der französische Rechtsstaat: Wenn Sie genug „internationales Ansehen“ haben und auch noch wegen einer Wirtschaftskrise im Stress waren, können Sie auch schon mal 400 Millionen Steuergelder an einen Unternehmer verschenken, ohne deshalb – trotz Schuldspruch – bestraft zu werden.
Die EZB wird also in fähige und zuverlässige Hände gegeben.
Da hat es die designierte Präsidentin der EU-Kommission besser. Der deutsche Rechtsstaat funktioniert nämlich noch besser als der französische.
In Deutschland schützt $146 GVG Politiker vor Strafverfahren. $146 GVG sagt, dass Staatsanwälte den Weisungen des Justizministers folgen müssen und nicht ermitteln dürfen, wenn der Justizminister das nicht möchte. Daher gehen zwar immer wieder mal Strafanzeigen gegen Minister oder sogar die Kanzlerin ein, aber davon hört man dann später nichts mehr. Diesen Anzeigen wird von der Staatsanwaltschaft nicht nachgegangen, es wird vom Justizminister kurzerhand untersagt.
Für Frau von der Leyen ist das ein wahrer Glücksfall. Im Zuge der Berateraffäre wurde nicht nur bekannt, dass Beraterverträge in Millionenhöhe in ihrem Verteidigungsministerium ohne Ausschreibung, quasi unter Freunden, vergeben wurden, sondern auch, dass ihr Sohn David bei McKinsey einen gut bezahlten Job bekommen hat.73 Und wie der Zufall es will, hat McKinsey viele Millionen an Uschis Ministerium verdient.
Gegen Frau von der Leyen wurden in diesem Zusammenhang mehrere Strafanzeigen gestellt, Folgen hatte das aber keine.
Im Spiegel konnte man Ende September 2018 lesen:74
„In beiden Gutachten werfen die Prüfer dem Ministerium (…) vor, Beraterleistungen mit einem Umfang von acht Millionen Euro rechtswidrig aus einem Rahmenvertrag des Bunds abgerufen zu haben. Den Vorgang hat das Ministerium bereits eingestanden und angekündigt, die Vorgänge im Haus strenger kontrollieren zu wollen. Gravierender aber ist ein zweiter Bericht der Rechnungsprüfer, für den die Experten fast hundert Einzelverträge mit Unternehmensberatern aus den vergangenen Jahren untersucht hatten. Das Urteil fällt harsch aus: Wörtlich spricht der Rechnungshof von freihändigen Vergaben. In den meisten Fällen sei zudem die Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit der externen Experten nicht dargelegt worden. (…) Gleich zu Amtsantritt holte sie (von der Leyen) mit Katrin Suder eine Topkraft vom Berater-Riesen McKinsey als Staatssekretärin ins Wehrressort. Seitdem floriert das Geschäft für die Berater. Kaum ein Großprojekt der Bundeswehr kommt noch ohne externen Sachverstand aus. Bei den Beamten und Fachleuten im Ministerium wird deren Sachverstand zwar geschätzt, die teils horrenden Tagessätze von bis zu 1700 Euro pro Berater sorgen aber auch für reichlich Missgunst.“
Frau Suder von McKinsey? Wo bekam Sohnemann David von der Leyen einen guten Job? Richtig, bei McKinsey.
Dann folgte eine Strafanzeige gegen Frau von der Leyen, wie man knapp drei Wochen später im Spiegel lesen konnte:75
„Nach SPIEGEL-Informationen prüft die Staatsanwaltschaft Berlin, ob der dauerhafte Einsatz von Unternehmensberatern im Wehrressort den Tatbestand der vorsätzlich verursachten Scheinselbstständigkeit erfüllt. (…) Die Ermittlungen der Justiz wurden durch eine Anzeige gegen die Ministerin vom 30. September ausgelöst, die offenbar von einem Insider aus dem Umfeld ihres Hauses stammt.“
Und im gleichen Artikel treffen wir auch Frau Suder wieder, die – frisch von McKinsey ins Ministerium gewechselt – nur eine Aufgabe hatte, nämlich Berater anzuheuern:
„Mit scharfem Geist und viel ‚Change Management‘-Erfahrung sollte Suder das Haus modernisieren. Da es schnell gehen sollte, wurden immer neue Berater für Projekte engagiert. Schon jetzt ist klar, dass es bei der Auftragsvergabe nicht ausschließlich mit rechten Dingen zuging. Bereits eingestanden hat das Ministerium, dass Berateraufträge im Umfang von acht Millionen Euro für ein IT-Projekt rechtswidrig über einen Rahmenvertrag des Bunds abgerufen wurden. (…) Im Ministerium kursieren bereits ziemlich konkrete Gerüchte über eine Art Buddy-System unter Auftraggebern im Haus und den externen Beratern. Häufig wird der Name eines Drei-Sterne-Generals genannt, der persönlich eng mit einem Berater befreundet ist. Der frühere Bundeswehr-Mann wiederum zog in den vergangenen Jahren immer wieder größere Aufträge aus dem Ministerium für seine Firma an Land. Auch die frühere Staatssekretärin Suder kennt den Unternehmensberater ganz gut, er war früher ebenfalls bei McKinsey. (…) So kursiert in den diversen WhatsApp-Gruppen der Beamten im Bendler-Block seit Tagen ein Personenprofil eines Sohns der Ministerin. Er arbeitet seit 2015 im Silicon-Valley-Büro von McKinsey.“
Und im Januar gab es eine weitere Strafanzeige gegen von der Leyen. Diesmal ging es bereits um Untreue. Wieder der Spiegel dazu:76
„Die Strafanzeige beruft sich auf einen vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofs, der Digitalprojekte des Ministeriums im Wert von 19,5 Millionen Euro untersucht hatte. (…) In dem Dossier skizzieren die Prüfer bereits deutlich den Untreueverdacht. So bezeichnen sie die Vergaben der Beraterverträge durch das Ministerium nicht nur als ‚unzulässig und vergaberechtswidrig‘, sondern kommen zu dem Schluss, dass ‚vermeidbare Mehrausgaben in der Größenordnung von 1 Million Euro‘ entstanden seien. (…) Die Anzeige richtet sich gegen von der Leyen persönlich (…) In der Anzeige werden schwere Vorwürfe gegen von der Leyen erhoben. So habe die Ministerin entweder ‚Kenntnis von den Vorgängen‘ gehabt oder ‚durch mangelnde Kontrolle und Organisation erst möglich gemacht, dass in ihrem Ministerium derartige Vermögensschäden vorsätzlich herbeigeführt wurden‘.“
Von beiden Anzeigen hat die Öffentlichkeit – $146 GVG sei Dank – danach nicht mehr viel gehört. Frau von der Leyen kann sich glücklich schätzen, dass es ihn gibt. So kann sie nun – im Gegensatz zur neuen EZB-Chefin – ganz ohne Vorstrafe und lästige Verhöre durch Staatsanwälte in Brüssel wieder ganz viele Berater anstellen, denn dort ist die Kontrolle noch lascher als im korrupten Verteidigungsministerium.
Im Juli erschien im Spiegel ein Artikel, der uns die neuen Führer der EU vorstellen sollte.77 Natürlich wurden die Skandale möglichst heruntergespielt – der Spiegel würde doch keine etablierten Politiker kritisch betrachten. So konnten wir über die in einer Strafsache rechtskräftig verurteilte neue EZB-Chefin Lagarde im Spiegel lesen: „2008 segnete sie einen Vergleich ab, in dem einem schwerreichen Geschäftsmann 400 Millionen Euro von einer staatseigenen Bank zugesprochen wurden. Lagarde gab an, sie habe der Staatskasse Prozesskosten in Millionenhöhe ersparen wollen. Lagarde wurde wegen fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Mitteln verurteilt, erhielt aber keine Strafe.“
Ohne die lästigen Details, die ich aufgezählt habe (und ich habe mich sehr kurz gefasst, es gibt da noch einiges mehr über den Fall zu erzählen) klingt das doch recht harmlos, oder?
In Deutschland wurden Kassiererinnen wegen einem Kassenbon in Höhe von 1,30 Euro fristlos gekündigt, nach der Verschwendung von 400 Millionen werden Ministerinnen zur IWF-Chefin befördert. Ein Jammer, dass sich die Kassiererin nicht mit dem Stress durch die Wirtschaftskrise herausreden kann!
Über Frau von der Leyen stand im Spiegel zu lesen: „Als Verteidigungsministerin war Ursula von der Leyen, 59, zuletzt von Pech – manche behaupten auch: vom eigenen Unvermögen – verfolgt. Monat für Monat kamen neue Details der Berateraffäre ans Licht: Insgesamt geht es um Berateraufträge in zweistelliger Millionenhöhe, die das Ministerium ohne Ausschreibung vergeben hatte. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft zwischen Spitzenbeamten und Beraterfirmen steht im Raum, ein Untersuchungsausschuss bearbeitet den Fall seit Januar.“
„Pech“ hatte sie, oder vielleicht auch „Unvermögen“, sagt der Spiegel. Kein Wort über die Strafanzeigen, über die der Spiegel selbst berichtet hatte, und auch nicht über ihren Sohn David, den der Spiegel früher einmal sogar selbst erwähnt hatte. Stattdessen lesen wir das hässliche Wort „Vetternwirtschaft“. Aber das auch nur als „Vorwurf“, der „im Raum steht“. Die Details lässt der Spiegel weg.
Es ist doch beruhigend, dass wir die EU-Kommission und die EZB nun für die nächsten fünf Jahre in guten, kompetenten und ehrlichen Händen wissen!
65 http://www.spiegel.de/politik/ausland/europaeische-union-so-denken-die-deutschen-ueber-die-eu-a-1252954.html
66 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wolfgang-schaeuble-plaediert-fuer-reform-der-europaeischen-union-a-1253733.html
67 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fidesz-spitzenkandidat-vergleicht-eu-kommission-mit-politbuero-16081576.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
68 http://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-fidesz-spitzenkandidat-vergleicht-eu-kommission-mit-politbuero-a-1257171.html
69 http://ec.europa.eu/codecision/statistics/docs/report_statistics_public_draft_en.pdf
70 https://www.spiegel.de/politik/ausland/was-das-eu-parlament-macht-und-was-das-fuer-sie-bedeutet-a-1267702.html
71 https://www.anti-spiegel.ru/2019/die-europawahl-in-deutschen-und-russischen-medien-ein-vergleich/
72 https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-12/iwf-chefin-christine-lagarde-der-fahrlaessigkeit-schuldig-gesprochen
73 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/david-von-der-leyen-mckinsey-und-auftraege-aus-dem-verteidigungsministerium-a2666304.html
74 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-spd-setzt-verteidigungsministerin-unter-druck-a-1230509.html
75 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berater-affaere-bei-der-bundeswehr-strafanzeige-gegen-ursula-von-der-leyen-a-1233811.html
76 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ursula-von-der-leyen-strafanzeige-wegen-des-verdachts-auf-untreue-a-1248746.html
77 https://www.spiegel.de/politik/ausland/ursula-von-der-leyen-christine-lagarde-josep-borrell-charles-michel-vier-fuer-die-eu-a-1275529.html