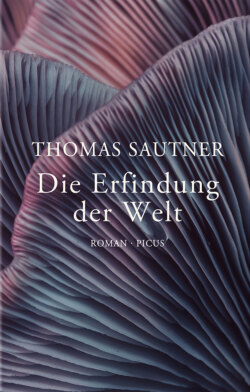Читать книгу Die Erfindung der Welt - Thomas Sautner - Страница 11
- 1 -
ОглавлениеIch hatte mich so weit im Griff, dass ich nicht Hals über Kopf noch am selben Tag losfuhr. Stattdessen recherchierte ich über die auf der Landkarte eingezeichnete Burg, ihre Besitzer und das vom Briefschreiber rot umrandete Gebiet. Weil ich für den nächsten Tag fit sein wollte, ging ich abends früh ins Bett, wälzte mich von einer Seite auf die andere, fand auch mit Atemübungen und Baldriantropfen nicht in den Schlaf, sah um ein Uhr dreiundvierzig zum x-ten Mal auf den Radiowecker, fuhr hoch, nachdem ich endlich eingeschlafen war, träumte Verrücktheiten und brach schließlich in aller Herrgottsfrüh auf, um zwei Stunden später, nach einer Autofahrt wie in Trance, aschbleich und zittrig in der Gegend anzukommen. Welker Weberknecht. Gekleidet in Schwarz. Großartig.
Schloss Litstein war seit 1717 im Besitz der Familie Hohensinn, eines böhmisch-österreichisch-deutsch-niederländischen Adelsgeschlechts, dem es als Wohnsitz diente, weshalb es nicht öffentlich zugänglich war, wie ich bei Wikipedia erfuhr. Das Anwesen lag am Rand der Zweitausend-Einwohner-Gemeinde Litstein auf einem Felsbuckel und bestand neben dem Neuen Schloss aus einer mittelalterlichen Burg sowie einem am Fuß des Felsens errichteten Meierhof und mehreren Wirtschaftsbauten.
Zum Besitz gehörten zwölftausend Hektar Wald samt einem Dutzend teils seegroßer Fischteiche. Nur die drei kleinsten lagen innerhalb der roten Markierung, der große Rest außerhalb und zudem jenseits der Grenze, wo die Familie Hohensinn ebenfalls menschenleeres Land besaß. Natur so weit das Auge reichte. Das einzige Gebäude diesseits der Grenze, das ich auf der Landkarte entdeckt hatte, erwies sich als altes Forsthaus.
Die Burg Litstein tauchte bereits auf, als ich noch etliche Kilometer entfernt war. Wie ein einsamer Finger ragte ihr Turm aus dem Meer des Waldes. Ihr Turm ragte wie der Finger eines Ertrinkenden aus dem Meer des Waldes, so hätte ich es auch schreiben können, aber die Schriftstellerin in mir befand, dass das dem Ort der Romanhandlung eine zu düstere Stimmung verpasst hätte. Da sehen Sie wieder: Selbst wenn Romane auf wahren Begebenheiten beruhen, heißt das gar nichts. Auf die Wahrheit ist kein Verlass. Warum sollte es bei Romanen anders sein als im übrigen Leben. Schließlich hat schon ein Staubkorn mehr als zwei Seiten. Was soll als Wahrheit gelten? Die, betrachtet von oben, unten, rechts oder links? Die gestrige, heutige, übermorgige? Man müsste sich schon wie ein Quantenteilchen herzkopfüber hineinstürzen können in die Menschen, die Dinge und die Ereignisse, um zu erleben, was sie ausmacht. Dann wüsste man mehr über die Welt als sie selbst.
Ich reduzierte das Tempo. In einer breiten, den Horizont einnehmenden Welle rollte eine bewaldete Hügelkette hinterrücks an die Burg heran. Darüber standen aufgefädelt Wölkchen. Sie verrieten, dass in Litstein an diesem Tag der Himmel nach unten gerutscht sein musste, so viele Etagen tief, dass die Wölkchen bäuchlings bereits von den Wipfeln der Fichten und Tannen geneckt wurden. Erde und Himmel berührten einander. Wie lange würde es dauern, bis die Wölkchen es nicht mehr aushielten, sich ganz hingeben würden, völlig aufgelöst?
Eine Weile noch rollte mein Auto hügelab dem Tal entgegen. Während zur Rechten der Wald immer näher rückte, lagen zur Linken einzelne Höfe, glitzernde Teiche, Weideland. Ich genoss es, talwärts zu gleiten. Als flöge ich dem Himmel zu. Erst ganz zuletzt fiel das Gelände stärker ab. Anstatt wie bisher leicht Gas zu geben, war es nötig, dem Wagen Geschwindigkeit zu nehmen. Ich bremste gegen die Gravitation, fuhr auf Litstein zu.
Beim Passieren der Ortstafel irritierte mich etwas. Irgendetwas Befremdliches, oder war es etwas Vertrautes, war mich angesprungen von der Seite her. Von der Wiese über den Straßengraben war es zu mir gehuscht, dann blitzte ein morgendlicher Sonnenstrahl, der sich an der Scheibe brach, und schon war ich zu weit, um zu sehen, was es gewesen war.
Zuerst einmal würde ich zum Marktplatz fahren, dort lag Litsteins einziges Hotel, ich hatte ein Zimmer reserviert. Einfach ausrasten, ankommen, einen Kaffee trinken, mich frisch machen. Das alles in einer halbwegs sinnvollen Reihenfolge, am besten mit dem Kaffee zu Beginn, ja, zuallererst brauchte ich einen Kaffee. Ich parkte den Wagen direkt vor dem Hotel zur Post, nahm es als gutes Omen, dass exakt vor dem Eingangsportal eine Parklücke frei war. Das mochte ich auf dem Land, die freien Parklücken.
»Jo do schau her! Grüß Gott!« Und die Freundlichkeit der Leute, die mochte ich auch. Kaum war ich aus dem Auto draußen und schon gegrüßt. Eine ältere Dame mit Hund.
»Guten Morgen!«, antwortete ich und sie blieb stehen, strahlte mich an wie eine gelungene Überraschung, schüttelte, als könnte sie so viel Glück kaum fassen, die blaustichig dauergewellte Frisur, zerrte ihr Hündchen zur Seite, um mir Platz zu machen, und ließ ihrer Stimmung freien Lauf, indem sie mir ein weiteres »Grüß Gott« wünschte, das ich höflich nickend entgegennahm, wie es sich gehörte für eine so herzlich empfangene Fremde, und ich wiederholte dieses Lächeln und Nicken gerne, wenn auch etwas irritiert, als sie, da war ich an ihr vorbei und hatte die Hand schon an der Hoteltür, mir nachrief: »Willkommen, herzlich willkommen!«
»Ah, Frau Berg!«, begrüßte mich, ich war kaum eingetreten, ein stattlich runder Mann, und sein Schnauzbart vibrierte, als hätte auch er an diesem Morgen nichts anderes herbeigesehnt als mich.
»Lisi kum, na kum scho, d’ Frau Berg is do!« Er flüsterte es zischend Richtung Nebenraum, aus dem auch gleich Lisi herausgeschossen kam, mit glühenden Backen. Nebeneinander standen sie hinter der Rezeption. Und betrachteten mich. Erwartungsvoll.
Ich mache nie auf Diva, es liegt mir wirklich nicht, aber diese Szene schien mir den Verstand zu vernebeln und so fragte ich, freundlich aber doch nachdrücklicher, als es nötig gewesen wäre, ob ich auf der Stelle, gleich mit dem Beziehen des Zimmers, zwei große Tassen Mocca nach oben serviert bekommen könnte.
»Oje«, sagten die Lippen unter dem Schnauzbart, ich sah es wie in Zeitlupe, vielleicht, weil mein Kreislauf noch nicht so recht wollte an diesem Morgen. »Z…i…m…m…m…m…e…e…r«, sagten die Lippen unter dem Schnauzbart, und nun beschleunigten sie: »ist leider keines frei.« Schließlich sei Frühsommer, Hochsaison. Alles voll.
»Owa an Kaffee kennan S’ scho haum.« Lisi nickte aufmunternd. Ergänzte, weil ich nicht reagierte, »einen Kaffee kann ich Ihna schon machen.« Wie rührend, sie sprach eigens Hochdeutsch mit mir.
»Aber ich habe doch reserviert«, sagte ich. (Der Gastauftritt der Diva war vorbei, ich war wieder ganz ich.) »Wie kann es sein, dass kein Zimmer frei ist, ich habe reserviert, gestern, telefonisch.«
Der Schnauzer schien ebenso ratlos wie ich.
»Sie müssen bitte verzeihen«, sagte Lisi, »weil wissen S’, wir haben uns so gefreut, Ihna kennenzulernen, da wollten wir, wissen S’, Ihna nicht absagen. Aber Zimmer haben wir keins mehr frei.«
…
»Das macht aber nix«, sagte der Schnauzer Sekunden später.
»Genau«, sagte Lisi, »das macht nix, weil es gibt eh ein Zimmer für Ihna, viel schöner noch als bei uns. Drüman«, sie hob ihren Arm, als zeigte sie nur ums Eck, »drüben halt, gleich derüben gibt’s eh a Zimmer für Ihna, im Schloss.«
»Wissen Sie, Frau Berg, wir wollten Sie nur kennenlernen«, wiederholte der Patron des Hauses, als hätte er einen Teil des vorangegangenen Gesprächs träumend verschlafen. »Das war halt unser Wunsch, Sie kennenzulernen, Frau Berg.« Und dann, als betonte er es, um den ungläubigen Teil von sich zu beeindrucken: »Frau! … Aliza! … Berg!«
Ich hatte vier Romane unter diesem Namen veröffentlicht. Ich fragte, welches meiner Bücher sie gelesen hätten. Die Reaktion der beiden war eine Melange aus Verblüffung und grundehrlicher Heiterkeit. Nein, nein, Buch hätten sie keines gelesen von mir, sie, Lisi, lese nur Krimis, früher auch Liebesromane, aber nun nur noch Krimis, und Hubert, gell Hubert?, Hubert habe es überhaupt nicht so mit dem Lesen. Nein, aber in der Zeitung, da sei die Frau Schriftstellerin drinnen.
»In welcher Zeitung?«
… Na im Heimatblatt. Da sei sie drinnen.
Im Heimatblatt. Und was sei da gestanden?
Na eben dass sie komme, die bekannte Schriftstellerin eben, sie eben, Aliza Berg, und dass sie herkomme, um einen schönen Roman zu schreiben, über die Gegend und die Leut.
Einen Roman? Einen schönen? Über die Gegend? Und die Leut?
Lisi und Hubert nickten.
Hubert griff beidhändig nach unten, seinen Bauch als Rampe nutzend. Das Kleinformat musste die ganze Zeit aufgeschlagen vor ihm gelegen sein. Sachte hob er es nach oben aufs Pult der Rezeption und drehte es in meine Richtung.
Lisi und Hubert hatten kein Wort erfunden. Ich besah die Doppelseite der Zeitung, das riesige Aufmacherfoto von mir und die fette Schlagzeile.
Ich kann nicht beschreiben, wie sauer ich war.
G!
Er hatte es nicht für nötig empfunden, meine Entscheidung abzuwarten. Hatte das lokale Tratschblatt über meine bevorstehende Ankunft informiert, meine Rechercheabsichten, meine Romanpläne! Bevor ich eingewilligt hatte!
Vor mir, lange vor mir hatte G sich angemaßt zu wissen, wie ich mich entscheiden würde. Hatte es schon zu wissen geglaubt, als ich noch nicht einmal von seiner Idee und seinem Brief ahnte, ja besaß bereits Sicherheit über mich, als ich noch nicht einmal von seiner Existenz wusste. Von Anbeginn war G im Besitz dieser unheimlichen Gewissheit gewesen: dass ich gar nicht anders konnte, als ihm … aufs Wort zu folgen.
Ich starrte noch immer in die Zeitung, starrte auf das Foto von mir, auf die Zeilen, die beschrieben, was ich tun würde. Mein Impuls war, grußlos hinauszurennen, ins Auto zu springen und zurück in die Stadt zu flüchten. Hätte sich mir in diesem Moment jemand in den Weg gestellt und prophezeit, dass ich nicht nur die folgenden Stunden hier in der Gegend verbringen würde, sondern fast ein Jahr, ich hätte ihm ein großkalibriges »Ha!« ins Gesicht gefeuert und mitgeteilt, das könne er dem beschissenen Heimatblatt erzählen.
Als ich im Stechschritt das Hotel zur Post verließ (eigens nicht rennend, eigens darauf achtend, nicht gar zu aufgebracht zu wirken) und ins Auto steigen wollte, um (im Finale eigens mit quietschenden Reifen) zurück in die Stadt zu rasen, fiel mein Blick auf das Tabak-Trafik-Schild an der gegenüberliegenden Hausfassade. Zigaretten. Zigaretten würde ich mir noch rasch kaufen. Ich kreuzte den Marktplatz. Der Stechschritt muss hier besonders entschlossen gewirkt haben, meine Absätze schossen nur so gegen das Kopfsteinpflaster.
Und dann: dieses Schaufenster, dieses Schaufenster der Tabak-Trafik. Flankiert von einfältigen Billetts für Geburten, Taufen, Hochzeiten waren: Bücher ausgebreitet. Romane! Vorwiegend: meine Romane.
»Außergewöhnlich«, sagte ich beim Eintreten, »Literatur in einer Trafik.«
Der Trafikant sah auf. »Die Leute lesen ja sonst nur so was«, antwortete er und sein Zeigefinger zuckte Richtung der illustrierten Magazine und Schundheftchen. Aber wer weiß, meinte er, vielleicht entschlössen sich die Litsteiner ja, Literatur zumindest einmal zu versuchen. »Wenigstens einmal kosten«, sagte er und lächelte zurückhaltend, über seine Augenringe hinweg. So allgemein lächelte er, nicht eigens meinetwegen, oder gar mich an. Nun, vielleicht, vielleicht doch.
Falls er mich als Autorin der Bücher in seiner Auslage erkannt hatte, ließ er es sich nicht anmerken. Ich mochte diese Ungewissheit, sie schuf zwei Varianten von Gegenwart. Ich konnte mir eine aussuchen. Und gleich drauf die andere.
Der Trafikant. Eine seiner grau melierten Haarsträhnen hing zwischen mir und seinem Blick. Beiläufig rieb er sich übers Kinn, seinen Sechstagebart.
Er werde jedenfalls nicht aufhören, Bücher in die Auslage zu stellen. Und wie ich sehen könne, er breitete über dem Kassapult die Arme aus, reibe er den Kunden gute Literatur buchstäblich unter die Nase.
Sieben Bücher lagen vor mir.
Sie streckte den Arm aus und ihre Hand strich mit einem Hauch von Abstand über die Bücher, den ich zu fühlen glaubte, als Luftpolster zwischen ihr und mir.
»Wie wählen Sie die Romane aus?«, fragte ich. Sechs der sieben Titel, die in einer Reihe dicht nebeneinander auf dem Pult lagen, hatte ich gelesen, fünf davon gelungen bis großartig empfunden, über das sechste Buch konnte ich schwer urteilen, es war eines der meinen. Erschienen war es nicht unter meinem Pseudonym Aliza Berg, auf dem Buchdeckel stand der Name meines Schriftstellerfreundes.
Der Trafikant schien meine Frage nicht gehört zu haben, gedankenverloren sah er vor sich aufs Pult.
»Wie wählen Sie sie aus?«, wiederholte ich.
»Lieblingsbücher«, sagte er. »Das da sind alles Lieblingsbücher von mir. Ein Ausschnitt meines Kanons.«
»Wir scheinen einen ähnlichen Geschmack zu haben.« Ich strich abermals über die Romane, berührte sie diesmal vorsichtig mit den Knöcheln meines Zeige- und meines Mittelfingers. »Diese sechs Bücher kenne ich. Das hier nicht, ich nehme es. Und eine Schachtel Smart.«
Er schmunzelte. Diesmal war es eindeutig, er schmunzelte mich an.
»Sie wissen es, stimmt’s?« sagte er. »Smart gibt’s nicht mehr, sind schon lange aus dem Sortiment genommen worden. Waren die besten, wurden aber zu wenig gekauft.«
Ja, ich wusste es. Doch nach meiner Lieblingsmarke zu fragen, immer wieder aufs Neue, in jeder Trafik, bei jeder Gelegenheit, war meine Art des Protests.
»Man darf das Beste nicht aufgeben«, sagte er. »Nie darf man es aufgeben, selbst wenn es nicht mehr existiert.«
Selbst wenn es nicht mehr existiert. Der Satz klang nach in mir. Oder tut er es jetzt erst, beim Schreiben?
Er bückte sich, hantierte hinter dem Verkaufspult. Nur sein Haarschopf war noch zu sehen. Als er auftauchte, hielt er mir ein schmales Tablett entgegen, darauf lag eine einzelne Zigarette.
Es gab sie noch. Bei diesem Trafikanten gab es sie noch! Meine Lieblingsmarke! Er musste sie gehortet haben. Einen ganzen Vorrat unter seinem Pult versteckt halten. Ich sah ihn an. Schelmischer Blick. Dunkle Augenringe.
Ich war schon draußen und einige Schritte gegangen, da kam mir der Gedanke, ob ich umdrehen und es ihm sagen sollte, es ihm einfach sagen sollte. Dass ich vorgehabt hatte, aus Litstein abzureisen, zu flüchten aus dieser Enge, zu flüchten vor diesem G. Dass ich seinetwegen, des Trafikanten wegen aber vorerst bleiben würde. Seinetwegen und seiner Art wegen, Romane in die Auslage einer Trafik eines Zweitausend-Einwohner-Nests zu stellen. Seinetwegen und seiner Vorliebe wegen, Zigaretten und anderes hoffnungslos aus der Mode Gekommenes anzubieten. Seiner Schwäche wegen, Unvernünftiges zu tun, seiner Neigung wegen, an Verlorenem festzuhalten.
Aber das wäre doch komisch gewesen, oder? Wäre es nicht komisch gewesen, ihm das so zu sagen?
Ich ging nicht zurück in seine Trafik, sagte es ihm nicht. Und auch er hatte mir etwas bei unserem ersten Zusammentreffen verschwiegen. Nachdem er mir die Smart aus seinem Geheimvorrat geschenkt hatte, plauderten wir noch eine Weile. Währenddessen rauchte ich, genoss den Geschmack des Tabaks und das Gefühl, das ich damit verband, genoss diese Zigarette, die es draußen in der Welt nicht mehr gab. Hier aber, hier gab es sie. Mein neuer Bekannter, der Trafikant, er hatte einen Vorrat kleinen Glücks angelegt.
Damals kam ich nicht auf die Idee, erst bei meinem nächsten Besuch erkundigte ich mich, weshalb er mir beim Rauchen zugesehen hatte, ohne sich selbst auch eine zu gönnen. Und er sagte: »Die, die ich dir gegeben habe, war meine letzte.«
Die Menschen außerhalb der von G gewählten Grenze, jener roten Markierung auf der Karte, sind irrelevant für den Roman, sind zu vernachlässigen. Sie liegen, befand G, jenseits der literarischen Wichtigkeit. Wie Sie sehen, habe ich mich nicht daran gehalten. G kann mich einmal! Der Trafikant übrigens heißt Peter. Peter Rosenberg. Die Frau mit dem Hund Hedwig Klein. Lisi vom Hotel heißt mit Nachnamen Čerlak, ebenso wie ihr Ehemann Hubert. Sie haben Namen, sie existieren. Sie sind! Die rote Linie, die ziehe ich. Ich bin hier der Diktator. Was ich den Figuren an Gedanken und Gefühlen einschreibe, wird ihnen zur Wahrheit. Und G? … G?! Kann mir den Buckel runterrutschen!