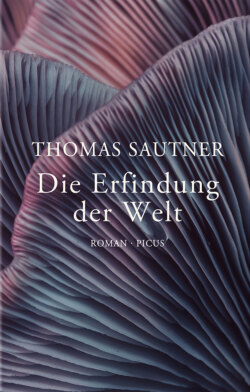Читать книгу Die Erfindung der Welt - Thomas Sautner - Страница 13
- 3 -
ОглавлениеEntspricht etwas im Inneren nicht dem, was es nach außen zu sein vorgibt, ist es eine Enttäuschung. Offenbart sich etwas, ist es eine Überraschung. Und bietet etwas gänzlich neue Perspektiven, gilt es als Attraktion. Drei Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache – dreierlei Sachen. Klar, die alte Geschichte: Gott schuf unsere Gedanken und unsere Gedanken schaffen die Welt.
Es sagt also wenig über Schloss Litstein und viel über mich, dass ich beim Eintreten enttäuscht war. Das Schloss sah innen nicht aus wie ein Schloss.
Außen hatte ich es noch als Schloss gedeutet. Schlicht, doch ein Schloss. Innen waren die Räume hoch und die Decken mit Stuck verziert, doch die Einrichtung, und darauf kam es schließlich an, wirkte bürgerlich. Eine Mischung aus hellen, modernen Möbeln und alten Einzelstücken. Im großzügigen Wohnraum ein Teppich, der von Ikea hätte sein können, Eschenparkett, das im einfallenden Licht der Spätvormittagssonne glänzte, als wäre es eben verlegt worden. Eine Sitzgarnitur, die risikoscheu gemustert war, zeitgemäß zeitlos; dazu ein niedriger Chromtisch mit gläserner Platte, hohe Bücherregale in Weiß, eine Eleganz von Steinway-Flügel.
»Während des Zweiten Weltkriegs schlugen die Russen hier alles kurz und klein, selbst den alten Dielenboden haben sie rausgerissen und in den Kachelöfen verheizt.« Ich hatte nicht danach gefragt, aber Elli, Elisabeth von Hohensinn, hatte meinen Blick richtig zu deuten gewusst. »Du bist nicht die Erste, die sich das Schloss prunkvoller vorgestellt hat«, sagte sie und schenkte mir von ihrer selbst gemischten Zitronenlimonade nach. Die Minzblätter drehten eine stürmische Runde, tauchten im Sog des Strudels ab und – Äonen später – taumelnd gegen die Glaswand auf.
»Aber der Ausblick ist nach wie vor erhaben, nicht wahr?« Sie sog am Strohhalm. »Den Ausblick haben sie uns nicht genommen. Und der ist schließlich das Wichtigste … dieser weite Horizont.« Wir standen, die Limonadengläser in Händen, beim Flügelfenster. Der Burgturm hielt ernst und steinern Wache, alles andere schien umso lichter: der Vorplatz mit seiner kleinen Grünfläche, den Rosensträuchern, den Stelen mit den Zwergenfiguren, dahinter der frisch gemähte samtene Rasen, von dem drei Wege in unterschiedliche Himmelsrichtungen wiesen. Jäh fiel dort das Gelände ab und der Wald begann. Nahe und fern war er, forderte unsere Blicke ein, schien unendlich, wogte in Wellen. Ein fliegender Teppich. Um aufzuspringen, wäre es nur nötig gewesen, das hohe Flügelfenster zu öffnen, auf den Sims zu steigen, die Arme auszubreiten und einen weiten Satz zu machen.
Als sie erfahren habe, sagte Elli, dass ich nach Litstein käme, um hier für einen neuen Roman zu recherchieren, habe sie sich gedacht: was für ein Glücksfall, das müsse sie ausnutzen! Ihre Mädchenaugen, gebettet in die Fältchen und Krähenfüßchen der reifen Frau, blitzten mich an, als spräche Elli nicht über mich, sondern als wären wir zwei Freundinnen, die anlässlich des Eintreffens einer Autorin etwas ausheckten.
Sie habe alle meine Bücher gelesen und schon öfters überlegt, mich zu einer Lesung, einer literarischen Soiree einzuladen, aber na ja, wie das so sei, »man tut’s dann nicht«. Vielleicht habe ihr der Mut gefehlt, mich einfach aus heiterem Himmel anzuschreiben. Umso größer sei nun die Freude. Und was für ein Glück, dass im Hotel zur Post kein Zimmer frei gewesen sei. Sofort habe sie – sie wisse, es sei egoistisch, aber manchmal dürfe man das doch sein, nicht wahr? –, sogleich habe sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den Čerlaks, den Eigentümern des Hotels, aufgetragen, mich nach meinem Eintreffen sofort und unbedingt zum Schloss zu schicken.
»Wir haben genug Platz, Aliza. Ich bin sicher, du wirst dich wohlfühlen! Und keine Sorge, wir lassen dich in Ruhe, du kannst das Schloss so ungezwungen nutzen, als wäre es ein Hotel, wir werden dich nicht bedrängen. Es ist uns einfach eine Freude, meinem Mann Leopold und mir, dich als Gast bei uns zu haben so lange du auch immer möchtest. Verzeih, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen, aber ich freue mich so. Es ist blöd, ich weiß, aber ich rede mir ein, dich irgendwie zu kennen, und das nur, weil ich deine Romane gelesen habe. Ich weiß schon, es ist naiv. Naiv zu glauben, einer Autorin nahe zu sein, nur weil man ihre Bücher gelesen hat.«
»Wenn dir meine Romane so viel gegeben haben, Elli, wird alles, was du nach und nach an mir kennenlernst, unweigerlich eine Enttäuschung sein.«
Sie überlegte.
Das fand ich gut: Sie überlegte, anstatt reflexartig abzuwiegeln.
»Vielleicht«, sagte sie, »vielleicht ist es so. Aber mir ist es das Risiko wert.«
»Und«, ergänzte sie, »mir ist bewusst, dass deine Romane und das Gefühl, das sie vermitteln, nicht mit dir gleichzusetzen sind, dass du privat womöglich anders bist. Vielleicht … vielleicht ist es so wie mit den zwei Seiten einer Medaille.«
Das Bild gefiel mir. Ich – die Medaille. Meine Romane die sichtbare Seite, mein übriges Leben die abgewandte; jene, die ich gerne bedeckt hielt.
»Wenn ich dein großzügiges Angebot annehme und mich hier einquartiere, Elli, hilfst du mir bei meinen Recherchen? … Erzählst du mir die Geschichte der Gegend und der Leute hier? Und auch deine Geschichte? Dürfte ich dich alles fragen, auch Peinliches, auch Fragen, die man für gewöhnlich nicht stellt, und wärst du bereit, ehrlich darauf zu antworten?«
Sie wich zurück, es war nur eine minimale Bewegung, aber ich erkannte ihre Abwehr. Es überraschte mich nicht, allen erging es so, wenn ich ihnen eröffnete, was es bedeutete, für einen Roman zu recherchieren. Was es bedeutete, womöglich sogar Teil eines Romans zu werden.
Die lockere, offenherzige Elli. Mit einem Mal erinnerte sie sich daran, wer sie sonst noch war: Elisabeth von Hohensinn, Gräfin zu Litstein.
Elli war unentspannt, bemüht, es sich nicht anmerken zu lassen. Ich ahnte, welcher Film bei ihr ablief: Ein Reigen aus halb Verdrängtem, aus Intimitäten, Peinlichkeiten, Verfehlungen, schmerzenden Erinnerungen, Kränkungen, alten Prägungen, kurzum Lebensgeheimnissen, die alle Menschen angesammelt haben, die Elli aber, weil es nun einmal ihre, Ellis Geheimnisse waren, als beispiellos empfand und als beispiellos unsagbar. Und nun wollte diese Schriftstellerin all das aus den entlegenen Schichten und schützenden Fältchen ihres Inneren zerren, ins laute Draußen, ins Gegenteil jenes schattendunklen Ortes, wo sie Anlass um Anlass abgelegt hatte, versteckt vor der Welt und vor sich.
Dabei hatte sie sich so sehr gefreut auf diese Schriftstellerin, auf Aliza Berg – die ihr plötzlich wie eine Auftragskillerin gegenübersaß mit unter dem Tisch gezogenem Revolver. Regelrecht herbeigewünscht hatte sie das Eintreffen dieser Frau, deren Bücher sie seltsam berührten auf schöne und zugleich schmerzliche Weise. Etwas, irgendetwas in ihren Romanen stimmte sie sehnsuchtsvoll. Und traurig froh. Und hoffend! Und verloren! Und gerettet! Und alles zugleich.
Doch nun? Intimstes öffentlich machen? Unsagbares aussprechen? Zusehen dabei, wie das, wofür sie keine Worte, ja kaum klare Gedanken besaß, in Sätze gegossen wurde? Schwarz auf Weiß und unwiderruflich und für jeden einsehbar, gedruckt in ein Buch?!
»Elli«, sagte ich, »du brauchst keine Angst zu haben. Gleich, was du mir anvertraust, ich werde es mit Feingefühl behandeln. Außerdem arbeite ich an einem Roman, keiner Reportage oder einem Aufdeckerbuch. Alles, was ich von dir erfahre, werde ich anonymisieren und fiktionalisieren. Ort, Zeit, Personen und Ereignisse werden realen Menschen nicht zuordenbar sein. Du bleibst unerkannt. Wenn im Roman eine Gräfin vorkommen sollte, eine, sagen wir, die jetzt gerade aufmerksam zuhört und mir etwas verschüchtert und dadurch umso sympathischer gegenübersitzt, wird nicht einmal diese Gräfin mit Sicherheit sagen können, ob sie gemeint ist. Ein Rest Rätsel wird immer bleiben, sowohl für die Gräfin im Roman als auch für jene in der anderen Wirklichkeit.
Erzähle mir noch mehr, würde etwa die Gräfin im Roman nun bitten, die wirkliche Gräfin aber einfach schweigen und zuhören und versuchen, sich zu entspannen, und die Autorin, also ich, fortfahren, dass eine Romanfigur meist aus vielen realen Personen zusammengewürfelt ist. Wobei real bei uns Autoren heißt, dass es sich um Menschen handelt, die real atmen und real träumen und real leben – in unserem Autorenkopf; freilich können es auch konventionell reale Menschen sein, auch das kommt vor. Es erklärt, dass sich manche Freunde und Bekannte, selbst wenn ich sie beim Schreiben nicht im Sinn hatte, in einer Romanfigur wiederzuerkennen glauben. Einmal fühlen sie sich geschmeichelt, ein andermal aufs Schlimmste beleidigt, beides zu Unrecht natürlich. Andere, denen ich tatsächlich die Idee für eine Romanfigur zu verdanken habe, wundern sich über die Absurdität jener Figur.«
Elli schwieg nach wie vor. Es war rührend, wie sie mir gegenüber auf der Couch saß, die Füße auf dem Teppich, die Schultern zurückgespannt, die Ellenbogen durchgedrückt und ihre Handflächen gegen die Sitzpolsterung gestemmt. Eine Katze, bereit zum Sprung.
Aufmerksam blickte sie mich an. Erzähle weiter, hieß das wohl, ich will noch mehr davon wissen, wie ihr Schriftsteller so trickst. Doch viel mehr hatte ich nicht zu bieten, also sagte ich: »Wenn ich meine Arbeit richtig mache, Elli, werdet ihr, du und die anderen Charaktere im Buch, realer als real sein. Die Leserinnen und Leser werden mehr von der Romanfigur Elli wissen als du von dir, verstehst du? Der Text wird vorandrängen, die Zeilen, die Buchstaben, immer tiefer, und plötzlich, mit einem Schlag, werden wir alle, auch du, auf dein offenes Herz blicken, dein wild pochendes, verletzliches Herz. Selbst da werden wir nicht haltmachen, wie im Rausch werden wir sein, springen, komme, was wolle, in dein Herz. In diesem Moment, Elli, wirst du deine Wirklichkeit vor Augen haben, deine am tiefsten verborgene Kammer. Es wird dich auflachen lassen oder aufheulen, beides vielleicht. Jenen, die dich lesen, wird es ähnlich ergehen. Weil es diese letzte, innerste Kammer, glaube ich, nur einmal für alle gibt, ein einziges Mal für alle Menschen gemeinsam.«
Elli sah mit leerem Blick an mir vorbei.
Ich hörte meinen Puls, verebbend in den Ohren. Hatte ich das alles laut ausgesprochen? Diese fiebrigen Sätze einer Geistesgestörten?
Ellis Augenbrauen waren zusammengezogen, ihre Arme hatte sie verschränkt. Kein Kurs in Psychologie war nötig, um zu wissen, was in ihr vorging. Sie wollte, nein, sie konnte sich nicht derart blindlings öffnen. Es war doch naheliegend gewesen von Anfang an. Elisabeth von Hohensinn, dreiundfünfzig, Gräfin zu Litstein, durfte einfach nicht riskieren, sich und ihr engstes Umfeld in einem Roman wiederzufinden.
Elli blickte ernst, schloss die Arme noch fester. »Weißt du was«, sagte sie, »scheiß doch der Hund drauf, ich mach’s.«