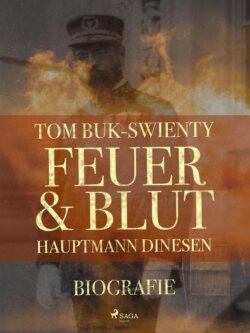Читать книгу Feuer und Blut - Tom Buk-Swienty - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеEs war eine recht anstrengende Reise für den neunjährigen Wilhelm Dinesen, als er von Katholm nach Kopenhagen aufbrach, um Mariboes Realschule zu besuchen. Er fuhr von Grenaa, von dort gab es inzwischen eine direkte Dampfschiff-Verbindung nach Kopenhagen. Während das Schiff Kurs auf das Kattegat nahm, sah er die vertraute Welt aus Feldern, Wäldern, Büschen, Marschland und Strand achteraus versinken. Grenaa, die kleine Provinzstadt, war eine überschaubare Welt, die er gut kannte. Die Stadt hatte einen hübschen kleinen Marktplatz und bestand aus bescheidenen schiefen Fachwerkhäusern. In den 1850er Jahren lebten hier rund 1000 Einwohner. Die beiden Hafenmolen waren nicht ansehnlich, und die einzigen Gebäude am Hafen waren ein zweistöckiger Speicher und ein knappes Dutzend strohgedeckter Hütten, in denen Fischer und Schiffsleute wohnten.
Für einen neunjährigen Jungen muss die Reise in die Hauptstadt Dänemarks einfach überwältigend gewesen sein, auch wenn er sie schon mehrere Male zuvor unternommen hatte. Schon bei der Einfahrt in den Hafen wirkte Kopenhagen imposant und unübersichtlich. Um in den inneren Hafen und weiter bis zur Kvæsthusbroen zu gelangen, wo das Schiff anlegte, musste man zunächst das stark befestigte Fort Trekroner passieren. Es genoss einen legendären Ruf seit dem hitzigen Gefecht mit etlichen Kriegsschiffen Lord Nelsons in der Schlacht auf der Reede im Jahr 1801. Hatte man dieses Fort passiert und danach eine weitere bewaffnete Festungsanlage der Stadt, das Kastell, bot sich vom Deck des Schiffs freie Aussicht auf die vielen Türme und Turmspitzen von Kopenhagen.
Man konnte die Silhouette des Runden Turms erkennen; etwas weiter entfernt die Turmspitze von Schloss Rosenborg; an Steuerbord die Börse mit ihrer berühmten, aus den Schwänzen von vier Drachen gebildeten Turmspitze. Im Osten bei Christianshavn ragte der elegante Turm der Erlöser-Kirche in den Himmel, und in westlicher Richtung drängte sich über die Dächer der Stadt der kantige Turm der Kirche Unserer Lieben Frau.
Täglich legten an der Anlegestelle Kvæsthusbroen an die fünfzig Dampfschiffe an. In Nyhavn lag an der linken Seite ein Gewirr von kleinen Schiffen, zur rechten Hand gab es Wirtshäuser und Hotels. Was einem in Kopenhagen aber zuallererst auffiel, zumindest wenn man aus der Provinz kam, war das Gewimmel von Menschen.
Die Hauptstadt war die bei Weitem größte Stadt des Landes. Sie hatte mehr als zehnmal so viele Einwohner wie Odense, damals die zweitgrößte Stadt des Königreichs. Nach europäischem Maßstab war Kopenhagen mit seinen 130 000 Einwohnern keine richtige Metropole. London zählte 1850 bereits mehr als zwei Millionen und Paris knapp zwei Millionen Einwohner. Aber die Bevölkerungsdichte Kopenhagens war extrem hoch, ungeachtet welchen Maßstab man anlegte. Die Stadt war hinter Festungswällen eingezwängt, die aus dem 17. Jahrhundert, der Zeit Christians IV., stammten. Seit damals hatte sich die Bevölkerung der Stadt versechsfacht, ohne dass mehr Wohnraum entstanden war.
Als Wilhelm Dinesen in die Hauptstadt kam, um hier zu wohnen, war Kopenhagen als Festungsstadt noch immer den Restriktionen der Militärbehörden unterworfen. Um von der Landseite her in die Stadt zu kommen, musste man enge, streng bewachte Tore passieren, die nachts geschlossen wurden. An Markttagen bildeten sich vor den Toren endlose Schlangen vollbeladener Bauernkarren aus dem Umland. Es konnte Stunden dauern, bis die Wagen hineingelassen worden waren, denn zuvor mussten die Bauern erst eine Art Wegegeld entrichten. Zehntausende von Bürgern strömten täglich zu Fuß durch die gefährlich engen Tore. Es kam regelmäßig vor, dass bedauernswerte Passanten unter die Räder eines Fuhrwerks gerieten, das sich zur gleichen Zeit durch die enge Torpassage zwängte.
Um freie Schussbahn von den Wällen zu gewährleisten, erlaubten die Militärbehörden außerhalb der Stadt lediglich den Bau niedriger und schlichter Gebäude. Und dies auch nur unter der Bedingung, dass solche Häuser sofort und ohne Schadenersatz abgerissen werden konnten, sollten feindliche Truppen auftauchen. Noch in den 1850er Jahren galt dies nicht als völlig unwahrscheinlich. Derartige Bedingungen förderten nicht gerade die Baulust in der unmittelbaren Umgebung der Stadt.
Am meisten wurde deshalb innerhalb der Wallanlagen gebaut, wo die Stadt mit ihrem Netz von engen Straßen allmählich aus den Nähten zu platzen drohte. Man baute höher und dichter, und in den Hinterhöfen wurden immer mehr schmale Häuser gebaut. Kopenhagens Stadtbild wirkte vielerorts dunkel und finster. Auch die weit verbreitete Armut fiel sofort ins Auge, wenn man wie Dinesen auf dem Seeweg anreiste. Am Toldboden (Zollamt) entlang nahe der Kvæsthusbroen reihten sich etliche schäbige Katen – neun flache Fachwerkbauten, in denen ungefähr einhundertzwanzig Familien hausten.
In der Hauptstadt herrschte so großer Wohnungsmangel, dass alles bewohnt war, von tristen Dachkammern bis zu den feuchtesten, schmutzigsten Kellerräumen. Bestürzt ließen die Behörden verlautbaren, dass die vermieteten Zimmer bisweilen dermaßen mit Mietern vollgestopft waren, dass diese in sitzender Stellung schlafen mussten.
Hinzu kam, dass nicht nur Menschen in den Häusern von Kopenhagen wohnten. Auch Viehhaltung war innerhalb der Stadt noch üblich. Es war kein ungewöhnliches Bild, wenn eine Kuh durch die Haustür und das Treppenhaus bis hinauf in den ersten Stock geführt wurde. Außer Kühen gab es Tausende von Pferden, und durch die Straßen streunten zahlreiche Hunde. Dazu kamen rund 1000 Schweine, die in den Hinterhöfen gehalten wurden, auch wenn dies verboten war. Wie in den meisten Städten zu dieser Zeit waren Ratten auch in Kopenhagen eine wahre Plage. Die Tiere tummelten sich in den offenen schmutzigen Rinnsteinen der Straßen und Gassen.
Nach einer furchtbaren Choleraepidemie im Jahre 1853, die 5000 Menschenleben forderte, begannen die Militärbehörden sich dem wachsenden Druck zu beugen. 1857 wurden die verhassten Tore abgerissen, und die Stadt konnte sich jetzt über die Wälle hinaus ausbreiten.
Dieser Ausdehnungsprozess begann zu der Zeit, als Wilhelm Dinesen in Kopenhagen ankam. Die Stadt, die er in seiner Kindheit und frühen Jugend kennenlernte, war noch hinter den Wällen zusammengepfercht. Das Menschengewimmel und nicht zuletzt der Gestank des Abfalls und der Fäkalien müssen einen befremdlichen und abstoßenden Eindruck auf ihn gemacht haben. Er war die frische Luft des Meeres, der Marsch und der Wälder gewohnt. Weil der junge Dinesen sich allerdings nur in Kreisen der Oberschicht bewegte, hatte er die schäbigsten Viertel der Stadt natürlich nie erlebt. Und die Hauptstadt bot auch durchaus anderes als nur erbärmliche Wohnverhältnisse.
Da waren Schloss Christiansborg auf der Insel Slotsholmen, Charlottenborg, der Kongens Nytorv und die vornehme Geschäftsstraße Østergade. Die stattliche Amaliegade, die breiteste Straße der Stadt, führte zur Residenz der königlichen Familie, Schloss Amalienborg. Dann gab es noch all die anderen breiten Straßen, die den begüterten Bürgern der Stadt vorbehalten waren: Dronningens Bredgade, Borgergade, Adelgade und Store Kongensgade. Dort lag auch Mariboes Realskole, die Wilhelm Dinesen jetzt besuchen sollte.
Mariboes Realskole, im Volksmund auch nur Mariboes Schule genannt, war genau nach dem Geschmack seines Vaters. Hier verband man eine neuartige, progressive Pädagogik mit Disziplin.
Die Schule war 1833 von dem früheren Kopenhagener Großhändler Carl Rudolph Ferdinand Mariboe gegründet worden. Er hatte kein großes Talent für den Handel und war in den 1820er Jahren Bankrott gegangen. Was sich indes als glücklicher Umstand erwies, denn jetzt musste er sich nach einer anderen Betätigung umsehen. Und tatsächlich fand er zu seiner wahren Berufung. Er wurde Übersetzer für Englisch, Deutsch und Französisch und erhielt eine Anstellung als Lehrer an der Borgerdydsskolen (Bürgertugendschule). Drei Jahre später unterrichtete er auch Englisch an der königlichen Militärakademie. Er entdeckte seine starke Leidenschaft für das Englische und erwarb schnell den Titel eines Professors für diese Sprache.
Doch Carl Mariboe wollte eine eigene Schule gründen. 1832, ein Jahr bevor sein Wunsch Wirklichkeit wurde, war er zu einem längeren Studienaufenthalt in England gewesen, dort hatte ihn das englische Schulsystem fasziniert. Besonders beeindruckt war er von einem der großen Pädagogen der Zeit, einem gewissen James Hamilton. Dessen aufsehenerregende Grundphilosophie beruhte darauf, Sprachen nicht durch Büffeln von Verben und Grammatik zu erlernen, sondern sie stattdessen in organischer Form zu vermitteln. Bei dieser Herangehensweise eignet sich der Schüler die fremde Sprache am besten dadurch an, dass er sie zunächst hört, um dann zu lernen, Texte aus der fremden Sprache wortgetreu in die Muttersprache zu übertragen.
Carl Mariboes Schule wurde auf der Grundlage dieser völlig neuen Pädagogik gegründet. Sie beinhaltete auch die revolutionäre Idee, dass der Lehrer in dem einzelnen Schüler ein Individuum sehen müsse und der Schüler Anspruch auf die Aufmerksamkeit des Lehrers habe. Der Unterricht sollte also nicht auf Drohungen, Prügel und Paukerei basieren. Dafür erwartete man, dass die Schüler äußerst gute Manieren und Engagement zeigten.
Geschah dies nicht, was oft der Fall war, wurde der Schüler doch zum Prügelknaben. So meinte ein Lehrer namens J.C.S. Neve, der in Wilhelm Dinesens Schulzeit etliche Jahre Rektor war, dass »eine angebrachte Ohrfeige, wenn der Schüler in flagranti [das hieß in diesem Fall bei schlechtem Betragen] ertappt wurde, eine bessere Wirkung erzielen würde als langes Reden und ausgeklügelte Disziplinarstrafen«.
Somit herrschte trotz allem eine gewisse Ordnung, was A.W. Dinesen sicherlich gefiel, als er eine Schule für seinen Sohn wählen musste.
In ihren ersten Jahren war die Schule in einem bescheidenen Gebäude in der Boldhusgade nahe am Frederiksholms Kanal untergebracht. Die Schülerzahlen stiegen aber so schnell, dass sie in andere großzügigere Räumlichkeiten in der vornehmen Store Kongensgade umziehen konnte. Mit ihrem Angebot des allerneuesten Standes auf dem Gebiet der Pädagogik wurde die Schule zu einer Modeerscheinung unter vornehmen und ehrgeizigen Eltern. Gleichzeitig richtete Carl Mariboe es klugerweise so ein, dass die Schule auch als militärische Vorschule für künftige Offiziere diente. Dadurch sicherte er der Schule einen anhaltenden Zustrom von Schülern, ungeachtet der pädagogischen Moden.
Wilhelm Dinesen hat keine Beschreibungen seiner Schulzeit hinterlassen, aber vor dem Hintergrund der Unterrichtspläne der Schule und anhand von Erinnerungen gleichaltriger Schüler lässt sich ein Eindruck von Wilhelm Dinesens Lehrern und ihren Unterrichtsmethoden gewinnen. In Geografie und Geschichte hatte er Herrn Ipsen. Er war ein »kleiner, dicker Mann von würdigem Aussehen, um seinen Hals trug er eine Schnur mit einem Lorgnon, das ihm ebenso oft auf dem Rücken wie vor der Brust baumelte«, schreibt der ehemalige Schüler Arthur Abrahams in seinen Erinnerungen. »Er hatte ein unglaublich hitziges Gemüt und konnte es in seiner Raserei so weit treiben, dass er sich selbst die Haare raufte und sich an den Ohren zog.«
Wenn sich dieser Zorn gegen einen undisziplinierten Schüler richtete, konnte es außerordentlich brutal zugehen. Es wurde dann ausgesprochen unangenehm, wie Abrahams sich erinnert: »Ipsen sitzt wie gewöhnlich da und hat die Landkarte vom Tisch bis unters Kinn gezogen. Vor ihm steht ein unglücklicher Sünder, der zum Thema deutsche Geografie aufgerufen ist. Ich kann diese Deutschland-Karte immer noch vor mir sehen; die Farben waren ziemlich blass, nur das kleine Fürstentum Reuß war mit einem sehr kräftigen Rot gekennzeichnet.
Ipsen: ›Wo liegt Halle?‹
Der Sünder streckt verlegen den Zeigefinger aus, deutet aber noch nicht auf die Karte.
Ipsen: ›Zeig es! Zum Teufel, zeig es!‹
Der Sünder nimmt allen Mut zusammen und setzt seinen Zeigefinger auf Reuß, aber im gleichen Moment bekommt er ein paar hinter die Ohren, dass er auf den Boden purzelt. Als er wieder auf den Beinen steht, sagt er in weinerlichem Ton: ›Ich habe herausgefunden, dass man nach Halle kommt, wenn man von Reuß eine gerade Linie auf der Karte nach oben zieht.‹
Ipsens einzige Antwort ist: ›Na siehst du, es hat geholfen!‹«
Bei dem dicken Ipsen mit der Nasenklemmen-Brille sollten Wilhelm Dinesen und seine Klassenkameraden Grundtvigs Historisk børnelærdom (Historisches Wissen für Kinder) auswendig lernen und dann im Unterricht aufsagen. Abrahams zufolge war dies leichter gesagt als getan, »denn es enthielt auf knapp zwanzig Seiten die gesamte Weltgeschichte. Es begann mit den Worten: ›Die ältesten Königreiche der Welt, die Aufsehen erregten, waren das assyrische in Asien und das ägyptische in Afrika.‹«
Das Heft enthielt auch so erbauliche Aussagen wie »Nero, dieser Abschaum, verfolgte die Christen.«
Einige Lehrer hatten mehr Humor als andere. Im Fach Schreiben hatte der kleine Wilhelm einen lebhaften Lehrer namens Eduard Bjerring. »Ein großer Teil der Unterrichtsstunde verging damit, dass der Lehrer Schreibfedern für die Schüler spitzen musste«, erinnert sich Abrahams. Die Federn verschlissen schnell und begannen zu klecksen. »Wenn es mitten in der Stunde ertönte: ›Herr Bjerring, meine Feder kleckst!‹, antwortete Bjerring stets mit unerschütterlicher Ruhe: ›Dann klecks zurück, mein Freund!‹«
An Mariboes Schule gab es ungefähr zweihundert Schüler und gut dreißig Lehrer. Die Tage waren lang. In der ersten Klasse hatte Wilhelm zweiunddreißig Stunden Unterricht in der Woche, in den höheren Klassen zweiundvierzig. Ab der ersten Klasse wurden Dinesen und seine Kameraden in Dänisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte, Geografie, Geometrie, Arithmetik, Naturlehre, Naturgeschichte, Schreiben und Zeichnen unterrichtet.
In den Unterrichtspausen auf dem Schulhof ging es lebhaft zu. Einer der berühmtesten Absolventen der Schule, der Dichter und Schriftsteller Holger Drachmann, schrieb, dass die meisten Schüler »lebhafte Jungens« waren. In den Pausen »prügelten wir uns, schlossen Freundschaften ... und es wurden alle möglichen Streiche ausgeheckt. Es war eine richtige Jungenschule«. Und wie er sich erinnert, war es auch in erster Linie »eine aristokratische Schule«. Der dänische Kronprinz und der spätere König von Griechenland besuchten ebenfalls diese Schule.
Wilhelm Dinesen hatte keinen weiten Schulweg. Sein Vater hatte wie erwähnt ein Haus in der Kronprinsessegade gekauft. Es lag so nahe an der Schule, dass Wilhelm nur die Dronningens Tværgade hinuntergehen und dann links in die Store Kongensgade einbiegen musste, und schon war er da.
Die Kronprinsessegade war – natürlich – eine der exklusivsten Straßen der Stadt. Sie war bekannt für ihre dreistöckigen Gebäude in harmonischem, klassizistischem Stil mit ebenmäßigen Fassaden. Die Gebäude waren nach der großen Feuersbrunst Kopenhagens im Jahr 1795 erbaut worden. In der Kronprinsessegade schien das lärmende, überfüllte, von Menschen wimmelnde Kopenhagen weit weg zu sein.
Von den Wohnungen in den obersten Etagen hatte man Aussicht auf Schloss Rosenborg und auf etwas ganz Ungewöhnliches, eine Grünanlage mitten in der Stadt – Kongens Have, ein großer, einladender Park. Man konnte ihn direkt von der Kronprinsessegade aus betreten. Entlang des Gitters, das den Park umgab, standen etliche Verkaufsbuden, die von rechtschaffenen Händlern betrieben wurden. Der Aufsichtsbeamte für städtische Ordnung hatte dafür gesorgt, dass Kneipenwirte, Lebensmittelhändler, Bierzapfer, Schlachter oder andere, deren Gewerbe Lärm oder Geruch verursachten, in der Kronprinsessegade keinen Handel treiben durften.
Die wohlhabenden Bürger wetteiferten darum, in der Kronprinsessegade zu wohnen. Wer etwas auf sich hielt – geachtete Großhändler, Bankiers, Kammerherren, Generäle, Kapitäne, angesehene Professoren, berühmte und finanziell gut gestellte Künstler sowie bekannte Politiker –, zog in diese Straße. Auch der Gutsbesitzerstand und der Adel, zu deren Mitgliedern oft Kammerherren, Offiziere und Politiker zählten, sorgten dafür, dass sie ihre Winterwohnungen in diesen Prachtbauten bekamen. Hier gab es hohe, helle Zimmer, kassettierte Wände, getäfelte Balustraden, vergoldete Simse, Deckenrosetten und Suiten.
Für die Familie Dinesen begann die Wintersaison einige Wochen nach den großen Herbstjagden. Dann fuhr die gesamte Familie mit dem Schiff von Grenaa nach Kopenhagen. Hier nahm man in den Wintermonaten an einer Fülle von Gesellschaften, Bällen, Konzerten und Besuchen im Königlichen Theater teil. Man unternahm Spaziergänge auf den Wällen und an Langelinje entlang, und die jüngeren Familienmitglieder betätigten sich im Schlittschuhlaufen und Fechten.
Karen Blixen beschrieb später in ihrer Erzählung »Ib und Adelaide«, wie eine solche Wintersaison in Kopenhagen für den Gutsbesitzerstand verlief. Historikern zufolge zeichnet ihre Beschreibung ungeachtet aller Poesie ein treffendes und wirklichkeitsnahes Bild des damaligen gesellschaftlichen Lebens:
»Sozial und gesellschaftlich gesehen war die Saison von der Eroberung Kopenhagens durch den Landadel geprägt ... Alte graue und rote Palais in den Straßen und an den Plätzen, die in der Weihnachtszeit blind und stumm gewesen waren, begannen sich zu rühren und öffneten die Fenster. Sie wurden vom Keller bis zum Dachboden geheizt, gereinigt und gewienert und strahlten an festlichen Abenden durch doppelte Reihen hoher Fenster mit karmesin- und rosenroten Seidengardinen hinaus in eine dunkle und eiskalte äußere Welt. Schwere Tore, die monatelang verriegelt gewesen waren, wurden geöffnet, um feurige, schnaubende Pferdegespanne hinauszulassen, die auf dem Seeweg aus Jütland und von den Inseln hergebracht worden waren. Auf den Kutschböcken der Landauer und Coupés unerschütterliche Kutscher in pelzgefütterten Umhängen. An den Livreen konnten die Kopenhagener auf der Straße die glänzenden Fahrzeuge voneinander unterscheiden: Hier kamen die Danneskiolds, die Ahlefeldts, die Frijs und die Reedtz-Thotts auf dem Weg zum Hofe, zu den Theatern oder um sich gegenseitig zu besuchen. Ihre Karossen ließen auf der steinernen Brücke lange Funkenregen hinter sich. Alle Pferde trugen an den Stirnriemen sogenannte Blinker, die kleinen, glänzenden Scheiben, die dem Adel vorbehalten waren. Die alten Häuser bekamen neue Stimmen, Musik strömte in der Winternacht aus ihrem Innern. Nachtschwärmer blieben draußen stehen und hauchten in ihre kalten Hände. Und drinnen tanzten sie.
Eine neue Melodie gab es auch im Klangbild der Straßen, denn in der Konversation der bedeutenden Großgrundbesitzer waren die verschiedensten heimatlichen Mundarten zu hören. Die ganze Saison hindurch erklangen in mondänen Straßen, Theaterfoyers und königlichen Sälen kräftige, muntere jütische, fünische und Langeländer Töne aus dem Mund äußerst elegant gekleideter Menschen, in Pelz oder Uniform, oder im Frackhemd und geschmückt mit Orden. Die Mädchen von den Herrenhöfen ließen sich von den Stadtfräulein mit einem Blick unterscheiden: rank und schlank, mit klarer, reiner Haut, der Wind und Wetter nichts anhaben können, diszipliniert und stets zum Lachen aufgelegt, kühne Reiterinnen, unermüdliche, dahinschwebende Tänzerinnen; reißende Bärenjunge, gerade aus dem Winterschlaf erwacht und fest entschlossen, in einem drei Monate dauernden Märchen Revanche zu nehmen für Ausritte im Regen, Handarbeit, Vorlesen und frühes Zubettgehen.«
Wenn die Familie Dinesen dann im Laufe des Aprils die Großstadt wieder verließ, wohnte Wilhelm bei einem guten Freund seines Vaters, dem Reichsgrafen und früheren Finanzminister Wilhelm Carl Eppingen Sponneck und dessen Familie. Sponneck war einer der glühendsten Befürworter des Gesamtstaats. Zu der Zeit, in der Wilhelm bei der Familie wohnte, war Sponneck Generalzolldirektor. Russland hatte als Bedingung für seinen Druck auf Preußen im Zusammenhang mit dem Dreijährigen Krieg den Weiterbestand des alten dänischen Gesamtstaats unter einer konservativen Regierung verlangt. Aber die Konservativen verloren nach und nach ihre Macht, die Nationalliberalen gewannen erneut an Boden. Mitte der 1850er Jahre war im Kabinett kein Platz mehr für einen Mann wie Sponneck, der Holstein als einen ebenso wichtigen Teil des Reiches ansah wie Schleswig.
Sponneck war ein lebhafter kleiner Mann mit kräftigem Backenbart, akkurat frisiert und mit peinlich genau gezogenem Scheitel, voller Tatkraft und Willensstärke.
Bereits in jungen Jahren hatte er im Zollkammerkollegium Karriere gemacht und war Verfasser eines Buches mit dem Titel Om Toldvæsen i Almindelighed og det danske Toldvæsen i Særdeleshed (Über das Zollwesen im Allgemeinen und das dänische Zollwesen im Besonderen). Unmittelbar sollte man nicht glauben, dass ein solcher Mann soviel Einfluss haben konnte. Aber in einer Epoche, in der Dänemarks Handel zu blühen begann, und in der man auch in Kopenhagen gern wirtschaftliche Vorteile aus der Gemeinschaft mit den Herzogtümern Schleswig und Holstein ziehen wollte, besaßen Männer mit Fachkenntnissen in Zollfragen große Durchsetzungskraft.
Auf seinem Gebiet, Zoll, Finanzen und Abgaben, war Sponneck ebenso versiert und energisch wie A.W. Dinesen als Gutsbesitzer und Soldat. Obwohl er wie sein Freund auf Katholm ein Mann des Gesamtstaats war, ging er darauf ein, 1848 als vom König ausgewähltes Mitglied der nationalliberal orientierten Reichsversammlung beizutreten. Er wurde Dänemarks erster Finanzminister nach der neuen Verfassung und setzte etliche grundlegende Reformen durch. Unter anderem führte Sponneck die Briefmarke ein, denn als einer der Ersten erkannte er darin eine wichtige und gewinnbringende Einkommensquelle für den Staat. Er war ein Zahlenmensch, aber deshalb beileibe kein Langweiler. Das Motto auf seinem Wappen lautete »Fremad!« (Vorwärts). Politisch war er sicherlich konservativ, aber auf den Gebieten Finanzen und Kommunikation war er ein Mann der Zukunft. Schon bald sollte er ein glühender Anhänger eines weitmaschigen Eisenbahnnetzes und der Einführung des Telegrafen werden.
Sponneck und seine gleichfalls adlige Frau Antoinette Siegfriede, eine geborene Lowzow, hatten drei Kinder. Wilhelm fügte sich in die Familie ein und entwickelte ein fast brüderliches Verhältnis zum ältesten Sohn des Hauses, der ebenfalls Wilhelm hieß (benannt nach seinem Vater). Aber als Gast genoss der junge Dinesen größere Freiheit als Sponnecks eigene Kinder. So fand Wilhelm in Kopenhagen, weit weg von seinem dominanten Vater, einen Freiraum für die weitere Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit. Auch in der Schule konnte Wilhelm mehr oder weniger er selbst sein.
In den Jahren, in denen er bei der Familie Sponneck wohnte, zeichnen sich zwei parallele und doch sehr unterschiedliche Bilder des Schülers Wilhelm ab. Das eine zeigt einen beliebten Jungen, der Stärke, Selbstsicherheit und eine starke Anziehungskraft auf Schulkameraden und Lehrer ausstrahlt. Unter den Schülern war er oft der Mittelpunkt. Er besaß eine natürliche Autorität und verfügte über ein imponierendes Wissen über Pferde, Jagd, Wildhege und Fischerei, beliebte Themen auch bei seinen Mitschülern.
»Er sprach mit einem gewissen Selbstbewusstsein über alle möglichen Themen, ganz gleich welche«, heißt es in einem Porträt des jungen Dinesen. »Den größten Eifer zeigte er jedoch, wenn es galt, ein Fest oder eine andere Lustbarkeit zu besuchen.«
Das andere Bild zeigt einen Jungen, der das Bedürfnis hatte, seine eigenen Wege zu gehen, und hinter dessen lustigem und selbstsicherem Äußeren sich auch Sensibilität und Zerbrechlichkeit verbargen. Dass Wilhelm seine Eigenheiten hatte oder »merkwürdig« war, wie seine Schwestern es nannten, zeigte sich zum Beispiel darin, dass er ohne Rücksicht auf Mode, Wind und Wetter im Sommer gern eine Pelzmütze trug und aus irgendeinem Grund im Winter am liebsten in Sommerkleidung ging.
Seine Zerbrechlichkeit kam zum Ausdruck, als sein Vater A. W. Dinesen irgendwann beschloss, den Sohn von Mariboes Schule zu nehmen. Wilhelm zeigte so viel Talent, dass der Junge nach Meinung des Vaters auf eine noch bessere Schule gehen sollte. »Wilhelm war so verzweifelt, dass er ganz krank wurde und eine Gastritis bekam. Er lag da und fantasierte wild von den ekelhaften neuen Jungen und den ekelhaften Lehrern«, berichtet seine Schwester Anna. »Graf Sponneck musste A.W. Dinesen rufen, und als dieser sah, wie unglücklich sein Sohn war, versprach er, dass Wilhelm weiter auf seine alte Schule gehen dürfe, sobald er wieder gesund sei. Daraufhin kehrte die gute Laune zurück, und eine gründliche Besserung trat ein.«
Diese Geschichte zeigt natürlich auch, dass der alte Dinesen nicht nur aus Stahl und Feuer war. Er konnte immer noch Empathie zeigen, und in dieser Situation tat dies seinem Ansehen keinen Abbruch. Der Sohn kam auf der Schule gut zurecht. In seinem Abschlusszeugnis 1861 erzielte er in einer Klasse von vierzehn Schülern die dritthöchste Durchschnittsnote. Seine Leistungen waren allerdings nicht in allen Fächern gleich gut. In Englisch und Geschichte musste er sich mit der mittleren Note »g« für gut begnügen. Dafür bekam er in allen anderen Fächern die zweithöchste Note, ausgenommen in Naturgeschichte und Naturlehre. Hier erhielt er die Höchstnote.
Trotz seiner offensichtlichen Sensibilität hielt er zur Zufriedenheit des Vaters sicher Kurs auf die zu erwartende nächste Station: die Landkadetten-Akademie.