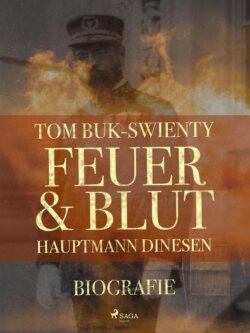Читать книгу Feuer und Blut - Tom Buk-Swienty - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Feuer und Blut
Оглавление12 Boulevard du Temple, Paris, Freitag, 26. Mai 1871. Wie die vergangenen Tage beginnt auch dieser Morgen mit einem gewaltigen Spektakel. Im Lärm fliegender Steine, berstender Fenster und pfeifender Kugeln kriecht der fünfundzwanzigjährige dänische Offizier Hauptmann Wilhelm Dinesen vorsichtig ans Fenster der Wohnung, in der er übernachtet hat, um die Kämpfe zu verfolgen, die auf dem Boulevard du Temple im östlichen Teil von Paris wieder aufgeflammt sind.
Ein Bürgerkrieg wütet in der französischen Hauptstadt, und vom Fenster aus kann Dinesen direkt auf die Barrikade blicken, um die auf dem Boulevard gekämpft wird. Eine Gruppe Aufständischer, die sich Kommunarden nennen, halten noch immer gegen eine gewaltige Übermacht an Regierungstruppen stand, die in die Stadt einmarschiert sind. Zwei Monate zuvor hatten die Kommunarden die Macht in Paris übernommen – mit dem erklärten Ziel, die französische Hauptstadt vom restlichen Frankreich abzuspalten. Doch nun haben sie die Stadt nicht mehr in der Hand und kämpfen einen letzten verzweifelten Kampf gegen die Regierungssoldaten.
Vom Fenster aus sieht Dinesen eine Kommunardin auf den Barrikadenwall springen. Sie ist jung, kräftig und zornig. Sie schreit und schwingt ihr Gewehr. Dann legt sie die Waffe an und feuert auf die Feinde, die an den Toren und hinter den Fenstern des Boulevards Deckung suchen. Völlig ungeschützt lädt sie ihr Gewehr nach und schießt erneut. Sie achtet nicht auf die um sie herumfliegenden Kugeln. Der Wahnsinn des Kampfes hat sie gepackt. Es muss furchtbar enden. Und es endet furchtbar. Sie wird getroffen, lässt das Gewehr fallen und taumelt verletzt in einen Graben hinter den Barrikaden, der bereits voller Toter und Verletzter ist.
Mit ihrem Fall ist der Widerstand der Barrikade gebrochen. Hauptmann Dinesen sieht, wie die Soldaten dagegen anstürmen. Ein Soldat springt auf die Barrikade, auf der zuvor die Frau gestanden hat. Sie liegt ihm zu Füßen im Graben, er richtet seinen Gewehrlauf auf sie. »Schieß nicht, schieß nicht!«, schreit die Frau. Deutlich hört Dinesen ihre Stimme, sie ist voller Todesangst. Doch der Soldat zögert nicht. Er drückt ab.
Weitere Soldaten kommen hinzu und postieren sich bei den Verletzten hinter der Barrikade. Ein hohles Dröhnen ist zu hören. Einem Verletzten nach dem anderen wird in den Kopf geschossen. Dies ist kein Krieg. Es ist eine Schlächterei. Wilhelm Dinesen weiß auch, was diese Entwicklung für ihn persönlich bedeutet. Auch er ist nicht mehr in Sicherheit, obwohl er nicht zu den Kämpfenden gehört, sondern den Bürgerkrieg in Paris privat als ausländischer Beobachter verfolgt hat. Bisher wurde dies von den streitenden Parteien immer respektiert. Doch in dieser Situation kann sich niemand mehr sicher wähnen. Er muss verschwinden.
Er stürzt aus der Wohnung, die Treppen hinunter, vorbei an aufgereihten Leichen und Verletzten. Er erreicht den Hinterhof, von hier aus kann er die großen Boulevards erreichen. Um dorthin zu kommen, muss er durch eine kleine Gasse, sie schwimmt im Blut der Toten und Verletzten. Als er endlich auf den offenen Boulevards steht, sieht er zum ersten Mal das unglaubliche Ausmaß der Zerstörung. Die ganze Stadt, ganz Paris, atmet »Feuer und Blut«. Das ist die einzige Formel, mit der er diesen Wahnsinn beschreiben kann. »Feuer und Blut«. Straße um Straße niedergebrannte, qualmende Häuser, vielerorts quillt schwarzer Rauch aus den Ruinen. An anderen Stellen flackern die Flammen in einem letzten Totentanz unter dem grauen, regnerischen Himmel.
Ja, es regnet tatsächlich. Zum ersten Mal seit Wochen regnet es. Der Himmel weint. So ist es wohl. Das Ausmaß der Zerstörung ist unfassbar. Viele der berühmtesten Gebäude der Stadt bestehen nur noch aus Schutt, Mauerbrocken und Asche. Die Oper, die Tuilerien, der Louvre, das Hôtel de Ville. Dasselbe gilt für den Opernplatz, die Place Vendôme und die Place de la Bastille.
Dinesen hat das Gefühl, tief in einem Albtraum zu stecken, der mit jedem Schritt, den er weiter in die Stadt hineingeht, intensiver wird. Die Sinneseindrücke dringen wie spitze Pfeile auf ihn ein. In den Rinnsteinen und auf den Bürgersteigen liegen ganze Reihen von Leichen: hingerichtete Aufständische, viele von ihnen Zivilisten, viele von ihnen Frauen. Wie eine düstere Symphonie ist das Gewehrfeuer und das Dröhnen der Kanonen von den Kämpfen zu hören, die in anderen Vierteln der Stadt noch immer ausgefochten werden. Die düstersten aller Geräusche sind jedoch die knatternden Schusssalven der Hinrichtungskommandos. Dinesen sieht, wie Bürger aus ihren Kellern und Wohnungen gezerrt werden, in denen sie sich versteckt haben.
Ohne Gerichtsverfahren werden diese Menschen – Frauen und Männer, die verdächtig sind, sich an dem Aufstand beteiligt zu haben – in langen Reihen an die Hausmauern gestellt und auf der Stelle erschossen. Erst mit einer Salve in die Brust, dann mit einer Kugel, die den Gefallenen von den Soldaten sicherheitshalber in die Stirn geschossen wird.
Hauptmann Dinesen hat trotz seines jugendlichen Alters bereits sehr viel Krieg und Gewalt gesehen und erlebt. Er ist ein Veteran des Dänisch-Deutschen Krieges 1864 und hat 1870–71 als Freiwilliger auf der französischen Seite im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft, der erst vor wenigen Monaten zu Ende ging. Doch was er hier in den Straßen von Paris sieht, ist ungeheuerlich. Ekel steigt in ihm auf, als er diese abgestumpfte Vernichtung von Menschenleben um sich herum beobachtet. Vor allem kann er den Blick nicht von den zum Tode verurteilten Menschen abwenden, die vorgeführt und an die Mauern gestellt werden. Die Art, wie sie in den Tod gehen, lässt ihn nicht los.
Schweigend, resigniert und mit gleichgültigen Blicken lassen sie sich erschießen. Nicht einer von ihnen leistet Widerstand. Sie wissen, dass es vorbei ist.
Dinesen geht an einer Gruppe Gefangener vorbei, die noch nicht erschossen wurden und aus einem unbekannten Grund zunächst in einen anderen Stadtteil transportiert werden sollen. Unter den Gefangenen ist ein Mann, der hinkt.
Dinesen hört, wie ein Soldat seinen Offizier fragt: »Hier ist einer, der nicht Schritt halten kann, er hat eine Wunde am Bein. Was soll ich machen?«
»Erschieß ihn!«
Und mit dem Dröhnen des Schusses in den Ohren setzt Wilhelm Dinesen sich auf eine Bank am Boulevard de Sébastopol in die Nähe eines Regiments Soldaten, die ihre Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt haben. Auf der Bank neben ihm sitzt eine alte, ärmlich gekleidete Frau.
Zunächst sitzen sie schweigend nebeneinander. Einen Kilometer östlich von ihnen toben die Kämpfe am Friedhof Père-Lachaise, hin und wieder fliegt ihnen eine Granate über den Kopf.
Während sie dort sitzen, wird ein Bürger in Hemdsärmeln und mit der Kopfbedeckung eines Zivilisten aus einem Gebäude gezogen und zu einem Zeitungskiosk in der Nähe geführt. Aus der Tür des Kiosks ragen die Füße einer Leiche. Dinesen beobachtet den Vorgang. Dem Gefangenen wird die Mütze vom Kopf geschlagen. Er legt die Hände auf den Rücken und blickt ruhig vor sich hin. Ein Schuss fällt. Der Mann fällt um, in die Brust getroffen. Einer der Soldaten tritt an ihn heran und schießt ihm eine Kugel in die Stirn. Neben dem Kiosk steht eine Gruppe Offiziere. Sie drehen sich nicht einmal um und unterhalten sich einfach weiter.
Dinesen wendet sich an die alte Dame.
»Wart ihr gute Republikaner in diesem Viertel?«, erkundigt er sich und deutet damit an, dass die meisten Kommunarden radikale Republikaner und Sozialisten waren, die eine Republik wollten, die sich auf Freiheit, Gleichheit und weitgehende demokratische Rechte für die Bürger gründete.
»Ja, das waren wir«, erwidert sie.
»Und sind hier viele exekutiert worden?«
»Alle! Sowohl die, die gekämpft haben, als auch die, die nicht gekämpft haben. Man hat sie erschossen, mein Herr, so wie man ihn dort drüben erschossen hat, wie Sie gesehen haben. Man hat sie an den Haaren die Straße hinuntergeschleift.«
Sie steht auf und geht.
Auch Dinesen macht sich wieder auf den Weg – tiefer hinein in ein Inferno. Denn anders kann diese Welt, die jegliche Humanität, jedwede moralische Basis und Haltung verloren zu haben scheint, nicht beschrieben werden.
Am Théâtre Français kommt er an einer Barrikade vorbei, in deren Graben seiner Schätzung nach ungefähr dreißig Leichen liegen. Ein Karren wird vor den Graben gezogen. Soldaten werfen die Leichen auf die Ladefläche. Währenddessen laufen neugierige Zuschauer zusammen, Bürger, die weder am Aufstand teilgenommen noch damit sympathisiert haben. Sie sehen zu, während einer der Soldaten »einer Leiche die Hose auszieht und ihr einen Schlag auf das entblößte Hinterteil versetzt. Das Publikum lacht.«
Als der vollbeladene Karren davonrumpelt, stößt, wie es Dinesen später beschreibt, »ein Rad an den Kopf einer Leiche und rollt darüber hinweg«.
»Das kann nicht schaden«, hört er den Kutscher sagen. »Wenn er nicht richtig tot war, dann hat’s ihm gut getan.«
In dem Moment, als Dinesen das knirschende Geräusch der Radfelge des schweren Karrens auf dem Schädel hört, ist ihm bewusst, dass er jetzt – jetzt – genug hat.
In den vergangenen sechs Monaten waren seine Sinne in höchstem Maße angespannt, das Adrenalin hat gepumpt. Ununterbrochen war er in Bewegung geblieben. Er hatte den völligen Zusammenbruch der französischen Armee erlebt, danach den blutigen französischen Bürgerkrieg. Es war ein durchaus verlockender und intensiver Wahnsinn gewesen, der beinahe etwas Abenteuerliches an sich gehabt hatte. Das Gefühl, an etwas Großem teilzunehmen, ein welthistorisches Ereignis zu erleben, hatte ihn mit erregtem Kribbeln erfüllt.
Doch jetzt, jetzt ist es zu viel. Es scheint, als würde an diesem Tag alles auf den Kopf gestellt. Es ist der 26. Mai 1871. Wilhelm Dinesen fragt sich nach dem Sinn des Ganzen und kann Tod und Vernichtung nicht mehr ertragen. Er spürt eine sehr tiefe Müdigkeit. Und als er diese Müdigkeit erst einmal zugelassen hat, lässt sie ihn nicht mehr los, er fühlt sich schlapp, kraftlos und missmutig. Zum ersten Mal seit über einem halben Jahr geht ihm durch den Kopf, dass es Zeit ist, nach Hause zu fahren, zum Herrenhof seiner Väter, auf das Gut Katholm Gods in der hübschen Natur Norddjurslands in Jütland – eine traditionsverbundene Welt, in der sein Vater A. W. Dinesen residiert, der große Patriarch der Familie. Eine Welt von gestern, in der die alte Ordnung noch besteht, eine Welt weit weg von blutgetränkten Rinnsteinen und Massenhinrichtungen. Eine Welt, die ihm Ruhe geben kann.
Kann sie es wirklich?