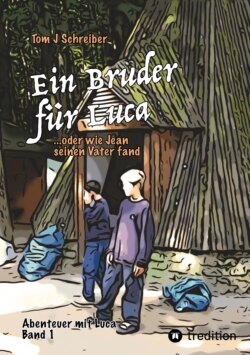Читать книгу Ein Bruder für Luca - Tom J Schreiber - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Ich hatte noch nie einen Toten gesehen, aber so mussten die Augen eines Toten aussehen. Während der ganzen Rede unseres Direktors sah ich ihn vor mir. Ich wagte es nicht, mich noch einmal zu ihm zu drehen, zu skurril und bedrohlich war die Situation. Ich hatte diesen Jungen noch nie auf unserem College bemerkt. Warum träumte ich von ihm und was hatte der Traum zu bedeuten. Was hatte das überhaupt alles zu bedeuten. Als der Direktor endlich offiziell die Ferien eingeläutet hatte, brach ein Tumult los. Alle drängten nach draußen. Der Weg zum Ausgang führte direkt an dem Jungen vorbei. Ich blieb deshalb noch kurz sitzen und wartete, bis ihn die Meute verschlungen hatte. Auf keinen Fall wollte ich ihm näher kommen.
»Kommst du endlich?«
Marcel war schon aufgestanden und wartete ungeduldig. Vorsichtig ließ ich meinen Blick an ihm vorbei wandern. Erleichtert stellte ich fest, dass der Junge weg war. Gemeinsam verließen wir das Collegegebäude. Draußen entdeckte ich ihn wieder. Ein paar Köpfe weiter vorn. Von hinten war nichts ungewöhnliches zu bemerken. Jetzt war ich doch wieder neugierig. Konnte es wirklich sein, dass sein Gesicht so abartig aussah? Ich musste mich getäuscht haben. Mein Verstand musste mir einen Streich gespielt haben. Würde der Junge wirklich so aussehen, würde ihn jeder anstarren und schreiend davon rennen. Aber nichts dergleichen war der Fall. Plötzlich hatte ich es eilig. Ich musste mich vergewissern, dass er ein ganz normaler Junge war. Meine Schritte wurden schneller.
»Beeil dich mal«, sagte ich zu Marcel. Gleichzeitig boxte ich mich durch die Horde Schüler, um den Jungen einzuholen.
»Wo willst du denn plötzlich so schnell hin? Wir kommen schon noch rechtzeitig zu Lea an den Strand«, hörte ich Marcel keuchend rufen.
»Scheiß auf Lea. Beeil dich einfach«, rief ich zurück und achtete nicht darauf, ob er mithalten konnte.
Ich musste den Jungen einholen. Schließlich lichtete sich die Menge. Ich stand auf dem Platz, vor dem gusseisernen Tor, und sah auf die Straße. Der Junge war weg.
»Verdammt«, fluchte ich laut vor mich hin.
»Bro, was ist denn mit dir? Erst hockst du ’rum wie erstarrt und dann rennst du los, als wäre der Wahrhaftige hinter dir her«, keuchte Marcel, der nun ebenfalls am Tor angelangt war.
»Wer bitte schön ist denn der Wahrhaftige?«, fragte ich irritiert.
»Weiß nicht«, zuckte Marcel grinsend die Schultern. »Sagt man halt so.«
»Na dann«, antwortete ich in Gedanken.
»Wem wolltest du denn hinterher«, fragte er nochmal und sah mich dabei gespannt an.
»Ach egal, lass uns nach Hause gehen.« Ich war froh, dass Marcel nicht weiter nachbohrte. Aber auch das war etwas, was ihn auszeichnete.
Unsanft schlug die Wohnungstür hinter mir zu. Wie jeden Mittag wenn ich von der Schule kam, warf ich unserer Haushälterin ein »Hey Manuelle« zu, um danach direkt in meinem Zimmer zu verschwinden. Eine Antwort wartete ich nicht ab. Vielleicht hatte sie es bereits aufgegeben und akzeptiert, dass meine Zimmertür schneller ins Schloss fiel, als sie reagieren konnte. Wahrscheinlich interessierte sie es aber auch nicht. Gleichgültig warf ich meinen Schulrucksack auf den Boden. Mit einem Tritt beförderte ich ihn unter mein Bett. Dort würde er für die nächsten acht Wochen sein Zuhause finden. Mit meinem Handy in der Hand warf ich mich auf die Matratze. Endlich Ferien! Acht Wochen keine Schule und vor allem keine Lehrer. Eigentlich sollte ich mich tierisch freuen, aber ich wusste nicht wirklich worauf. Dieses Jahr war es schlimmer als je zuvor. Genau wie ich meine Lehrer gut acht Wochen nicht sehen würde, würde ich auch meine Freunde mindestens sechs Wochen nicht sehen können. Marcel eingeschlossen. Übermorgen musste ich mit meinem Dad in den alljährlichen "heile Welt - Vater-Sohn-Urlaub“ an die Adria. Meine Chancen hier zu bleiben, hatte ich wohl heute Morgen endgültig verwirkt. Vermutlich würde der Urlaub stattdessen der totale Horror werden. Mein Vater würde zwei Drittel des Urlaubs nur arbeiten, um mir die andere Zeit mit seinem Männerdinggehabe, auf die Nerven zu gehen. Ich verstand ohnehin nicht warum wir an die Adria fuhren, wo wir das Meer schließlich vor der Haustür hatten. Nicht genug entdeckte er genau dann seine Vaterrolle, wenn für mich der Urlaub angenehm zu werden begann und ich mich abends mit irgendwelchen Leuten treffen wollte. Er schleppte mich dann in pompöse Strandrestaurants und nannte es die Höhepunkte des gemeinsamen Urlaubs. Für mich war es einfach nur der Horror. Viel lieber hätte ich tagsüber mit ihm im Wasser getobt, Fußball am Strand gespielt oder irgendwie sonst das Gefühl gehabt, dass er etwas wegen mir machte. Ein Burger in irgendeiner Frittenbude hätte mir dabei völlig gereicht. Für ihn war das alles nichts und so lungerte ich den ganzen Tag gelangweilt im Hotel herum. Neidisch sah ich anderen Familien zu, die gemeinsam Spaß hatten. Wenn ich es mir recht überlegte, war für meinen Vater der einzige Unterschied zwischen Urlaub und Alltag, der Ort an dem wir uns befanden und dass wir essen gingen. Wenn wir in drei Wochen wieder zurück sein würden, fuhr mein bester Freund Marcel in ein Ferienlager nach Spanien. Das waren dann weitere drei Wochen, in denen ich mich langweilte. Mein alter Herr war der Meinung, dass es zu viel des Guten für mich wäre sechs Wochen lang zu verreisen und ich mich lieber die letzten Tage der Ferien auf die Schule vorbereiten sollte. Dass nach dem Camp immer noch zwei Wochen dafür verbleiben würden, ignorierte er völlig. Seit ich zehn war, führte ich jedes Jahr die gleiche Diskussion und immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich blieb zu Hause. Letztes Jahr war der Streit darüber ziemlich eskaliert. Daraufhin brummte er mir acht Wochen Nachhilfeunterricht auf und selbst im gemeinsamen Urlaub verzichtete er nicht darauf. Wie ich es hasste. Es war immer das gleiche Gefühl wenn ich über meinen Vater nachdachte. Er hatte uns nie die Chance gegeben Vater und Sohn zu sein. Den ganzen Tag war ich allein. Er war morgens schon aus dem Haus bevor ich aufstand. Am Abend, wenn er nach Hause kam, setzte er sich ins Wohnzimmer, um meist direkt nach den Nachrichten im Bett zu verschwinden. Manchmal hatte ich das Gefühl als würde er gar nicht wissen, dass ich in meinem Zimmer saß und darauf wartete, er würde mir eine gute Nacht wünschen. Natürlich hatte ich, als ich noch kleiner war, oft bei ihm gesessen um in seiner Nähe zu sein, immer darauf bedacht ihn nicht zu stören wenn er Nachrichten sah, ein Buch las oder eben arbeitete. Er hatte mich nie geschlagen, aber er war regelmäßig sauer geworden, wenn ich ihn angesprochen oder versucht hatte ihm währenddessen einen Kuss zu geben oder zu kuscheln und so hatte ich es irgendwann gelassen. Wenn ich es nüchtern betrachtete glaubte ich nicht, dass er an mir als seinem Sohn interessiert war. Vermutlich hätte in seinem Leben ohne mich nichts gefehlt. Mit Marcels Eltern hingegen war es toll. Mit seinem Dad war ich schon oft beim Angeln gewesen oder am Strand. Wir hatten immer eine Menge Spaß. Er liebte Marcel wirklich und ich hatte das Gefühl, er liebte sogar mich. Zumindest mehr, als mein eigener Vater. Es ist komisch so etwas zu sagen. Ich hoffe auch, keiner der das liest kann mich verstehen. Wie eigentlich fast immer bei solchen Gedanken und wenn ich auf meinen Vater sauer war, überkam mich eine seltsame Schwere. Heute jedoch stärker als je zuvor. Ich kannte meinen Vater nicht und er kannte mich nicht. »Denke nach«, sagte ich mir. Mir musste einfallen, wann er mich einmal in den Arm genommen hatte, mich geküsst hatte um mich zu trösten oder mir zu zeigen, dass er mich liebte. So sehr ich auch nachdachte. Mir fiel nichts ein. Es war nie passiert. An keinem Tag hatte ich mir das so bewusst gemacht, wie in diesem Augenblick. Ich weinte. Tränen liefen mir über die Wangen in die Mundwinkel. Ich schmeckte das Salz. Es war genauso bitter, wie ich mich fühlte. Mich überkam eine eisige Einsamkeit. Eine Einsamkeit, die ich bis heute nie wieder so gespürt habe. Zum Glück! Vergessen werde ich dieses Gefühl nie. Allein und verzweifelt, durchströmte mich zugleich eine seltsame Sehnsucht nach meiner Mutter. Dad sprach nie über sie. Weder über ihren Tod, noch wie sie gewesen war. Manchmal versuchte ich vorsichtig mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wann immer ich das Thema auf meine Mutter lenkte, wurde er ungehalten. Bisweilen stellte ich mir vor, dass ich etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnte und es ihm deshalb nie möglich gewesen war, väterliche Gefühle für mich zu entwickeln. In irgendeiner Weise fühlte ich mich meiner Mutter derart nahe, als könnte ich sie im Raum spüren. Eigentlich hasste ich diese Gedanken. Ich sehnte mich nach meiner Mutter, aber es machte mich nur trauriger an sie zu denken ohne eine echte Erinnerung zu haben. Auf der anderen Seite, hatte ich etwas, das für das Verhalten meines Vaters sprach. So konnte ich es bei ihm aushalten. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, jeden Tag zu essen und auch sonst mangelte es mir an nichts. Sicher gab es viele Jugendliche auf der Welt, die weitaus schlimmer dran waren als ich. Dennoch, ein wichtiger Teil meines Lebens hatte nie statt gefunden. Oft lag ich weinend in meinem Bett oder tyrannisierte, mit einem meiner Wutanfälle, meine Umgebung. Selbst Marcel bekam meine Launen ab und an zu spüren, obwohl ich in seiner Gegenwart froh und ausgeglichen war. Er hatte mit der Zeit gelernt, mich von zu Hause abzulenken. Außerdem war er mein bester Freund und der einzige Mensch von dem ich wusste, dass er es nie böse mit mir meinte. Seltsamerweise waren meine Schulnoten außergewöhnlich gut. Trotzdem ich keinen meiner Lehrer richtig leiden konnte, gaben mir meine Leistungen in der Schule etwas von der Anerkennung zurück, die ich zu Hause vermisste. Meinen Vater beeindrucken zu wollen, hatte ich vor langer Zeit aufgegeben. Ich spürte, wie mir der Schweiß unter dem T-Shirt über den Bauch rann. Aus meinen Gedanken gerissen sprang ich auf. Letztendlich war es noch nicht übermorgen und ich wollte die Zeit mit meinen Freunden nutzen.
»Kommst du essen Jean«, rief es aus der Küche.
»Kein Hunger.«
»Wenigstens eine Kleinigkeit solltest du essen«, ertönte es direkt hinter mir. Manuelle stand in der Tür. Die Uhr zeigte bereits zehn vor eins.
Muffig drehte ich mich zu ihr um. »Was ist an, ich habe keinen Hunger, nicht zu verstehen?«
»Nun komm schon ich habe extra für dich gekocht«, der Ton den sie anschlug bewegte mich fast dazu meine schlechte Laune zu vergessen. Nur fast.
»Sorry, aber die anderen warten schon. Ich werde später was essen«, sagte ich freundlicher. Sie konnte ja nichts für meinen Vater.
»Na gut, ich stelle es in den Kühlschrank. Vielleicht hast du ja am Abend noch Appetit«, sagte sie resigniert und zog von dannen, während ich hastig meine Badeshorts überzog.
Mit einem knappen »au revoir, Manuelle« war ich auch schon zur Tür raus. Um keine Zeit zu verlieren, rannte ich, jeweils mehrere Stufen überspringend, die Treppe hinunter. Die letzte Stufe erwischte ich nicht richtig und kam ins straucheln. In letzter Sekunde bekam ich die Klinke der Haustür zu fassen um nicht zu stürzen. Allerdings war ich so in Fahrt, dass ich mit einem lauten Schlag, der im ganzen Treppenhaus widerhallte, dagegen krachte. Ich rieb meine Schulter, die etwas schmerzte und hob vorsichtig den Arm, um zu sehen ob etwas schlimmeres passiert war. Es schien alles in Ordnung. Hastig stürzte ich nach draußen. Manuelle war zuzutrauen, dass sie nachsehen würde was passiert war. Das letzte was ich jetzt brauchen konnte, war ihre Fürsorge.
Die Sonne tauchte die Straße in ein gleißendes Licht und brannte heiß auf den Asphalt, so dass sich die Luft verschwommen darauf spiegelte. Der Himmel hatte ein perfektes blau, wie man es sich nicht ausdenken konnte. Keinem Maler der Welt würde es gelingen ein solches Blau zu mischen. Ich musste blinzeln, da ich versehentlich direkt in die Sonne gesehen hatte. Der Weg zum Strand war die perfekte Gelegenheit für eine Laufeinheit. Gerade wollte ich dazu ansetzen, als ich auf jemanden aufmerksam wurde. Ein Mann. Etwa vierzig Jahre alt und ziemlich nobel gekleidet. Kein Anzug oder Krawatte, aber modisch. Für das warme Wetter auf jeden Fall unpassend. Er war gerade aus einem Taxi gestiegen und blickte zu mir herüber.
»He Junge, kannst du mir kurz helfen«, rief er mir fragend zu. Er sprach ein fast akzentfreies Französisch, konnte allerdings nicht ganz verbergen, dass er Ausländer war.
»Wenn es schnell geht«, sagte ich kurz angebunden. »Was kann ich denn für Sie tun?«, setzte ich etwas höflicher hinzu, mich meiner guten Kinderstube erinnernd.
Zumindest das hatte mein Vater ja hinbekommen, Nebenbei war ich auch neugierig was er wollte. Ich weiß nicht wie ich damals darauf kam, aber der Mann strahlte auf mich eine gewisse Vertrautheit aus.
»Oh entschuldige bitte. Ich möchte dich keinesfalls aufhalten. Dachte nur du wüsstest eventuell, ob hier Familie Bellier wohnt.«
»Was ist denn das für ’ne Frage? Das Taxi hat Sie doch hergebracht, oder?«, sagte ich schroff.
»Da hast du recht. Entschuldige bitte«, antwortete der Mann, während seine Mundwinkel nervös lächelnd zuckten.
»Wenn nun also weiter nichts ist, würde ich gerne los. Ich hab’s nämlich wirklich eilig und Sie müssen sich auch nicht andauernd bei mir entschuldigen.« Ich grinste ihn an.
Zu unhöflich wollte ich dann doch nicht wirken. Schließlich sollte er ja nur gutes von uns Franzosen zu Hause erzählen. Er sah irgendwie erleichtert aus und grinste zurück, während ich mich in Bewegung setzte.
»Wie heißt du eigentlich?«, rief er hinter mir her.
»Will er mich jetzt anmachen?«, dachte ich kurz und drehte mich nochmals um.
Da er die Hand gehoben hatte, winkte auch ich ihm zum Abschied, gab ihm aber keine Antwort. Hatte er Tränen in den Augen? Seltsam! Mein Vater hatte nichts von einem Besuch erwähnt und das auch noch zwei Tage vor unserer Urlaubsreise. Das passte gar nicht zu ihm. Fast hätte ich umgedreht um den Grund seines Kommens zu erfahren, lief dann aber doch weiter. Als ich am Ende der Straße um die Ecke bog sah ich nochmal zurück. Der Mann stand immer noch an der gleichen Stelle und schaute mir nach - unheimlich. Komischer Kauz. Ich zog das Tempo an, schließlich hatte ich bereits genug Zeit verloren.
Ich konzentriere mich auf den Asphalt unter meinen Füßen. So kann ich meine Geschwindigkeit am Besten wahrnehmen. Schnell verlieren sich meine Gedanken im Nichts. Ungewöhnlich schnell, fühle ich mich ganz frei. Kurz sehe ich die Spitze meiner Sneaker, dann wieder Asphalt. Ich konzentriere mich auf meine Fußsohlen, so spüre ich Meter für Meter, der sich unter ihnen wegbewegt. Alles um mich verschwimmt in mir und meinem Körper. Obwohl der Weg ganz eben ist, kann ich kaum atmen. Tief aus meinen Lungen ziehe ich die letzten Sauerstoffreserven. Ich beginne zu röcheln. Mein Atem wird hektisch. Ich werde schwächer. Alles wird schwarz. Plötzlich ein Ruck. Neue Luft strömt durch meinen Körper. Wind bläst durch meine Haare. Ich spüre ihn, bis in die Haarwurzeln. Überall kann ich ihn wahrnehmen. Es ist ein schönes Gefühl. Licht blendet mich. Meine Luftröhre ist wieder frei. Dennoch fühle ich mich schwach. Wie lange habe ich nicht geatmet? Um ein Haar zu lange. Die Frau - meine Mutter - sieht mich an. Sie weint - genau wie ich. Der Asphalt unter meinen Sneakern verschwindet - Sand. Ich bin am Strand angekommen, werde langsamer. Ich atme schwer und tief ein - brauche Sauerstoff. Ich bin schneller gelaufen als ich dachte.
»Bro, wo bleibst du denn so lang?«, rief mir Marcel bereits von weitem entgegen.
Natürlich waren auch Lea und Dennis, ein anderer Junge aus unser Klasse, schon da. Ich ließ mich völlig erschöpft und schweißgebadet in den Sand fallen.
»Scheiße, ist das warm heute«, sagte ich nach Luft schnappend. Mit einem gezielten Wurf, landeten meine Schuhe direkt neben Marcels Kopf. Gleichzeitig zog ich mein T-Shirt aus. »Sorry, dass ich so spät dran bin, aber mir ist gerade was echt komisches passiert.«
Marcel sprang auf. »Ich lache gleich drüber, aber erst mal gehen wir uns abkühlen. Der letzte ist ein Muttersöhnchen«, rief er uns zu und rannte los.
Hastig entledigte ich mich meiner Shorts und rannte was das Zeug hielt, den anderen hinterher. Ich war kein schlechter Läufer, deshalb schaffte ich es zumindest Dennis zu überholen. Marcel war noch nicht wieder aufgetaucht, als ich neben ihm in die Wellen hüpfte. Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, ihn unter Wasser zu tauchen. Er hatte nicht damit gerechnet. Wild zappelnd und nach Luft schnappend, ließ ich ihn schließlich los.
»Du bist tot, Bro!«, sagte er vergnügt, als er sich wieder einigermaßen erholt hatte und sich sofort auf mich stürzte.
Es gelang mir, unter ihm weg zu schwimmen. So begann eine wilde Jagd durchs Wasser. Irgendwann lagen wir beide abgekämpft in den seichten Wellen und beobachteten ein wenig das Treiben des Meeres. In Momenten wie diesen liebte ich das Leben. Was konnte es besseres geben, als mit seinen Freunden, bei dreißig Grad, am Strand rumzuhängen. Ich beobachtete das gleißende Sonnenlicht, das sich im Wasser brach und die unterschiedlichsten Schatten auf meiner Brust formte. Ich schloss die Augen und sog die Luft ein. Ich hörte dem Rauschen der Wellen zu und genoss das regelmäßige auf und ab der Brandung, die mich stimulierte. Ich roch das Salz des Wassers, das sich mit dem Duft der Bäume und dem Geruch des Sandes vermischte. Das schäumende Wasser erfrischte und beruhigte mich zugleich.
IN GEDANKEN VERSUNKEN BLICKTE SIE, ENTLANG DER STEINBÖSCHUNG, AUF DIE KLEINE BRÜCKE HINÜBER. DAHINTER LAG EINE WINZIGE BUCHT MIT EINEM KLEINEN SANDSTRAND. SIE SASS HIER OFT. DIE BRANDUNG ZU BEOBACHTEN ENTSPANNTE UND BERUHIGTE SIE. AUCH WENN AN MANCHEN TAGEN DIE GISCHT SO STARK WAR, DASS SIE BIS HINAUF AUF DIE TERRASSE DES CAFÉS SPRITZTE. SIE FÜHLTE SICH DANN BEINAHE WIE AUF DIESER GEFÄNGNISINSEL IM PAZIFIK, IN DER BUCHT VOR SAN FRANCISCO. SIE WAR NOCH NIE DORT GEWESEN, ABER SO MUSSTE ES DA SEIN. SEIT DREIZEHN JAHREN WAR SIE GEFANGEN. GEPEINIGTE IHRER ERINNERUNGEN. ERINNERUNGEN AN IHREN SOHN. WARUM HATTE ER STERBEN MÜSSEN. NIEMALS HÄTTE SIE IHM DIESES SPIELZEUG AUF DIE KRABBELDECKE LEGEN DÜRFEN. ER WAR DOCH NOCH VIEL ZU KLEIN DAFÜR. SIE HÄTTE ES VERHINDERN KÖNNEN. DIE TÜR IHRES GEFÄNGNISSES WAR HINTER IHR ZUGEFALLEN, ALS DIE ÄRZTE IHR GESAGT HATTEN, DASS SIE NICHTS MEHR HATTEN TUN KÖNNEN. GEFANGEN MIT IHRER SCHULD. SIE HATTE ES NICHT GESCHAFFT, IHREN SOHN NOCH EINMAL ANZUSEHEN. »WARUM HAST DU MICH ALLEIN GELASSEN«, HÄTTE ER GEFRAGT. SIE WAR EINFACH WEGGEGANGEN. KEINE ZEICHEN. WAS HÄTTE SIE IHREM MANN SAGEN SOLLEN? SIE KONNTE IHM NICHT MEHR UNTER DIE AUGEN TRETEN. WEIT WEG WOLLTE SIE SEIN, WO SIE NICHTS DARAN ERINNERN WÜRDE. EIN TOLLER JUNGE HÄTTE ER WERDEN KÖNNEN. EINE GUTE ZUKUNFT HÄTTE ER GEHABT. SIE HATTE IHM DAS ALLES GENOMMEN. SIE WÜRDE ES NICHT VERGESSEN. NIEMALS. IN DER ERSTEN ZEIT HATTE SIE AN SELBSTMORD GEDACHT, SICH SCHLIESSLICH FÜR DIE GRÖSSERE STRAFE ENTSCHIEDEN. SIE LEBTE MIT IHREM VERGEHEN. ES AUSZUHALTEN WAR DIE BÜRDE, DIE SIE TRAGEN MUSSTE. SIE KONNTE ES DAMIT NICHT GUT MACHEN, ABER SIE EMPFAND ES ALS EINZIGE MÖGLICHKEIT DER BUSSE. DARUM WAR SIE HIER GEBLIEBEN. SEIT EINIGER ZEIT HATTE SIE DAS GEFÜHL, DASS DARAN ETWAS NICHT STIMMTE. ETWAS HATTE SICH VERÄNDERT. SIE WUSSTE NICHT WAS. IHR BLICK WAR NOCH IMMER AN DER STELLE HÄNGEN GEBLIEBEN, HINTER DER DIE KLEINE BUCHT BEGANN. SIE WAR NOCH NIE DORT GEWESEN. DENNOCH ZOG ES SIE MAGISCH AN. MANCHMAL WENN SIE HINÜBER SAH, LIEF IHR EIN LEICHTER SCHAUER ÜBER DEN RÜCKEN – SO WIE JETZT.
Kälte kroch mir in den Körper. Langsam breitete sie sich aus. Erst über die Zehen, dann meine Füße kroch sie die Beine hinauf. Es schüttelte mich. Noch immer lag ich neben Marcel in den Wellen und noch immer brannte die Sonne heiß auf uns herunter.
»Bro, was war das denn«, fragte mich Marcel. Er sah mich irritiert an.
»Keine Ahnung«, zuckte ich wahrheitsgemäß mit den Schultern. »Hat mich irgendwie gefröstelt.«
»Wolltest mir doch erzählen, was dir komisches passiert ist«, erinnerte er sich.
Ich schlug die Augen auf und drehte mich zu ihm. »Stimmt, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich wollte vorher gerade weg, als so einen Typ bei uns am Haus, aus einem Taxi stieg. Hat mich gefragt, ob da die Belliers wohnen.«
»Und?«, Marcel sah mich gespannt an und wartete auf die Pointe. »Ist doch nix ungewöhnliches.«
Ich blickte ihn wissend an. »Überleg doch mal. Das Taxi hält direkt vor unserer Haustür. Wer wird dem Fahrer wohl gesagt haben, wo er hinfahren soll?« Manchmal war Marcel etwas langsamer mit den Gedanken und es dauerte einen Moment bis er schließlich zu nicken begann.
»Stimmt schon. Vielleicht wollte er sich vergewissern, weil er sich der Adresse nicht sicher war«, sagte er nachdenklich.
»Ja und da spricht er besser einen wildfremden Jungen an, als einfach auf die Klingel zu schauen«, sagte ich verächtlich.
»Du kamst halt gerade aus der Haustür«, stellte Marcel nüchtern fest ohne auf meinen Unterton einzugehen.
»Keine Ahnung«, zuckte ich mit den Schultern. »Jedenfalls hatte er einen komischen Akzent. Sprach ziemlich gut französisch, aber er war Ausländer. Hat sich ziemlich nach ’nem Deutschen angehört«
»Deutscher?«, sagte Marcel mit einem überraschten und zugleich, nun seinerseits, verächtlichen Unterton. »Was will der denn von euch?«
»Ich sag ja, keine Ahnung. Gekannt hab ich ihn jedenfalls nicht. Er hat mich noch gefragt, wie ich heißen würde und mir ewig hinterher geschaut.«
»Vielleicht fand er dich ja ganz hübsch. Aber er hat mich noch nicht gesehen«, grinste Marcel und streifte sich eitel mit der Hand durch das Haar.
»Blödmann«, lachte ich. »Nein aber mal im Ernst, wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, würde es mich schon interessieren. Du kennst meinen Vater! Zwei Tage bevor wir in den Urlaub fahren, würde er doch keinen Besuch einladen. Genau genommen hatten wir noch nie Besuch. Noch dazu aus Deutschland!«
»Na ja, vielleicht irgendein Geschäftspartner von deinem Dad oder so«, mutmaßte Marcel und sah mich dabei unsicher an.
»Das glaub ich nicht. Soviel ich weiß arbeitet seine Firma, weder mit deutschen Geschäftspartnern, noch hat er jemals geschäftlich jemanden nach Hause eingeladen.«
»Komm schon, verdirb dir nicht den Tag um über so was nachzudenken«, sagte Marcel, während er sich wieder zurück ins Wasser sinken ließ. Er schloss die Augen.
»Hast ja recht«, antwortete ich und ließ mich ebenfalls zurücksinken.
Allerdings genoss ich diesmal nicht das tolle Gefühl des frischen Meerwassers auf meinem Bauch, sondern war in Gedanken ganz woanders. Seit ich denken konnte, hatten wir nie Besuch bekommen. Es hört sich verrückt an, aber es ist wahr. Nie hatte er irgendwelche Freunde oder Bekannte, zum Kaffee oder gar zum Fußballabend, eingeladen. Selten, dass er selbst einmal eingeladen war oder ausging.
»Und ich sage dir, da ist was faul. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, sagte ich nach einer Weile, hartnäckig beim Thema bleibend.
»Bro, kannst du auch mal wieder von was anderem reden? Wir möchten heute noch ein bisschen Spaß haben«, erwiderte Marcel leicht ärgerlich.
»Super toll«, schrie ich ihn an, während ich aufsprang. »Scheiß egal, was mich bedrückt oder? Hauptsache du hast deinen Spaß!«
»So war das ja nicht gemeint, sei doch nicht gleich sauer, Jean«, sagte Marcel sichtlich erschrocken von meiner Reaktion.
Ich beruhigte mich nicht. »Ich glaube schon, dass du meinst was du sagst«, entgegnete ich, während ich wütend zu den anderen zurückging, mein Handtuch packte und mit einem kurzen »Salut« auch schon unterwegs zurück zur Straße war.
»Jean, jetzt warte doch mal«, hörte ich Marcel hinter mir herrufen.
Ich tat so, als würde ich ihn nicht hören und lief trotzig weiter. Kurze Zeit später spürte ich, wie er mich an der Schulter packte. Ein Schmerz durchzuckte mich, der mich an den Aufprall gegen die Tür erinnerte.
»Jetzt krieg dich halt wieder ein. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es war wirklich nicht so gemeint. Entschuldige bitte!«
»Ach ja? Du solltest in Zukunft vielleicht das sagen was du meinst, dann ist es leichter zu verstehen«, blaffte ich zurück.
Ich riss mich aus seiner Umklammerung um weiterzulaufen. Ich rechnete damit, dass er noch einen Versuch starten würde und diesmal würde ich nachgeben. So schlimm war es nun wirklich nicht gewesen. Erneut packte mich Marcel bei der Schulter, diesmal jedoch so hart, dass mir fast Tränen in die Augen schossen. Er riss mich herum.
»Du wirst hier bleiben. Wir werden einen schönen Nachmittag verbringen und ich werde mich nicht weiter bei dir entschuldigen, weil ich nichts Schlimmes getan habe. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr, mir jedes Mal ein schlechtes Gewissen zu machen, nur weil du leicht erregbar bis. Ich bin dein Freund, lern das endlich!«
Ich starrte ihn an. Das war nun nicht die Art von Entschuldigung die ich erwartet hatte. Aber noch während er redete wusste ich, dass er Recht hatte und vermutlich war nun sogar ich an der Reihe mich zu entschuldigen. Marcel hatte es nicht leicht mit mir.
»Blöder Scheißkerl«, sagte ich zu ihm. Unweigerlich musste ich grinsen. »Dass du auch immer alles so auf den Punkt bringen musst.«
Marcel grinste zurück. »Na also«, sagte er nur und legte seinen Arm um meine Schulter. »Lass uns zu den anderen gehen.«
»O.k.«, sagte ich während wir uns in Bewegung setzten. »Aber könntest du ihnen vielleicht erzählen, dass du mich auf Knien gebeten hast, hier zu bleiben?«
»Vergiss es, Bro«, lachte Marcel. »Ich werde ihnen erzählen, dass ich dir die Meinung gesagt habe und du eingesehen hast, dass du im Unrecht warst.«
»Wirst du nicht«, erwiderte ich und hob drohend den Zeigefinger.
»Wer will mich denn daran hindern«, hob Marcel die Augenbrauen.
»Wirst du schon sehen.«
Ehe sich Marcel versah, hatte ich ihn zu Boden geworfen und saß auf ihm. Blitzschnell drückte ich seine Arme nach hinten. Ich kniete mich auf seinen Bizeps, so dass er keine Chance hatte mich abzuschütteln.
»Sag, lieber Jean ich bitte dich vielmals um Entschuldigung.«
Marcel gab Geräusche von sich, die irgendwo zwischen jammern und kichern lagen.
»Dir wird das Lachen schon vergehen«, sagte ich und drückte meine Knie fester auf seine Oberarme.
»Du tust mir weh«, kam es wieder halb kichernd, halb schluchzend zurück.
»Was kann ich denn dafür wenn du nervst … «, der Rest des Satzes ging in einem Aufschrei unter.
Ich hatte mit meinem Knie empfindlich in seine Muskeln gedrückt. Natürlich war es Spaß, trotzdem musste es weh tun.
»Sag, entschuldige bitte, zu mir«, forderte ich ihn wieder auf.
»Entschuldige bitte zu mir«, sagte Marcel grinsend und ich ließ mich lachend zur Seite rollen.
Ich war froh, dass er mich nicht hatte gehen lassen. Nicht auszudenken, wenn ich jetzt auch noch Streit mit meinem besten Freund bekommen hätte. Als wir zu unserem Platz zurückkamen, waren die anderen verschwunden, vermutlich ins Wasser.
»Mann ist das ein Tag«, schwärmte Marcel während er sich auf seine Decke fallen ließ.
»Stimmt, endlich keine Schule mehr«, bestätigte ich ihm.
»Danke übrigens nochmals für deine Unterstützung in Mathe«, meinte Marcel und ich hatte das Gefühl, dass er mich bewundernd ansah. »Ohne dich hätte ich es nicht geschafft dieses Jahr«, fügte er noch hinzu.
»Ach was«, winkte ich ab. »Das hab ich doch nicht für dich getan. Erstens hatte ich immer einen Grund bei dir vorbeizuschauen und zweitens will ich gar nicht daran denken, dich nicht mehr in der gleichen Stufe zu haben.«
Marcel schmunzelte. »Schon klar. Trotzdem, du warst mir echt ne große Hilfe. Was wollen wir denn heut noch machen?«
Ich antwortete nicht gleich. »Wie wär’s wenn wir später zurückkommen und uns einfach bis in die Nacht hier hinflaggen. Wir bringen etwas Verpflegung mit und chillen ’ne Runde.«
»Cool«, meinte Marcel etwas überrascht. »Das kommt ohnehin viel zu kurz, die nächsten Wochen. Wär mir aber nicht so sicher, dass dein Dad da mitspielt?«
»Ich denke mal, ich werde ihn nicht fragen«, feixte ich.
»Hast den Rebellen in dir geweckt, oder wie?«, grinste Marcel. »O.k. also abgemacht. Dann treffen wir uns um neun wieder hier und wenn du einknickst überleg ich mir was für dich«, sagte er mit einem gespielt bedrohlichen Gesichtsausdruck.
»Yes Sir, Bro Sir«, sagte ich lachend.