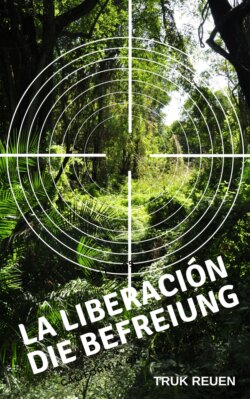Читать книгу La Liberación - Truk Reuen - Страница 3
28. August 1978 - Grenzfluss San Juan, Nicaraguanische Seite
ОглавлениеSie starrte in die Mündung der Waffe. Das Geschrei der gepeinigten Menschen und das ohrenbetäubende Geräusch von Schüssen aus automatischen Sturmgewehren und Handgranaten hallten noch in ihrem Kopf nach. Den Gestank verbrannter Zelte, Hütten und Menschen hatte sie noch in der Nase, und nun blickte sie selbst in die Mündung einer Waffe.
Sie wusste nicht einmal, wer die Waffe auf sie richtete. Der Mann mit dem Finger am Abzug trug eine schlecht sitzende Uniform, die sie nicht kannte. Er hatte einen dunkelbraunen Teint und volles schwarzes Haar. Die buschigen Augenbrauen vereinigten sich über der Nasenwurzel. Sie wusste nur, dass sie diesen Mann aus tiefster Seele hasste für all die grausamen Dinge die er und seine Mittäter den Menschen in dem medizinischen Notlager, welches die Hilfsorganisation „Doctores de Corazón“ betrieb, angetan hatten. All dieses Leid, die Morde und Verstümmelungen.
Dies waren Menschen, die nichts zu tun hatten mit den Wirren des Bürgerkrieges. Sie waren von den Kriegsschauplätzen geflohen. Vor den Übergriffen der Regierungstruppen. Vor den Gräueltaten der Guerillas. Vor dem Hunger. Die meisten wussten nicht einmal, wer gegen wen kämpfte und warum.
Ein maßloser Zorn bemächtigte sich ihrer. Sie lag in ihrem ehemals weisen Arztkittel im Matsch des Ufers und hatte noch nicht realisiert, dass dies womöglich auch das Ende ihres jungen Lebens bedeutete.
Vor vier Wochen waren sie und ihr Team in Costa Rica angekommen und hatten sich nach endlosem Papierkrieg und Kampf gegen zähes Behördentum auf den Weg zum Grenzfluss San Juan gemacht. Im Gepäck die komplette Ausstattung eines Feldlazaretts das ihnen die US Armee als Spende überlassen hatte. Sie wollten nichts weiter als den Flüchtlingen ärztliche Hilfe zuteilwerden lassen. Helfen! Das unsagbare Leid wenigstens etwas lindern.
Zuerst hatten sie das Lazarett am Costa-ricanischen Ufer des San Juan aufgeschlagen. Damit befolgten sie den dringenden Ratschlag nicht nur der Deutschen Botschaft in San José, sondern auch den der Costa-ricanischen Sicherheitsbehörden. Costa Rica hatte als sehr pazifistisches Land seit den 40er Jahren das Militär abgeschafft und das ersparte Geld in die Bildung investiert. Deshalb gab es auch fast keinen Analphabetismus mehr. Man war sehr nervös bezüglich der Vorgänge im Nachbarland und ganz und gar nicht begeistert, ein Ärzteteam so nah an den Brennpunkten zu wissen.
Die Polizei hatte den Schutz der Grenze übernommen und wollte nicht auch noch die Bürde der Verantwortung für fünf Idealisten tragen, die sich um die Opfer der Wirren kümmern wollten. Dies umso mehr, da es die meisten dieser Flüchtlinge gar nicht erst über den Fluss in die Freiheit schafften. Der Fluss, der von Nicaragua komplett als Hoheitsgebiet angesehen wurde, war streng bewacht. Es patrouillierten Boote mit Bewaffneten und am Ufer waren immer wieder Befestigungen mit Maschinengewehren zu sehen. Auf jeden der ohne Erlaubnis den Fluss überquerte, wurde ohne Vorwarnung geschossen. Die bis zu fünf Meter großen Krokodile im Hauptarm taten ein Übriges.
Dies führte dazu, dass das Lager auf costa-ricanischer Seite so gut wie keine Flüchtlinge aufnehmen konnte. Ihre Patienten waren auf der nicaraguanischen Seite. Dort litten sie und dort starben sie.
Nach zehn frustrierenden Tagen hatten sie sich entschlossen das Lager auf die andere Seite zu verlegen. Aller Protest der Sicherheitskräfte nutzte nichts. Sie wandten sich an die nicaraguanischen Grenzposten und die ließen sie nach einer oberflächlichen Prüfung der Papiere auf die andere Seite wechseln.
Es gab keine große Fähre und nahe am Delta des Flusses schon gar keine Brücke. So konnten sie nur die Zelte und die Kisten mit der Ausrüstung mitnehmen. Die beiden geländegängigen Toyotas blieben zurück.
Sehr schnell gewannen sie das Vertrauen der Flüchtlinge und das Lager wuchs. Endlich konnten sie etwas tun. Die meisten der Menschen litten unter Mangelerscheinungen. Unterernährung, Dehydration, Magen-Darmerkrankungen durch kontaminiertes Wasser, Erschöpfung, Depressionen. Aber es gab auch Verletzungen, die dem Krieg geschuldet waren.
Sie waren zu fünft. Ein erfahrener Arzt aus Costa Rica, zwei Krankenschwestern, eine aus Deutschland und eine aus Spanien, und sie selbst, die gerade ihr Medizinstudium beendet hatte. Sie war eine hübsche schlanke junge Frau, die ihre langen braunen Haare zu einem Zopf zusammenband. Voller Elan und Idealismus war sie der Hilfsorganisation beigetreten und hoffte der Welt etwas zurückzugeben. Außer den Anderen war noch einer der beiden Fahrer bei ihnen geblieben. Sie wusste nicht was aus ihren Kollegen und Kolleginnen geworden war. Sie erinnerte sich, dass sie sah, wie der Fahrer von einer Salve aus einer Maschinenpistole niedergestreckt wurde. Mein Gott, es kam ihr alles so unrealistisch vor. Wie in einem schlechten Film.
„Arriba!“, schnauzte sie der Mörder an und bedeutete ihr mit einer Bewegung der Waffe aufzustehen. Sie hielt es im Moment nicht für ratsam zuzugeben, dass sie ihn verstand und sah ihn verängstigt und fragend an.
„Get up now!“, schrie er in schlechtem Englisch. Mühsam und mit schwindelndem Kopf drehte sie sich auf die Knie und stand dann an einen Baum gestützt auf. Er stieß sie vor sich her zur Mitte des Lagers und beinahe wäre sie wieder gestürzt. Von weitem sah sie zwei Frauen in verschmutzten weißen Kitteln. Die Krankenschwestern. Gott sei Dank, sie lebten. Anna saß weinend in der Mitte des Platzes der von ihren verbrannten Zelten umgeben war. Sie war ca. 40 Jahre alt, etwas mollig und hatte fast schwarze kurzgehaltene Haare. Dem Teint nach zu urteilen würde sie ohne weiteres als Latina durchgehen. Ute, die Deutsche aus Göttingen, starrte teilnahmslos vor sich hin. Ute war der Inbegriff des Klischees einer deutschen Frau. Sehr groß, schlank und mit hellblonden Haaren. Ihre 35 Jahre sah man ihr nicht an.
„Was ist mit Doktor Robles?“, fragte sie die Beiden. Anna zuckte mit den Schultern.
„Er war in dem Zelt in das sie die Handgranate geworfen haben“. Schon bei dem Gedanken an den alten Mediziner wurde Ihr übel.
„No talk!“, brüllte ihr Wächter, und so versanken sie in brütendes Schweigen.
Ute war weiß wie eine Wand und hielt ihre Augen geschlossen. Ihr Atem ging viel zu schnell und die Ärztin machte sich Sorgen. Offensichtlich litt sie unter einem Schock. Die Ärztin entschied sich etwas zu tun. Sie stand auf und legte Ute die Hand auf die Stirn. Der Soldat stieß sie unsanft zur Seite und richtete erneut die Waffe auf sie.
„Meine Kollegin braucht Hilfe“, sagte die Ärztin. „Sie steht unter Schock“. „Un choque“, fügte sie hinzu.
Der Soldat schüttelte nur den Kopf. Die Ärztin ignorierte den Mann und begann die Kollegin in eine Schocklage zu bringen. Der Soldat stieß sie erneut mit dem Gewehr an. Hasserfüllt sah sie ihn an. Langsam krümmte sich der Zeigefinger um den Abzug. „Es ist vorbei“, dachte sie.
„Basta ya, cabrón!“, hörte sie eine Stimme hinter sich. Ein weiterer Soldat mischte sich ein und redete in schnellem dialektverbrämten Spanisch auf den anderen ein. Sie verstand einzelne Wortfetzen. Anscheinend erklärte ihm der Mann, dass eine unter Schock stehende Geisel sie beim Marsch nur aufhalten würde und dass sie nur gesund etwas wert waren. Ihr Peiniger warf ihr einen zornigen Blick zu und knurrte „Si, Teniente“. Er drehte sich um, spuckte aus, und ging davon. Der Offizier kam zu ihr und ging vor Ute in die Hocke. Der Mann war außergewöhnlich gutaussehend. Die dunkle Haut seines perfekt rasierten Gesichtes spannte sich über hochstehende Wangenknochen. Die etwas schräg stehenden Augen unter den gepflegten Brauen wiesen auf indianische Vorfahren hin. Sein schwarzes Haar war trotz der etwa 40 Jahre voll und militärisch kurz geschnitten. Er drehte ihr das Gesicht zu. „Kümmern sie sich um ihre Kollegin und hüten sie sich vor dem Sargente. Sie haben sich einen Feind gemacht.“ Sie konnte nicht anders als sarkastisch aufzulachen.
„Warum lachen Sie, Señora?“
„Sie sagen ich habe mir einen Feind gemacht? Ich bin umgeben von Feinden und von feigen Massenmördern.“