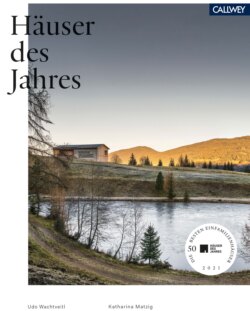Читать книгу Häuser des Jahres 2021 - Katharina Matzig, Wolfgang Bachmann, Udo Wachtveitl - Страница 9
ОглавлениеEinleitung
von Udo Wachtveitl
Wissen Sie noch, welches das Auto des Jahres 1971 war? Es war der Citroën GS, ein Mittelklassewagen mit Luftkühlung, den man heute so gut wie gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Die Zeit ist über ihn hinweggegangen. Freilich, Häuser haben andere Lebenszyklen, aber nach den Vorgaben des deutschen Fiskus – und wer wollte dessen direkten Draht zur Lebenswirklichkeit bestreiten? – ist ein Haus nach 50 Jahren abgeschrieben. In weiteren 50 Jahren werden auch so manche der Häuser in diesem Buch aus der Zeit gefallen sein. Welche das sind, darüber kann man heute nur spekulieren.
Sie halten ein Buch in Händen, in dem es fast ausschließlich um Einfamilienhäuser geht. Es ist auch ein Buch, dessen Erscheinungsjahr im Titel steht, der aktuelle Zeitbezug ist also Programm. Und so wäre es ein sträfliches Versäumnis, die gegenwärtige Diskussion um das Einfamilienhaus nicht aufzugreifen – und sei es für zukünftige Leser in fünfzig Jahren. Als städtebaulicher Wahnsinn wird es geschmäht, als ökologieblinde Prasserei, gern auch als Manifestation einer anachronistischen bürgerlichen Lebenswelt mit Fortschreibungstendenz.
Vielleicht wird man deshalb dereinst überhaupt die Idee des Einfamilienhauses als obsolet betrachten, so wie heute das Ende des Verbrennungsmotors eingeläutet zu sein scheint.
Die Gegnerschaft zum Einfamilienhaus lässt sich nicht so einfach als eine Frage der Mode, wie zum Beispiel Flachdächer oder Waschbetonfassaden, und auch nicht als eine rein ideologische abtun, auch wenn die Rhetorik manchmal nach Klassenkampfklingt und nach Sauertopf riecht. Dabei ist die Beobachtung ja zutreffend, dass sich in vielen Regionen nur noch Erben oder Spitzenverdiener ein Haus mit Garten leisten können.
Interessant ist in dem Zusammenhang, dass ausgerechnet das mit einer egalitären Gerechtigkeitsauffassung schlecht vereinbare, weil dynastischen Verhältnissen Vorschub leistende Erbrecht da und dort noch für gesellschaftliche Durchmischung sorgt, wo die Mechanismen des freien Immobilienmarkts dieser entgegenstehen. In den heute so bevorzugten Lagen am Stadtrand finden sich ab und an nur deshalb noch ein paar Normalverdiener, weil sie das Häuschen von der Oma geerbt haben, die noch selber Gemüse anbaute und Kaninchen züchtete.
Die Gegner des Einfamilienhauses haben einige unabweisbare Argumente auf ihrer Seite: Wo eine Familie wohnt, können gestapelt auch fünf wohnen, das Verhältnis von Außenfläche zu umbautem Raum ist notwendig schlechter als bei Mehrfamilienhäusern, die Ausbreitung im Raum zieht Mobilitätsbedarf nach sich, der wiederum Straßen und andere Infrastruktur nötig macht. Und nicht zuletzt stellt die Bodenversiegelung ein ernstes Problem dar: Jeden Tag verschwinden in Deutschland 60 Hektar Landschaft, beklagt der Bund Naturschutz und rechnet das um auf etwa ein Einfamilienhaus pro Minute. Bevor sie Ihren Taschenrechner bemühen: Das entspricht knapp 417 Quadratmetern pro EFH. Üppig, wenn man nur die versiegelte Grundfläche mit Haus, Garage, Wegen, Sandkiste, Geräteschuppen usw. rechnet, als Grundstück fürs gesamte Anwesen mit Garten eher klein. Da aber der größte Teil der Gartengestaltung wenig naturnah ist, kann man die Berechnung des BUND als polemisch-griffigen Weckruf schon gelten lassen, auch wenn es natürlich andere Bautätigkeiten gibt, die den Boden versiegeln.
Von Flugscham und Diesel-Scham hat man schon gehört. Von Steakliebhabern, die unversehens in eine vegetarisch dominierte Abendgesellschaft geraten sind, kennt man die unerfragten, meist gestammelten Bekenntnisse, dass man eigentlich nur noch ganz selten Fleisch isst, und wenn, dann nur vom Bio-Metzger, den man persönlich kennt. Wird es bald auch eine Einfamilienhaus-Scham geben?
Nach wie vor ist die bevorzugte Wohnform der Deutschen – die Österreicher und Schweizer werden da keine Ausnahme machen – ein freistehendes Einfamilienhaus mit 90 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche und fünf Zimmern, mit dem ÖPNV oder Pkw in weniger als 20 Minuten von einem städtischen Zentrum erreichbar. Am liebsten würden die Befragten in ihrer eigenen Immobilie wohnen und die Kosten sollten das Familienbudget mit nicht mehr als 20 Prozent belasten.
Das wird nicht gehen. Jedenfalls nicht für alle, die sich das wünschen. So bringt der Traum, von vielen geträumt, seine eigene Unmöglichkeit hervor. Und zwar unabhängig davon, dass der Traum aufgrund der Logik von Angebot und Nachfrage für viele unerschwinglich bleiben wird. In Hongkong wurde neulich ein Parkplatz für eine Million Euro verkauft. Selbst wenn alle Kaufwilligen in Geld schwömmen, ließen sich die benötigten Flächen nicht einfach herstellen wie Laptops oder T-Shirts. Diesen Träumen stehen harte, gleichsam logische Wahrheiten entgegen.
Wird es bald auch eine Einfamilienhaus-Scham geben?
Und die sie sich doch erfüllen wollen und können, müssen die nicht wenigstens ein schlechtes Gewissen haben? Und was soll so ein Gedanke in der Einleitung zu einem Buch, das eben diesen Traum so reich und Mund wässernd bebildert?
Die Sozialpsychologie hat einen Begriff geprägt, unter dem solche Problemlagen subsumiert werden. Wenn wie hier Wunsch und Realität nicht oder nur mit unangenehmen Kollateralgefühlen in Übereinstimmung gebracht werden können, spricht man von kognitiver Dissonanz. Nicht nur dann, aber auch dann. Der Mensch lebt aber nicht gern im Widerspruch, vor allem nicht mit sich selbst, und so drängt es ihn, diesen aufzulösen oder wenigstens abzumildern. Einige bewährte Strategien haben sich herausgebildet.
In den Beschreibungen und Jury-Urteilen ist auffallend oft die Rede von edlen Materialien und wertiger Handwerksarbeit am Einzelstück. So könnten Sie dieses Buch und die darin vorgestellten Häuser als eine Art Haute-Couture-Modenschau verbuchen, die den Geschmack bildet, Trends setzt, zu Widerspruch und Diskussion reizt, und sich dann mit ästhetisch geschärftem Blick wieder dem Prêt-à-porter des Erreichbaren zuwenden. Analog dazu, wie ja auch der Spitzensport den Breitensport beflügeln soll.
Möglich ist auch ein beherztes Bekenntnis zum Privileg, zum Es-ist-nun-mal-so. Manche können sich mehr leisten als andere, und diese ungleiche Verteilung macht vor einem Allgemeingut wie dem Boden nicht Halt. Nicht nur manche Menschen sind reich, die Wirklichkeit ist es auch: Es gibt Zusammenhänge, da ist der Architekt als Sozialingenieur für die Unterbringung möglichst vieler gefordert, und es gibt Bereiche, da fungiert er als Dienstleister für individuelle Entfaltung. Ein gewisses Maß an Luxus für manche ist sowohl sozial wie auch ökologisch vertretbar und dieses Maß ist noch nicht überschritten. Und wenn doch, dann hätten Sie eben Adornos berühmtes Diktum, dass es kein richtiges Leben im falschen gäbe – mit dem er übrigens einen Text über das Wohnen schloss! – für sich jedenfalls widerlegt.
Eine weitere Möglichkeit bietet sich den Freunden des Symbolischen: Auch der Mensch, der sich aus Not oder Einsicht mit einem winzigen Appartement von 20 Quadratmetern in einem mehrstöckigen Wohnhaus begnügt, braucht zum Überleben mehr Erdoberfläche, als er anteilig bewohnt. Auch seine Nahrung muss irgendwo angebaut werden, auch die Solarmodule und Windräder zu seiner Versorgung müssen irgendwo stehen, auch die Baumwolle für seine Jeans muss irgendwo wachsen. Sein wahrer Anteil am Ressourcenverbrauch ist nur verschleiert.
Das Einfamilienhaus mit Garten drum herum wäre so betrachtet ein sinnfälliges Zeichen dafür, dass der Mensch von der Erde lebt. So lange jedoch im Garten nur Ziersträucher wachsen und nicht auch Getreide, ist damit jedoch wirklich nur auf symbolischer Ebene etwas gewonnen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir ja in Zukunft Chefärzte und Hedgefondsmanager Kaninchen züchten und Rüben ziehen für den Eigenbedarf. Dazu gibt’s selbst gekelterten Wein von der Südwand der Doppelgarage.
Oft zu beobachten ist auch der Ansatz, sich all die ökologischen und raumplanerischen Moralpredigten herzlich egal sein zu lassen und den Verzicht fordernden Untergangsszenarien zugunsten des prallen Lebens im Hier und Jetzt schlicht keinen Glauben zu schenken. Ganz wie der Pfarrer in einer kleinen Anek-dote von Oskar Maria Graf: Nach einem Dorffest am Samstagabend, auf dem wild gesoffen, geprasst, gerauft und auch anderen sinnlichen Freuden querfeldein gefrönt wurde, zündet er den Sündern am Sonntagmorgen in der Kirche eine glühende Predigt auf. Er steigert sich in einen regelrechten moralischen Furor und schildert die Martern der Hölle so plastisch, dass die Gemeinde schockstarr in den Bänken sitzt. Als er wieder aufblickt und die weinenden und entsetzten Gesichter sieht, merkt er, dass er zu weit gegangen ist und sagt: „Beruhigt’s euch wieder. Vielleicht stimmt’s ja gar net.“
Vielleicht sehen wir ja in Zukunft Chefärzte und Hedgefondsmanager Kaninchen züchten und Rüben ziehen für den Eigenbedarf. Dazu gibt’s selbst gekelterten Wein von der Südwand der Doppelgarage.
Sagen sie einem Kind, es soll ein Haus malen. Es wird ein Einfamilienhaus sein, keine Genossenschaftssiedlung und kein Wohnturm. Der Akt der Landnahme, des Einfriedens, des Schaffens von Obdach für sich und die Seinen ist tief verankert in unserer Kultur, die von Sesshaftigkeit, Kleinfamilie und Individualismus geprägt ist. Hier bin ich und hier bleibe ich.
Nahezu alle Häuser in dieser Sammlung reagieren auf die eine oder andere Weise auf die aufgeworfenen Fragen. Die Stichwörter Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, natürliche Materialien, Angemessenheit, verantwortungsbewusster Umgang, sensibel usw. finden sich durchgängig, ganz sicher öfter, als dies bei den Häusern des Jahres 1971 der Fall gewesen sein mag. So wahr dies ist, so üppig bemessen sind in den meisten Fällen die verfügbaren Quadratmeter pro Person, so wenig können sie als verallgemeinerbares Konzept des Wohnens für alle dienen. Sollen sie auch gar nicht. Schön sollen sie sein, gut gedacht und gut gemacht. Sie brauchen Platz, und sie haben ihren Platz in der architektonischen Palette.
Träumen Sie. Erfüllen Sie sich den Traum, wenn Sie können. In die Garage stellen Sie sich dann einen Oldtimer, vielleicht einen Citroën GS. Sie müssen ihn ja nicht so oft fahren, den alten Stinker. Aus Gewissensgründen.
Udo Wachtveitl, auch bekannt als Franz Leitmayr aus der ARD-Serie Tatort, ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur und Drehbuchautor. Er hat zwei Jahre lang als Kolumnist für die Architekturzeitschrift Baumeister geschrieben.