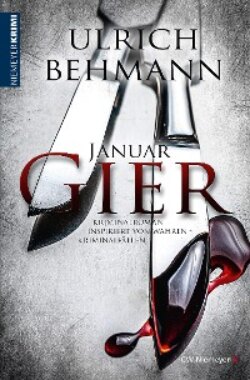Читать книгу Januargier - Ulrich Behmann - Страница 8
ОглавлениеKapitel 2
Der Regen, den „Lolita“ mit Windstärke 9 vor sich hertrieb, bildete eine Wand aus feinen grauen Nadelstreifen, die den nahen grasbewachsenen Seedeich unsichtbar werden ließen. Dicke Tropfen schlugen mit großer Wucht gegen die Haustür. Drinnen hörte es sich so an, als würde jemand kleine Steine gegen das Haus werfen. Im Schlot pfiff der erste Wintersturm des neuen Jahres, das gerade einmal 29 Tage alt war, seine schaurigen Lieder. Immer dann, wenn der ohnehin schon kräftige Nordwestwind auffrischte und Schauerböen über das flache Land peitschten, klang es in dem mit roten Ziegelsteinen verklinkerten Haus am Deich so, als rausche draußen ein D-Zug vorbei.
Vor sich auf dem Esstisch zwischen ihren Händen stand eine dampfende Tasse Ostfriesentee. Herma saß in der Küche ihrer gemütlichen Friesenkate in Ostbense und starrte in Gedanken versunken durchs Küchenfenster hinaus in das eintönige Grau, das die Felder und die Wiesen, die Bäume und die Windräder verschluckt hatte. Nicht einmal die im Sekundentakt aufblitzenden Warnlichter, die auf den Maschinenhäusern montiert worden waren, um Piloten von Hubschraubern und Kleinflugzeugen vor einer Kollision zu warnen, waren zu sehen. Mit ihren Augen, die müde und traurig aussahen, fixierte sie geistesabwesend einen Maulwurfshügel, der inmitten einer großen Pfütze stand, die sich über Nacht in ihrem Garten gebildet hatte. Der schwarze Erdhaufen, der aus der überschwemmten Rasenfläche herausragte, sah aus wie eine Vulkaninsel. Das Bild erinnerte Herma an ihre Kindertage. Damals hatte sie keine Folge der Augsburger Puppenkiste verpasst. Wenn „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ über die Mattscheibe flimmerten, hatte sie immer gebannt die Abenteuer der beiden auf der fiktiven Insel Lummerland, die aus zwei Bergen bestand, verfolgt. Noch heute waren ihr der Refrain der Titelmelodie und die Darstellung des Meeres mit flatternder Klarsichtfolie, die von einem blauen Licht angestrahlt wurde, in Erinnerung geblieben. Herma stieß einen tiefen Seufzer aus. „Ach ja ... Alles Scheiße“, hörte sie sich sagen. Das letzte Wort schoss zischend aus ihrem Mund. Es hörte sich an, als versprühe eine Schlange wütend ihr Gift.
Anfang Dezember war die Mordermittlerin in Hameln von einem Serienmörder attackiert, entführt und sehr schwer am Kopf verletzt worden. Herma hatte schwere Schädel-Hirn-Verletzungen davongetragen – und wie durch ein Wunder überlebt. Sie war dem Tod sehr nahe gewesen, hatte den Neurochirurgen der Medizinischen Hochschule Hannover ihr Leben zu verdanken. Knapp zwei Monate war das jetzt her. Herma van Dyck hatte sich nach ihrem wochenlangen Klinikaufenthalt mühsam ins Leben zurückgekämpft, allerdings zugleich auch in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Sie vermied bewusst den telefonischen Kontakt mit Harm Harmsen, der gerade an einer Polizeimission in Afghanistan teilnahm, und mit ihren Kollegen vom
FK 1 in Hameln. Herma hatte keine Lust, mit jemandem zu quatschen; sie war lieber allein. Die Kriminalhauptkommissarin befand sich in einer Art Sinnkrise. Sie fragte sich, ob der Beruf als Mordermittlerin, der vor wenigen Wochen noch für sie Berufung gewesen war, der richtige für sie war. Sie war dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Sollte sie das Schicksal erneut herausfordern und weitermachen – so als wäre nichts geschehen?
Herma nahm einen Schluck Tee, stützte ihre Ellenbogen auf der Tischplatte ab und umklammerte die 100 Jahre alte handbemalte Porzellan-Tasse, die einmal ihrer Urgroßmutter gehört hatte, mit beiden Händen. Sie war hin- und hergerissen. Sollte sie ihren Job, den sie so liebte, an den Nagel hängen? Oder sollte sie ihre Ängste verdrängen und sich möglichst schnell wieder in die Arbeit stürzen? Diese Entscheidung konnte ihr keiner abnehmen. Sie musste sie ganz alleine fällen. Herma kam eine alte Reiterweisheit in den Sinn, die ihr Vater häufig zitiert hatte. „Runterfallen. Wieder aufsitzen. Zügel richten. Weiterreiten.“ So hatte sie es bislang auch immer gehalten. Aber die hinterhältige Attacke hatte ihr Leben gänzlich verändert. Sie hatte ihr das Selbstvertrauen geraubt. Tagsüber wurde Herma häufig von Kopfschmerzen geplagt, nachts lag sie oft wach und verfiel in einen Grübel-Modus. Mit der rechten Hand strich Herma unwillkürlich durch ihr dünnes blondes Haar. An ihrem Hinterkopf ertastete sie die 15 Zentimeter lange OP-Narbe. An einigen Stellen war die inzwischen gut verheilte Wunde noch mit Schorf bedeckt. Mit den Fingerspitzen konnte Herma kurze Haarstoppel fühlen, die sich im Wundbereich gebildet hatten. Immerhin wachsen die Haare und ich behalte keine kahle Stelle zurück, dachte sie, presste die Lippen zusammen und quälte sich ein Lächeln heraus. Vorsichtig tastete Herma weiter ihre Kopfhaut ab. Mit ihrem Zeigefinger drückte sie auf das sich bildende Narbengewebe. Sofort schoss ein stechender Schmerz durch ihren Kopf. „Scheiße. Scheiße. Scheiße ...“, rief Herma. Es war ein Schrei der Verzweiflung. Würde sie wieder ganz die Alte werden?
Früher hatte sie Freude bei dem Gedanken empfunden, einen spannenden Fall zu lösen. Bei dem Wetter hätte sie ihren gelben Friesennerz, den sie vor langer Zeit im Emder Käptn’s Shop gekauft hatte und den sie so liebte, übergezogen und sich bei Sturm und Regen auf den Deich gestellt, um die Naturgewalten zu genießen. Heute saß sie in ihrer Küche und wurde von Depressionen gequält. Von Zeit zu Zeit hatte Herma das Gefühl, Wasser im rechten Ohr zu haben. Alle Geräusche und Stimmen, die sie wahrnahm, drangen dann seltsam gedämpft und nur sehr leise bis zu ihrem Innenohr durch. Manchmal brachte sie ein hoher Pfeifton fast um den Verstand. Diese Ohrgeräusche konnten tagelang anhalten. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt, zu dem sie gegangen war, hatte von Tinnitus gesprochen und einen Hörsturz diagnostiziert. Eine Krankenschwester hatte ihr kurz darauf eine Kanüle in die Armvene geschoben und eine Infusion mit hoch dosiertem Cortison gelegt. Allein der Gedanke daran ließ Herma erschaudern. Kein Zweifel: Der Mordanschlag hatte Spuren hinterlassen – an ihrem Körper und an ihrer Seele. Herma schüttelte ihren Kopf. „Verdammt, der Kerl ist tot. Ich lasse es nicht zu, dass dieses Schwein weiter Macht über mich hat und ich am Ende daran zerbreche“, sagte Herma laut zu sich selbst – so als wolle sie sich Mut machen. Dann wäre es dem Serienmörder Ronny Rosslau nach seinem Selbstmord doch noch gelungen, sie zu zerstören. Ihr Vater hatte recht, als er zu Lebzeiten zu ihr gesagt hatte: „Nach dem Sturz muss man gleich wieder aufs Pferd steigen.“ Wenn ich jetzt aufgebe, ist mein Leben, so wie ich es mag, vorbei, dachte Herma. Das durfte sie nicht zulassen. Die Ostfriesin trank einen Schluck von dem starken Assam-Tee. Sie wirkte jetzt entschlossen, beinahe trotzig.
Es war eine Stunde vor Sonnenuntergang. Der Regen machte eine Pause, die Wolken flitzten wie Getriebene vorbei und ließen keinen Blick auf den Himmel zu. Herma beschloss, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Sie wollte fühlen, dass sie lebte. Sturmböen trieben Nebelschwaden vor sich her. Die kahlen Äste der Bäume, die von ihrem Paps als Windbreaker rund ums Haus gepflanzt worden waren, schienen nach ihr zu greifen, als Herma van Dyck die Tür hinter sich ins Schloss zog. Der Mordkommissarin machte die unheimliche Stimmung keine Angst. Sie wollte ganz andere Gespenster loswerden. Herma lächelte nur; sie zog ihr iPhone 7 aus der rechten Gesäßtasche und hielt den magischen Moment fest. Dann ging sie schnellen Schrittes über den schmalen, aber asphaltierten Deichverteidigungsweg zum 200 Meter entfernten Seedeich, den sie aufgrund des dichten Nebels und der einbrechenden Dunkelheit nicht sehen konnte. Herma kannte den Weg wie ihre Westentasche. Sie war ihn schon unzählige Male gegangen – bei Wind und Wetter. Ein paar Minuten später hatte die Ostfriesin die Treppenstufen hinauf zur Deichkrone hinter sich gelassen. Sie breitete ihre Arme aus, lehnte sich in den Wind, der ihr das Gefühl gab, sie kurzzeitig halten zu können. Das Meer konnte Herma nicht ausmachen, wohl aber riechen und hören. Die Wellen klatschten gegen den mit schweren Basaltsäulen verkleideten Deichfuß. Herma atmete tief durch, sog die salzige Luft gierig ein wie ein Kettenraucher den Nikotinrauch. Sie würde sich heute Abend ein schönes Glas Rotwein gönnen, früh zu Bett gehen und morgen eine Entscheidung fällen.
Es war stockfinster geworden, als Herma zu ihrem Haus zurückkehrte. Von ihren schulterlangen Haaren tropfte das Wasser. Auf ihrem Gesicht hatte sich eine dünne Salzschicht gebildet. Mit dem Handrücken wischte sich Herma über ihre verklebten Augen. Im Schein einer alten Schiffslampe, die sie bei ihrem Lieblingsantikhändler Heino Onnen in Neugarmssiel gekauft hatte, erspähte die Kommissarin einen zweiten Maulwurfshügel – inmitten der kleinen Seenlandschaft, die sich in ihrem Vorgarten gebildet hatte. Wieder musste sie lächeln, wieder kam ihr Lummerland in den Sinn. Als sie die Tür öffnete und den gelben Kleppermantel abstreifte, war sie gut drauf – das erste Mal, seitdem sie das Krankenhaus verlassen hatte. Erst summte sie nur die Melodie aus Kindertagen, dann fing Herma zu singen an:
„Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer ...
... mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr.
Nun, wie mag die Insel heißen, ringsherum ist schöner Strand ...
Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.“