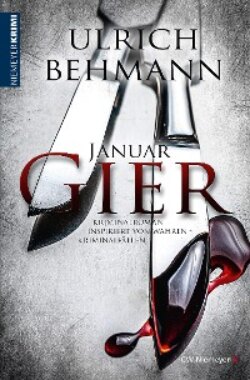Читать книгу Januargier - Ulrich Behmann - Страница 9
ОглавлениеKapitel 3
Als er in das schwarze Auge des fauchenden roten Drachens stach, der Frank Holdorfs rechten Oberarm zierte, leistete die Haut des Briefmarkenhändlers keinen nennenswerten Widerstand. Die feine Nadel drang blitzschnell vier Millimeter tief in das Unterhautfettgewebe des 55-Jährigen ein – gerade in dem Moment, als er ein Glas Bier an seine Lippen führen wollte. Es dauerte gerade mal eine Sekunde, da hatte die farblose Flüssigkeit den Spritzenkolben bereits durch eine äußerst spitze silberfarbene Kanüle, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen war, verlassen. Den Stich hatte Holdorf nicht gespürt. Er hatte allerdings die rasche Bewegung, die sein Mörder mit der Hand gemacht hatte, aus den Augenwinkeln heraus wahrgenommen. Der Hamelner wirkte überrascht. Ungläubig sah er den Mann an, den er wenige Stunden zuvor in einer Altstadt-Kneipe kennengelernt hatte. Dann fiel sein Blick auf die Spritze, die der sympathisch wirkende Mittvierziger zwischen Zeige- und Mittelfinger eingeklemmt hatte.
„Ey, du Arsch, was soll der Scheiß?“, stieß Holdorf hervor und rieb sich instinktiv über sein Drachen-Tattoo. „Was bist du denn für ein Perverser?“ Der Täter blieb die Antwort darauf schuldig. Er verzog sein Gesicht zu einer fiesen Fratze und grinste. „Halt’s Maul, Franky. Du hast es gleich hinter dir.“ In aller Ruhe steckte der Spritzenmann einen schwarzen Gummistopfen, den er in seiner linken Hand gehalten hatte, auf die Injektionsnadel und ließ die Spritze danach in die rechte Tasche seines Sweatshirts gleiten. Er würde die Spritze noch öfter benutzen. Dessen war sich der Mörder sicher. Dass es so einfach war, den perfekten Mord zu begehen, faszinierte ihn von Mal zu Mal mehr. Er hatte schon viele Menschen auf diese Weise getötet, aber noch nie hatten die Ärzte, die die Totenscheine ausstellen mussten, oder die Polizisten, die die von ihm verursachten Todesfälle untersuchten, Verdacht geschöpft. Jedenfalls hatte er später nichts in den Zeitungen darüber gelesen.
Die Injektion zeigte rasch Wirkung. Frank Holdorf schwitzte stark. Auf seiner Stirn hatten sich dicke Schweißperlen gebildet. Sie tropften im Sekundentakt auf seine hervorstehenden Wangenknochen und fielen schließlich zu Boden. In seinem Schädel hämmerte ein Kopfschmerz, der rasch an Intensität zunahm und ihn wahnsinnig machte. Holdorf begann heftig zu zittern. Sein Herz raste, seine von der Tränenflüssigkeit brennenden Augen fingen plötzlich nur noch verschwommene Doppelbilder ein. Frank Holdorf saß wie gelähmt auf seinem Sofa. Dieser Typ musste ihm irgendeine Droge, die ihn wehr- und handlungsunfähig machte, injiziert haben. Holdorf erkannte, dass seine Kneipen-Bekanntschaft Schubladen öffnete und durchwühlte. Er konnte nichts dagegen tun, nicht einmal mehr sprechen. Der Schmerz in seinem Kopf wurde unerträglich. Er hatte das Gefühl, sein Schädel würde gleich platzen. Holdorf fing an zu fantasieren, er stellte sich vor, dass in seinem Gehirn ein Hufschmied mit einem schweren Hammer auf einen Amboss schlug – wieder und wieder. Er wollte, dass es aufhört, aber es war nur ein Wunsch, der nicht in Erfüllung ging. Er bekam keine Luft mehr, stöhnte und röchelte. Die kehligen und rasselnden Laute, die seinen Mund verließen, hörten sich an wie ein kaputter Auspuff. 20 Sekunden später wurde das Stöhnen und Gurgeln leiser, trübte Holdorf ein. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein. Sein Oberkörper kippte zur Seite wie ein Sack Kartoffeln, dem jemand einen Fußtritt versetzt hatte, seine Augen waren weit aufgerissen und sahen angsterfüllt aus, seine Haut war aschfahl, seine Lippen wirkten blutleer. Das Gehirn hörte auf zu arbeiten. Weil deshalb die Impulse, die die Atmung auslösen, ausblieben, erstickte Frank Holdorf. Aber das bekam er schon nicht mehr mit.
Der Mörder würdigte Holdorf keines Blickes. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei achtete der Mörder peinlich genau darauf, dass nichts auf einen Einbruch hindeutete. Was er aus Fächern, Schubladen und Regalen entnahm und nicht gebrauchen konnte, legte er an seinen Platz zurück. Sogar Handtücher, die Holdorf fein säuberlich in seinem Badezimmer aufgestapelt hatte, legte er wieder zusammen, nachdem er sich versichert hatte, dass darin nichts versteckt worden war, und strich sie danach mit seiner rechten Handfläche glatt. Der Briefmarkenhändler hatte oft damit geprahlt, eine größere Anzahl Goldbarren zu besitzen. Er hätte es ihm nicht sagen dürfen. Einmal hatte Holdorf einen 100-Gramm-Barren im „KaLeu“, einer in Hameln bei Jung und Alt beliebten urigen Hafenkneipe an der Kupferschmiedestraße, herumgezeigt und so getan, als wolle er damit seine Zeche bezahlen. Frank Holdorf musste also reich sein. Und er dürfte seinen Schatz keiner Bank anvertraut haben. Wie hätte er sonst einen Barren mit sich rumschleppen können. Er wollte das Gold finden, hoffte, bei der Suche auch auf Geld zu stoßen. Bares erbeutete er besonders gern, denn: Geldscheine konnten ihn nicht verraten. Dass sich jemand die Nummern notiert oder die Banknoten mit unsichtbarer Farbe markiert hatte, kam eher selten vor.
Der Mörder ließ sich Zeit. Er hatte keine Eile. Er nahm größere Bilder von der Wand, schaute sich die Rückseite genauer an. Manchmal fixieren Menschen dort einen Tresorschlüssel oder einen mit Geld gefüllten Briefumschlag. Bei Holdorf wurde er jedoch nicht fündig. Der Spritzenmörder tastete die Unterseiten der Schubladen ab – schon mehrfach hatte er an solchen Stellen gefunden, wonach er suchte. Aber Holdorf hatte auch dort nichts versteckt. Er schaute sich im Wohnzimmer um. Mit Argusaugen nahm er alles ins Visier, was als Versteck taugte. Dabei fiel sein Blick auf den Toten. „Wo hast du dein Geld und Gold versteckt, du Drecksack?“, rief er. Es war eine rhetorische Frage, eine, die er sich selbst stellte. Denn Frank Holdorf – das war ihm klar – würde ihm keine Auskünfte mehr geben können. Eine alte Milchkanne, in der ein roter Schirm und ein Spazierstock steckten, weckte sein Interesse. Die zum Schirmständer umfunktionierte Kanne stand im Flur neben der Garderobe. Das konnte er von der guten Stube aus sehen. Er kniff seine Lippen zusammen, beschloss, auch in der Kanne nachzusehen. Er hatte in den vergangenen Jahren etliche Wohnungen durchsucht und dabei gelernt, dass die einfachsten Verstecke meist die besten waren. Er wusste: Die meisten Frauen versteckten ihren Schmuck im Schlafzimmerschrank – zwischen Bettwäsche, Schals und Tüchern. Oder unter der Matratze. Besonders Gewiefte lagerten Wertgegenstände in der Küche. In gut gefüllten Zucker- oder Mehldosen. Männer deponierten das, was ihnen lieb und teuer war, gern in Hohlräumen im Fußboden, unter Dielenbrettern. Es gab unzählige Möglichkeiten, Dinge zu verstecken – er glaubte, alle zu kennen. Der Mörder betrat den schmalen, mit abgewetzten bunten, grob gewebten Läufern aus den 1970er-Jahren ausgelegten Flur, der von einer Deckenlampe erhellt wurde. Eine Mücke kreiste um den Halogenstrahler, schien aber keinen Gefallen an dem grellen kalten Licht zu haben.
Er horchte auf. War da ein Geräusch gewesen? War Holdorf wider Erwarten nicht tot und wieder zu sich gekommen? Nein, das ist unmöglich, dachte er. Die Dosis, die er ihm verabreicht hatte, war absolut tödlich. Noch niemals zuvor hatte jemand die Injektion überlebt. In der Wohnung war es jetzt mucksmäuschenstill. Nur das leise Summen der Mücke und das monotone Brummen des Kühlschranks, der in der Küche stand, waren zu hören. Er schüttelte seinen Kopf, stieß leise pfeifend Luft aus und griff nach dem Henkel der zum Schirmständer umfunktionierten Kanne. Beim ersten Anheben wusste er, dass er einen Volltreffer gelandet hatte. Die Milchkanne war eindeutig zu schwer. Es musste irgendetwas in ihr stecken. Er zog die Kanne zu sich heran, holte Stock und Schirm heraus und fasste erwartungsvoll hinein. Er hatte gerade damit begonnen, den Boden abzutasten, als er ein Klacken hörte und im selben Moment einen heftigen Schmerz an den Fingern spürte. Reflexhaft zog er seine Hand aus der Tonne, klappte den Metallbügel um, der auf Zeige- und Mittelfinger geschlagen war, und entfernte die Mausefalle. Sein Gesicht sah seltsam verzerrt aus. Der Mörder schüttelte seine Hand – so als wolle er die Schmerzen wegschleudern. „Verdammtes Arschloch“, schrie er lauter, als ihm lieb war. Holdorf hatte seinen Besitz mit einer Schlagfalle gesichert. Er verfluchte den Kerl, der tot auf dem Sofa lag. Wütend packte er die Milchkanne und kippte deren Inhalt auf den Fußboden. Als er die einzeln in transparenten Kunststoff-Blistern verpackten Feingoldbarren sah, erhellte sich sofort seine finstere Miene. Er lachte triumphierend und stieß einen Freudenschrei aus, als er den Schatz in seinen Händen hielt. „Bingo. Hauptgewinn“, sagte er zu sich selbst. Mit heraushängender Zunge zählte er die Barren – es waren zehn. Speichel tropfte aus seinem Mund. Der Anblick von Geld und Gold löste bei ihm jedes Mal einen Pawlow’schen Reflex aus. Der berühmte russische Neurologe und Physiologe Iwan Petrowitsch Pawlow hatte bei seinen Studien über den Speichelreflex beim Hund immer geläutet, wenn seine Laborhunde gefüttert wurden – mit dem Ergebnis, dass die Tiere beim Klang der Glocke auch dann zu sabbern begannen, wenn gar kein Futter in Sicht war. Bei ihm verhielt es sich ähnlich. Nur dass er nicht an Zitronen oder an Nahrungsaufnahme dachte, wenn sein Speichelfluss aktiviert wurde. Geld und Gold lösten bei ihm diesen Reflex aus.
Der Serienmörder fingerte aufgeregt sein Smartphone aus der Gesäßtasche. Seine Hände zitterten. Bei Google gab er die Suchbegriffe „Goldbarren“ und „100 Gramm“ ein. Während die Suchmaschine Ergebnisse ausspuckte, malte er sich aus, was er mit dem Geld machen würde. Ein Luxusurlaub auf den Malediven kam ihm in den Sinn. Wozu sparen? Er war jetzt reich, konnte sich ruhig mal etwas leisten. Mit dem rechten Zeigefinger tippte er die Internetseite von Degussa an. Er lächelte zufrieden, als er die Summe sah. Ein Barren Feingold wurde dort für 4831 Euro angeboten. Nach Adam Riese war Holdorfs Gold also 48310 Euro wert. Wie geil ist das denn? Der Mann, der vor weniger als einer Stunde skrupellos und heimtückisch einen Menschen mit einer Injektion ins Jenseits befördert hatte, grapschte sich das Gold, steckte es hastig in seine Hosen- und Jackentaschen. Als er sich aus der Hocke erhob, stellte er fest, dass seine Hose von den Hüften rutschte. Er musste den Gürtel enger schnallen, ausgerechnet deshalb, weil er so viel Gold bei sich trug. Was für ein irrer Witz ... Der Spritzenmann prustete laut los. Er kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen ... Als er sich wieder beruhigt hatte, ging er zurück ins Wohnzimmer und schaute von oben herab auf sein Opfer – wie ein Habicht auf eine von ihm erlegte Maus. Mitleid hatte er nicht mit dem Mann, den er getötet hatte. „Selbst schuld“, dachte er. „Warum konntest du auch nicht dein Maul halten?“
Der Serientäter zog mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand ein aus roten und weißen Wollfäden zu einem winzigen Zopf geflochtenes Band aus der Brusttasche seines bordeauxroten Oberhemds. Er beugte sich hinab zu Holdorf, legte das Bändchen um das linke Handgelenk der Leiche und knotete es zu. „So, mein Guter. Das ist mein Abschiedsgeschenk für dich“, sagte er. „Vielleicht siehst du ja irgendwo da oben einen Storch. You never know. Gute Reise.“ Was er damit meinte, sagte er nicht. Warum auch? Holdorf konnte ihn nicht mehr hören. Der Mörder lachte nur – er schien amüsiert. Er schaute auf das Band – es war seine geheime Signatur.
Die Ermittler würden sie übersehen. Dessen war er sich sicher. Niemand war ihm bislang auf die Schliche gekommen. „Tja, ich bin halt schlauer, als die Polizei erlaubt“, brabbelte er grinsend vor sich hin. Bevor der Spritzenmann die Wohnung seines Opfers verließ, ging er ins Badezimmer. Er drehte den Wasserhahn auf und wusch seine Hände, die bei der Suche nach dem Gold schmutzig geworden waren. Das heiße Wasser, das von seinen Fingern lief, färbte sich schwarz, tropfte in das weiße Waschbecken und hinterließ dort Schlieren. Der aufsteigende Wasserdampf hatte sich auf dem Spiegel niedergeschlagen. Er konnte sein Gesicht nicht sehen. Ihm kam die Idee, noch ein Zeichen zu hinterlassen. Mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand malte er drei Striche auf die beschlagene Spiegeloberfläche. Es waren die Anfangsbuchstaben der Namen seines Idols, dem er seit fünf Jahren nacheiferte. Niemand würde seine Hinterlassenschaft deuten können. Wenn überhaupt, wurden die Initialen erst sichtbar, wenn der Spiegel ein weiteres Mal beschlug. Aber das würde wohl kaum passieren. Und falls doch ... Auch egal. Sichtlich zufrieden, mit einem Kilo Gold in den Taschen, verließ er Holdorfs Wohnung, die in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Domeierstraße lag. Er würde jetzt nach Hause gehen, sich ein kühles Zagorka einschenken und den Tag mit Hits von Emilia ausklingen lassen. So ein Volltreffer kam schließlich nicht allzu oft vor – der Erfolg musste gefeiert werden.