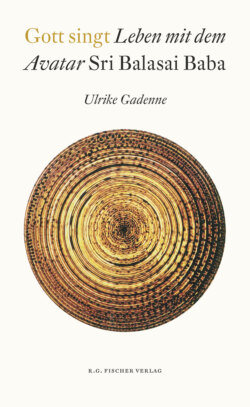Читать книгу Gott singt - Ulrike Gadenne - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Du bist bei Gott!«
ОглавлениеWer bist DU? Mit dieser Frage begann Weihnachten 1996 meine Beziehung zu Sri Balasai Baba. Mein Sohn hatte im Sommer 1996 einige Zeit in Seinem Ashram in Kurnool verbracht und – berührt von der Begegnung mit dem Avatar – schenkte er mir ein Foto und lud mich zu einer Reise nach Südindien ein. Ich sagte spontan zu unter der Bedingung, dass er die Reise organisierte. Ich wusste um die großen spirituellen Traditionen des Landes, und dass quasi jedes Dorf seinen Baba hatte, das heißt einen mehr oder weniger großen Heiligen, aber fühlte mich nicht dorthin gezogen, weil ich meine spirituellen Wurzeln mit Europa verband. Freunde von mir fuhren jahrelang zu Sathya Sai Baba und zeigten mir dicke Fotoalben. Sie machten keinen Eindruck auf mich, weil ich damals überzeugt war, dass beim heutigen Stand der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit jeder seinen spirituellen Weg ohne Guru gehen könne.
Ich merkte nicht sofort, wie schon das Betrachten dieses Bildes meine damaligen Glaubenssätze ins Wanken brachte – wollte ich doch nur als Tourist reisen. Das Bild zeigt Balasai Baba mit großer Haarkrone und roter Robe. Er sitzt mit überschlagenen Beinen frontal auf der Vorderkante eines Sofas und stützt beide Hände mit durchgedrückten Armen rechts und links neben den Knien auf. Der Gesichtsausdruck ist ungewöhnlich ernst und der Blick direkt auf den Betrachter gerichtet.
Je näher der Reisetermin kam, umso mehr veränderte sich der Gefühlshintergrund der Frage Wer bist Du?. War er zunächst neugierig unbefangen, so mischten sich mehr und mehr Respekt, Ehrfurcht, ja sogar etwas wie Beklommenheit ein, was ganz und gar nicht zur Touristenrolle passte …
Am 10. Juli 1997 betraten wir den Ashram in Kurnool. Balasai Baba war in Hyderabad, und der Platz war leer bis auf die Verwalter und indischen Bewohner. Es war die Zeit des Sommervollmondes, der dem Guru gewidmet ist. Die Anlage des Platzes war von den hohen Mauern eines alten Forts, dem Tungabhadra-Fluss, einem Gemüsegarten mit Kokosnuss- und Bananenbäumen und dem viel besuchten Shirdi Sai Baba-Tempel begrenzt.
Der weiße, schmucklose Tempel war als solcher nur durch den Gopuram, den typisch südindischen Tempelturm, zu erkennen. Die ganze Anlage mit dem Tor der Tripura Sundari, dem Shiva-Brunnen, dem Dhuni (eine Art ewiges Feuer) und dem Garten mit der Flussmauer, alles strahlte Einfachheit und Frieden aus. Vom Eingangsturm führte der Weg direkt auf eine kleine Bühne zu, ähnlich einem Puppentheater, wo unverkennbar Balasai Baba als Gipsfigur die Krishnaflöte blies. Bunte Kühe, Pfauen, exotische Pflanzen und Wasserfälle schmückten lebensecht die idyllische Szene aus. Der Weg führte durch das Tor der Tripura Sundari, und einige Meter weiter saß Shiva auf seinem Tigerfell aus Gips mitten in einem Brunnen, meditierend mit halb geschlossenen Augen unverwandt über den Tungabhadra blickend, doch der reichliche Gebrauch von Blau und Rosa machte ihn eher zu einer freundlichen Gestalt aus Disneyland.
Der Legende nach brach sich in seiner lockigen Haarpracht die zerstörerische Gewalt des Wassers der Ganga und verwandelte es in einen Segen für die Menschen. Darum wurde abends zur Bhajanzeit das Wasser des Brunnens hochgepumpt und ergoss sich leider eher tröpfelnd aus zwei Krügen über sein Haupt.
Den Tempeleingang bewachten zwei verschlafen blickende Elefanten. Vor der Tempeltür stand Ganesha – der Hüter des Eingangs. Er tanzte auf einem Sockel, trotz des dicken Bauches elegant, spielerisch und natürlich. Jeder Körperteil atmete Lebendigkeit – kein Wunder, dass Baba diese kleine Messingfigur über alles liebte. Immer wenn Er vorbeiging, blieb Er stehen, umfasste den kindlichen Fuß, tätschelte das runde Hinterteil, streichelte den Rüssel oder legte Seinen Kopf an ihn. Öffnete man die schwere Tempeltür aus Teakholz, bimmelten viele kleine Glöckchen zwischen den Schnitzereien und erzeugten einen vielversprechenden Klang, der auf etwas geheimnisvoll Verborgenes im Raum hinter der Tempeltür hinzuweisen schien …
Das Innere des Tempels war schlicht, und außer einigen Glocken und Trommeln fehlten alle Ausstattungen, die zu einem »normalen« Hindutempel gehören. Kein Priester achtete auf die Einhaltung der eines heiligen Platzes angemessenen Ordnung oder auf die korrekte Durchführung spezieller Verrichtungen oder Rituale. An der Stirnwand stand in einer Nische ein breites Sofa mit farbigen Kissen, auf dem Baba während des öffentlichen Darshan saß. Jede Einzelheit der Ashramanlage hatte menschliche Proportionen. Dies schien nicht der Ort, wo man Heiligkeit, Ernst, Distanziertheit und Traditionen zelebrierte.
Die Grenze zum Shirdi Sai Baba-Tempel bildete das langgestreckte Gebäude mit den Wohnungen der indischen Bewohner und den Räumen der Besucher im ersten Stock. Vor meinem Zimmer wuchs eine Palme und der Blick ging über den Garten und den Tungabhadra bis zur anderen Seite des Flusses. Damals wusste ich noch nicht, dass ich den gleichen Raum zwei Jahre später als »Permanente« wieder bewohnen würde.
Mit der Ruhe der ersten Tage war es bald vorbei. Gegen 6 Uhr morgens begannen gewöhnlich die täglichen Rituale im benachbarten Shirdi Sai Baba-Tempel mit ohrenbetäubend klopfenden Trommeln, bimmelnden Glocken, quäkenden und quietschenden Blasinstrumenten. Um 7.30 Uhr wurden die Mantren und Bhajans im Balasai-Tempel durch Lautsprecher gnadenlos in die Umgebung getragen, aber gegen 9 Uhr war der Platz wieder in friedliche Stille getaucht.
An den Tagen um Gurupurnima wurde die Ekstase vierundzwanzig Stunden nonstop zelebriert, und das zehn Tage hintereinander. Mit einer Kokosnuss, die ich während eines Einkaufs in der Stadt getrunken hatte, hatte ich mir eine heftige Darminfektion eingehandelt und musste während längerer Zeiten auf dem Klo ausharren, wo jetzt die Lärmkulisse gnädig meine Geräusche, die ich oben wie unten produzierte, überdeckte und ganze Liter von Schweiß auf den Boden tropften. Das war Indien pur. Wie oft habe ich mich in den Jahren später innerlich für den Luxus bedankt, auf einer eigenen Toilette sitzen zu dürfen!
Bevor nach vier Tagen des Eingewöhnens schließlich Balasai Baba zurückkehrte, geschah etwas Entscheidendes.
Ich stehe mit dem Rücken zur Flussmauer und schaue gedankenverloren in den Garten. Ich liebe die Palmen, die von allen Bäumen am deutlichsten das Spiel des Windes sichtbar machen, die Frangipani-Bäume, deren Blüten einen süß-betäubenden Duft verströmen, den Inbegriff von Orient, die Bougainvillea mit ihren magentafarbenen Scheinblüten, die so intensiv leuchten, dass sie dem Auge fast wehtun. Riesige, bizarr gezeichnete, schockfarbene Schmetterlinge taumeln in den Düften und Farben, und erdfarbene Streifenhörnchen huschen über den Platz und auf die Bäume, um aus sicherem Versteck spitze Warnschreie auszustoßen, bei denen jedes Mal auf drollige Weise der buschige Schwanz auf und nieder schnellt: sie leben ständig in Panik vor den zahlreichen Milanen, die bedrohlich niedrig über den Bäumen schweben und nach Beute ausspähen. Ein lauer Wind treibt riesige Wolkengebilde über den Himmel, so dass die Hitze erträglich ist. Von der anderen Seite des Flusses kommt das rhythmische Geräusch von geschlagener Wäsche.
In diese überwältigenden paradiesischen Eindrücke versunken, fährt plötzlich ein Gedanke durch meinen Kopf, der meinen inneren Frieden im selben Moment in Angst und Panik verwandelt.
Die Wirkung des sprichwörtlichen Blitzes, der im Niederfahren einen Baum spaltet und in Feuer setzt, ist dagegen ein schwaches Bild. »Du bist bei Gott!«, spricht etwas in mir, und ich weiß zutiefst, dass es nicht meine Worte sind. Gleichzeitig ist nur ein einziger Wunsch da: zu flüchten, mich hinter einem dieser Büsche zu verstecken, einfach zu verschwinden … So muss es Adam im Paradies gegangen sein, als er von der verbotenen Frucht gegessen hatte und sich hinter einem Busch versteckte, als Gott ihn rief. Bis ins Innerste zutiefst erschreckt und wie gelähmt tauchen von irgendwo die Worte auf: »Was will Gott von mir?« Im nächsten Moment schaue ich zu Boden. Genau vor meinen Füßen liegt eines der kleinen Bilder, die es im Buchladen gibt: ein segnender, lachender Baba mit der Botschaft: »Love all, serve all!« Das Bildchen habe ich vorher nicht gesehen, es dauert eine Weile, bis ich den Gedanken fassen kann: Das ist ja eine Antwort auf meine Frage!
Nur langsam löst sich der Schockzustand auf und ich finde mich in Zeit und Raum wieder.
Wenn sich das Erlebnis überhaupt in der Zeit abgespielt hat, sind es nur Bruchteile von Sekunden gewesen. Ich fühle mich wie nach einem Erdbeben, das alle bisherigen Sicherheiten in einem Augenblick weggebrochen hat. Aber ich habe überlebt, spüre mich selbst in der warmen Luft, unter den raschelnden Palmen und zwischen den taumelnden Schmetterlingen. Ein Papageienschwarm zieht wendige, elegante Kurven über den Tempelplatz, und im nächsten Moment fallen unzählige grellgrüne Pfeile in die Palme vor mir ein und ruhen sich schnatternd, kreischend und flügelschlagend aus …
Damals wusste ich noch nicht, wie eng mich diese Erfahrung mit diesem Ort verbinden sollte.
Nach vier Tagen hieß es: »Baba ist gekommen!« Obwohl ich geschwächt und elend mit Fieber im Bett lag, wollte ich Ihn unter allen Umständen abends im Tempel sehen und Seinen Darshan (schweigenden Segen) haben. Um 19.30 Uhr schleppte ich mich in den Tempel, wo nur im hinteren Drittel noch Platz direkt am Mittelgang war. Nach einigen Minuten betrat Baba die Nische und setzte sich auf Sein Sofa. Er trug die gleiche schlichte, traditionelle Robe, wie Er sie auch heute trägt, aber in meiner Erinnerung, die sicher vom Fieber beeinflusst war, trug Er ein Falten werfendes, gebauschtes Kleid, das in allen Farben changierte. Er stieg die Stufen zum Tempel herunter und kam direkt auf mich zu. Ein intensiver seelischer Schmerz ließ mich die Augen schließen und gleichzeitig stiegen ohne mein bewusstes Zutun die bekannten, aber seit Jahrzehnten nicht mehr gesprochenen Worte auf:
»O Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!« Was Baba sagte, als Er Vibhuti materialisierte und die feine Asche in meine Hand rieseln ließ, erinnere ich nicht mehr, das Fieber wirkte wie eine feurige Hülle, die alles Denken aufzehrte.