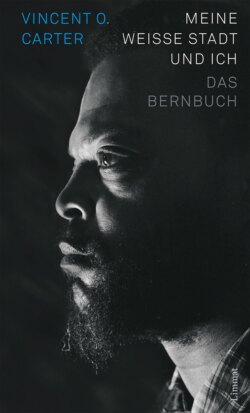Читать книгу Meine weisse Stadt und ich - Vincent O. Carter - Страница 13
Der ernstere Teil
Оглавление«Oh, ich weiß schon, was dir zu Paris einfällt», begann ich. «Die Liebe, der Zauber, Liberté, Fraternité, Égalité! Der Louvre, Montmartre und all das. Ich war schon überzeugt, bevor ich überhaupt da war. Es heißt, Paris sei der Ort, wo alle guten Amerikaner nach dem Tod enden. Ich war auf dieses Himmelreich genauso gespannt wie meine Landsleute. Aber nachdem ich einen ganzen Tag vergeblich versucht hatte, im Quartier Latin ein Hotelzimmer zu bekommen, weil man mich für einen Nordafrikaner hielt, musste ich meine anfängliche Meinung revidieren …»
«In Paris!», riefen meine Freunde aus.
«In Paris!», erwiderte ich triumphierend. «Ich lernte ein paar nordafrikanische Studenten kennen. Die erklärten es mir. Sie lebten schon seit vielen Jahren dort, sie hatten keine Sprachprobleme und waren zumindest auf dem Papier Franzosen, also mussten sie es wissen …»
«Du hast einen Komplex!», riefen meine Freunde wie aus einem Mund.
«Wahrscheinlich», räumte ich ein. «Ich hatte viele Komplexe. Trotzdem verstehe ich nicht, warum ich es so schwer hatte, ein Zimmer zu bekommen. Deshalb machte ich ein Experiment …»
«Was für ein Experiment?», fragte der junge Mann, der diese Unterhaltung angeregt hatte.
«Nun, ich stand am Schalter des American Express, als eine recht hübsche junge weiße Amerikanerin hörte, wie ich Französisch sprach und mir ein Kompliment machte. Ich bedankte mich und verwickelte sie in ein Gespräch.
‹Was machst du hier in Paris?›
‹Ich bin Journalistin. Ich hoffe, dass ich mit meinen Artikeln für die Herold Tribune meinen Urlaub finanzieren kann. Früher habe ich für eine kleine Zeitung in meiner Heimatstadt in Ohio geschrieben. Und du?›
‹Ach, ich würde auch gern eine Weile in Paris verbringen und schreiben. Aber es sieht nicht besonders gut aus; bis jetzt habe ich es nicht geschafft, ein Hotelzimmer im Quartier Latin zu bekommen. Woanders will ich nicht wohnen. Jedes Mal heißt es, man habe keine Zimmer frei. Aber das glaube ich nicht. Bestimmt hat es mit meiner Hautfarbe zu tun und dem, was sie über meine vermeintliche Herkunft aussagt.›
‹Du glaubst wohl, du bist noch immer in Amerika!›, lachte sie. ‹Das hier ist Paris!›
‹So heißt die Stadt, stimmt›, entgegnete ich, ‹aber in Amerika wäre es zu diesem Durcheinander gar nicht gekommen, jedenfalls nicht da, wo ich herkomme, denn dort hätte ich ein weißes Hotel gar nicht erst betreten!›
‹Ich bin ganz sicher, dass du dich irrst, und ich kann es dir beweisen!›
‹Wie denn?›
‹Indem ich in denselben Hotels nachfrage wie du.›
Ich hatte nichts anderes vor, also willigte ich ein und klapperte den ganzen Vormittag mit ihr das Viertel erneut ab. Ich zeigte ihr das jeweilige Hotel und wartete an der Ecke, während sie nach einem Zimmer fragte. Und jedes Mal hätte sie nicht nur ein Zimmer bekommen, sondern sich auch noch eins aussuchen können.
‹Ich verstehe das nicht›, sagte sie. ‹Trotzdem darfst du deswegen nicht allzu skeptisch oder verbittert sein.›
‹Ach wo, ganz bestimmt nicht›, sagte ich. Und dann äußerten wir beide die Hoffnung, dass am Ende alles gut würde, sie die Artikel für den Herold Tribune schreiben könne und ich ein Zimmer finden und meine Karriere als Schriftsteller beginnen würde. Anschließend tranken wir noch einen Kaffee zusammen und verabschiedeten uns.»
Das beschäftigte meine Freunde für eine Weile, dann konnte ich mit meiner Geschichte fortfahren, ohne dass sie mich unterbrachen.
«Am Ende fand ich tatsächlich ein Zimmer, in der rue Monsieur le Prince, im Quartier Latin. Es war ein winziges Loch, das auf einen dunklen Alkoven mit Oberlicht hinausging. Durch die fadenscheinigen, schmutzig-grauen Gardinen fiel kaum Licht in den Raum. Der Boden des Alkovens bildete das Glasdach des Foyers und war mit Abfällen, vergilbten feuchten Zeitungen, schmuddeligen Lumpen und Pfützen verdächtig aussehender Flüssigkeiten bedeckt. Der ganze Flur stank nach Pissoir. In meinem Zimmer gab es ein Bett, einen kleinen Tisch mit einer billigen Holzlampe statt einer Flasche mit Kerze und einen Stuhl. Es hatte weder einen halb zerfallenen Kamin noch eine dekadente Geliebte, die mich hätte trösten können. Die Atmosphäre war muffig und deprimierend. Die Laken auf dem Bett waren klamm. Als ich mich reinlegte, hatte ich das Gefühl von Pilzen an einem Baum. Es gab weder ein Kopfkissen noch eine Bettdecke, und es war zwar April, aber kalt genug für ein Holzfeuer. Das winzige Licht, eine nackte gelbe Glühbirne an der Decke, war so schwach, dass ich nicht mal das einzige Buch, das ich dabeihatte, lesen konnte, Homers Odyssee. (Die Holzlampe funktionierte nicht).
Ich beschloss, ein Bad zu nehmen und erfuhr, dass das erst am folgenden Abend möglich war und ich in Zukunft dieses Privileg im Voraus anmelden musste. Ein Bad kostete hundertfünfzig Francs extra, Seife nicht inbegriffen. Als es dann so weit war, ging ich vor Kälte zitternd zum Badezimmer im obersten Stock des Gebäudes und musste zu meinem Kummer feststellen, dass die Wanne nur halb so groß war wie eine normale Badewanne. Ich würde aufrecht sitzen und mich so waschen müssen. Ich würde mich nicht der Länge nach ausstrecken und lange und genüsslich im heißen Wasser aalen können. Und jetzt frage ich euch, liebe Hedonisten, für die ein heißes Bad gleich nach der beglückenden Umarmung eurer Liebsten kommt, was in aller Welt könnte schlimmer sein als das? Abgesehen von dem, was mich als Nächstes erwartete: Das Wasser war nur lauwarm! Das schlug dem Fass den Boden aus. Nach dem Baden beschwerte ich mich beim Hotelmanager, der meine Empörung mit einem kühlen, zynischen Lächeln quittierte. Dann äußerte er etwas, was ich nicht verstand, das sich aber so anhörte, als bäte er den lieben Gott um Geduld, um die Prüfungen seines unglückseligen Lebens meistern zu können.
Zitternd kehrte ich in mein Zimmer zurück. Ich hatte Hunger. Aber dann dachte ich, wie grässlich es wäre, wenn ich mich jetzt anziehen und durch eine Straße nach der anderen laufen müsste, bis ich ein preiswertes Restaurant fand, um mir dann den Kopf über eine Karte zu zerbrechen, die ich nicht einmal lesen konnte, und da verging mir der Appetit. Und weil ich im Halbdunkel meines Zimmers auch nicht lesen konnte, beschloss ich, mich hinzulegen. Ein bisschen Schlaf würde mir guttun, sagte ich mir. Schließlich war ich ja nur ein bisschen müde. Nach einem erquickenden Schlaf würde ich am nächsten Morgen frisch und fröhlich aufwachen. Also packte ich alles, was ich im Zimmer finden konnte, um mich warm zu halten, auf das Bett und kroch unter die feuchten Laken. Aber die Kühle drang trotzdem herein. Und die Matratze hing durch. Ich bekam Kopfschmerzen. Als sich endlich der erste verlockende Anflug von Wärme einstellte, merkte ich, dass ich auf die Toilette musste. Ich zog ein oder zwei Muskeln zusammen und beschloss, zu warten, bis es vorbeiging.
Ich war fast eingeschlafen.
Da brach unten auf der Straße plötzlich Gelächter aus: ein Mädchen und ein Junge, oder zwei Mädchen und ein Junge oder vielleicht zwei Jungen und ein Mädchen. Ich hörte Schritte auf dem Flur. Sie kamen an meinem Zimmer vorbei und blieben kurz stehen. Sie küssten sich. Dann gingen sie weiter. Das Licht aus dem Zimmer über mir fiel in den Alkoven, und ich sah ihre Schatten an der Wand hin und her tanzen. Dann erlosch das Licht.
Jetzt werde ich schlafen, dachte ich. Und dann hörte ich ein neues Geräusch, das in Wirklichkeit nicht neu war, sondern ziemlich alt. Die Sprungfedern im Bett über mir begannen zu quietschen, begleitet von Stöhnen, unterdrücktem Gelächter und unverständlichem Murmeln, auf das eine geradezu quälende Stille folgte. Nach einer Weile wurde diese Stille vom Geräusch zweier nackter Füße über mir unterbrochen: Patsch, patsch, patsch, vom Bett zur Tür, den Gang entlang, bis irgendwo in der Dunkelheit ein Scharnier quietschte. Es folgte ein leises, pieselndes Plätschern, das Gurgeln der Kette und das Rauschen der Spülung. Dann patsch, patsch, patsch, ging es den Gang zurück, von der Tür zum Bett. Und zu den quietschenden Sprungfedern.
Jetzt werde ich schlafen, dachte ich. Ich drehte mich mit dem Gesicht zur Wand und zog mir das Laken über die Ohren. Erneut ächzte das Bettgestell. Und wieder patsch, patsch, patsch hörte ich nackte Füße über mir, aber leiser, weicher, vom Bett zur Tür und den Gang entlang. Dann das Plätschern von Wasser, ein schneller dünner Strahl, das Gurgeln des Abzugs, das Rauschen der Spülung und dann: Patsch, patsch, patsch, zurück über den Gang, leise, weich, von der Tür zum Bett. Das Ächzen des Bettes, wieder und wieder, unter der Last des endlosen Hin und Hers. Das Licht erlosch. Endlich wurde es still.
Ich drehte mich mit dem Gesicht zum Fenster und versuchte einzuschlafen. Die Schatten, die ich gesehen, und die gedämpften Geräusche, die ich gehört hatte, erinnerten mich an den Mief, der durch den Gestank der Toilette und des Mülls auf dem Glasdach noch verstärkt wurde. Meine Gedanken erfüllten mich mit Einsamkeit und Verzweiflung. Kurz vor dem Einschlafen kroch ein schmutziges fahles Licht durch das Fenster. Es wurde hell …
Das alles ertrug ich einen ganzen Monat», erklärte ich meinen belustigten Freunden. «Ich wanderte durch die Straßen und besuchte die Museen, bis mir übel wurde. Ich saß allein, immer allein, in Café-Restaurants, im Regen und im Wind, und sprach nur mit Kellnern oder Leuten, die mir irgendwas andrehen wollten. Und bei fast allem, was ich kaufte, berechnete man mir zu viel. Kein Franzose beachtete mich. Die Reiseschecks wurden immer weniger und ich immer nervöser. Ich kann Dostojewski nur aus vollem Herzen zustimmen, die Bewohner von Paris sind materialistisch und größenwahnsinnig. Und als ich auf den Wänden ‹Amis raus!› las, war ich bereit, dieses Land zu verlassen, egal wohin und ohne Bedauern!
Eines Morgens lernte ich einen Holländer und seine amerikanische Frau auf der Terrasse einer Brasserie am Boulevard Saint-Michel kennen. Sie saßen am Nebentisch. Ich ließ mir eine dumme Ausrede einfallen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, in dessen Verlauf er folgenden Satz äußerte: ‹Das Leben in Amsterdam ist wunderbar!› Er beschrieb das Hafenviertel und die Grachten, und da er Schriftsteller war, machte er das sehr gut. Er war ein attraktiver junger Mann mit blonden Locken, einem kurzen Bart und wässrigen Augen. Seine Frau war auffallend hübsch – dunkles Haar und große dunkle Augen –, und sie war sich dessen bewusst. Sie stimmte mir zu, dass das Leben in Paris für Ausländer schrecklich sei, und er schwärmte von seiner Heimat. Während sie sprachen, kamen mir sofort Unmengen passender Bilder von Holland in den Sinn.
So saß ich auf dem verregneten, düsteren Boulevard Saint-Michel und sah dem endlosen Strom von französisch sprechenden Menschen zu, die sich für nichts anderes interessierten, als dem trägen Impuls zu folgen, der sie die Straße auf und ab trieb. Die Aussicht, das Land von Rembrandt, Spinoza und Descartes zu besuchen, erschien mir mehr als rosig. Und während ich sie beobachtete, dachte ich, dass ich Montaigne, Rabelais und Villon deshalb so leidenschaftlich verehrte, weil die Franzosen eine so wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hatten. Trotzdem kam es mir seltsam vor, dass ich die moderne französische Malerei, die Musik und Poesie so inständig lieben konnte. Baudelaire und Rimbaud waren meine engsten Freunde. Ich hätte den letzten Franc für einen Film von Jouvet ausgegeben! Warum konnte ich all das fühlen und die Menschen trotzdem so unsympathisch finden? Irgendetwas stimmte grundsätzlich nicht, doch damit kam ich damals einfach nicht zurecht …
‹Wenn Amsterdam so schön und das Leben so billig ist, wenn ihr beide Holländer seid und hier Probleme habt, warum lebt ihr dann nicht in Amsterdam?›, fragte ich ihn mit der Logik eines Pferdehändlers aus Missouri.
‹Meine Frau ist Jüdin›, entgegnete er. Ein hübsches Lächeln flog über ihr Gesicht. ‹Meine Eltern waren dagegen, dass wir heiraten …›
‹Um es milde auszudrücken!›, sagte sie und warf das dichte schwarze Haar über die Schulter.
‹Wir haben Amsterdam verlassen, um unser eigenes Leben leben zu können›, erklärte er. ‹Weil ein Schriftsteller vor allem frei sein muss, um so handeln und denken zu können, wie er will.›
‹Ich glaube, da hast du recht›, gab ich zurück. Seine Begleiterin stimmte mir mit einem spöttischen Lächeln zu. ‹Euer Mut hat mich zutiefst berührt, und obendrein habt ihr mir eine Lösung für mein eigenes Problem gezeigt.›
Kurz danach verabschiedete ich mich. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Amsterdam. Ich weiß nicht mehr, um wie viel Uhr, aber es war der erste Zug, den ich nehmen konnte.»