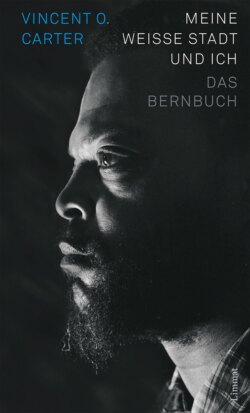Читать книгу Meine weisse Stadt und ich - Vincent O. Carter - Страница 16
Warum ich Deutschland verlassen habe
Оглавление«Ich bekam einen Brief von einem Freund. Er hieß David und war ein rothaariger Südstaatler aus den Smoky Mountains in Tennessee, der mittlerweile in Kalifornien lebte. Er schlug mir vor, einen Bekannten in Bern zu besuchen, den ich einmal auf einer Party in seiner Wohnung auf dem St. James Square in Philadelphia kennengelernt hatte. Ich fühlte mich wie Lazarus, als ihm ein neues Leben versprochen wurde. Gehorsam verließ ich drei Tage später Amsterdam, vorgeblich auf dem Weg nach Bern.
Doch unterwegs legte ich einen Zwischenstopp in Deutschland ein. Vielleicht bleibe ich eine Weile hier, sagte ich mir und vergaß vorübergehend den Ruf, der mich von den Toten erweckt hatte. Nun, der Grund, warum ich einen so außergewöhnlichen Gedanken hatte, vor allem angesichts dessen, was ich euch soeben über meine Gefühle in Amsterdam erzählt habe, war, dass ich auf dem College einen Zimmergenossen gehabt hatte, der sich an der medizinischen Fakultät einer deutschen Universität beworben hatte. Er beherrschte die Sprache ziemlich gut, nachdem er sie mithilfe eines hübschen Fräuleins erlernt hatte. Dieses Fräulein hatte er mir an langweiligen Abenden, wenn wir es uns nicht leisten konnten, den Campus zu verlassen, liebevoll bis in die kleinsten Einzelheiten beschrieben. Der eigentliche Grund dafür, dass er sich an einer ausländischen Universität dreitausend Meilen von zu Hause entfernt beworben hatte, war natürlich der, dass die amerikanischen Universitäten völlig überfüllt waren. Es gab kaum genug Studienplätze für die berechtigten Einheimischen, ganz zu schweigen von Juden, Chinesen, Japanern, Indianern und Schwarzen.
Die Universität befand sich in München. Auf dem Weg nach Bern kam ich durch München. Wir könnten uns wiedersehen, dachte ich, und erinnerte mich an die schöne Zeit, die wir auf dem College verbracht hatten. Vielleicht bringt mir ein hübsches Fräulein Deutsch bei. Ich könnte Goethe in seiner eigenen Sprache lesen … Ja! Ich werde in München bleiben, schreiben, studieren, die Kirchen genießen und mich kultivieren lassen …
Er wird überrascht sein, mich zu sehen, sagte ich mir, als der Zug in den Bahnhof einfuhr und ich zum nächsten Taxistand eilte. Es setzte mich an einem düster wirkenden Gebäude ab, anscheinend in einem Vorort der Stadt. Die Mittagssonne schien auf zwei dürre Bäume im Vorgarten. Es war ein warmer Tag, dennoch herrschte im Treppenhaus eine kühle und abweisende Atmosphäre, als ich die Stufen hinaufstieg. Ich hatte das Gefühl, als ginge ich in einen muffigen feuchten Keller hinunter. Es war absolut still. Die Fenster in den Türen der Wohnungen bestanden aus dunkel gefärbtem Glas. Dahinter tauchten gelegentlich Gesichter auf, die mich schweigend ansahen. ‹Wissen Sie vielleicht, wo …?›, begann ich, und schon war das Gesicht wieder verschwunden. Im dritten Stock öffnete sich eine Tür einen Spaltbreit, als ich daran vorbeikam, und ich hörte eine Frau lachen. Müde stieg ich weiter zum nächsten Stockwerk hinauf und überprüfte im Vorbeigehen die Namen auf den kupfernen Namensschildern. Schließlich fand ich im obersten Stock den Namen meines Freundes. Ich klingelte und wartete mehrere Minuten. Gerade als ich ein zweites Mal läuten wollte, ging die Tür ein wenig auf, und durch den Spalt blickten mich zwei misstrauische Augen an.
Es war nicht mein Freund, sondern Rufus Grey, ein anderer Student aus meinem College, den ich fast vergessen hatte.
‹Du!›, rief ich erstaunt.
Er öffnete die Tür ganz und sah mich an, vorsichtig, zögernd, ehe er mich hereinbat. Nachdem er mich eine Zeitlang gemustert hatte, schien er mich wiederzuerkennen. Er stieß einen Seufzer aus und sagte: ‹VO, Mann›, denn alle nannten mich VO nach den Initialen meines Namens. ‹Was machst du denn hier?›
Grey hatte sich stark verändert, wie ich sah, nachdem ich die Wohnung betreten hatte. Er war drei- oder vierunddreißig, ein ehemaliger Soldat, klein gewachsen, muskulös und kräftig. Aber er war auch sehr feinfühlig und ernst. Er hatte dunkelrote Sommersprossen, direkt unterhalb der runden kleinen Augen, was dem ernsten Gesicht einen komischen Touch gab. Seine Ohren waren geradezu lächerlich klein und eng an den runden Kopf gedrückt. Er trug einen schlichten braunen Anzug, der dringend gebügelt werden musste, obwohl er ziemlich neu und modisch geschnitten war.
‹Komm rein, komm rein›, sagte er.
Ich betrat den Raum und fragte mich, was hier los war. Er wirkte nervös. Sein Gesicht war müde und angespannt, die Augen rot unterlaufen und feucht, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Ich fragte ihn, wo mein Freund wäre, und setzte mich auf den Platz in der Nähe des Fensters, den er mir mit einer Geste angedeutet hatte. Verzweifelt breitete er die Arme aus.
‹Sieh dich doch mal um …› Er zeigte auf das schmutzige verwahrloste Zimmer. Es sah so aus, als hätte jemand in aller Eile gepackt und war dann verschwunden. Überall lag schmutzige Wäsche herum. In einer Ecke stapelten sich verstaubte Bücher. Der ausgebleichte Linoleumboden war mit Staubflusen und schmutzigen Papierresten übersät. In der Mitte lag ein Haufen Glasscherben neben einer leeren Weinflasche, und auf dem Tisch standen mehrere mit Essensresten verkrustete Teller, mitsamt Messern, Gabeln und Löffeln.
‹Was ist passiert?›, fragte ich.
‹Ich dachte, ich werde noch verrückt …›, sagte er leise und ein wenig abwesend, während er sich auf eine Holzkiste setzte, die als Nachttisch diente. ‹ Aber ich werde nicht verrückt!› Dann sah er mich an, als wäre ihm gerade ein verwirrender Gedanke gekommen. ‹Warum bist du hier?›
Ich erklärte ihm, dass ich meinen Freund besuchen wollte, daran gedacht hatte, mich in München niederzulassen und erstaunt sei, ihn nicht anzutreffen. Ein bitterer Ausdruck flog über Greys Gesicht.
‹Du hast sie wohl nicht mehr alle! Sie haben ihn verjagt. Es ist die Hölle hier!›
‹Was soll das heißen?›
‹Die Leute hier, Mann. Sieh dir das Zimmer an. Es kostet hundertfünfzig Mark im Monat. Zwei Mark extra für ein Bad! Kein fließendes Wasser. Angeblich wird es geheizt, aber da kannst du lange warten, Mann.›
‹Kann man sich nicht bei den amerikanischen Behörden beschweren?›
‹Ha! Denen ist das egal, Mann. Die Vermieterin ist ein Miststück. Und man kann nichts tun. Sie machen uns fertig …›
Allmählich erfuhr ich von Rufus Grey, dass das Leben in München alles andere als angenehm war. Er meinte, die Professoren und Studenten an der Universität seien abweisend, ja sogar feindselig, und dass man in einer fremden Sprache studieren musste, mache alles nur noch schlimmer. Er sagte, sie würden die ganze Zeit angestarrt und ausgelacht, und die meisten Frauen wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Seiner Ansicht nach waren die Leute verbittert und nachtragend, wegen des Krieges. ‹Der Nationalsozialismus ist alles andere als tot›, erklärte er.
‹Mag sein, dass ich Komplexe habe›, fügte er nachdenklich hinzu. ‹Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei noch immer in Georgia.› Dann sagte er in einem ziemlich zynischen Ton, dass mein Freund, um dessentwillen ich so weit gereist war, wahrscheinlich auch welche gehabt hatte, denn er habe es hier nicht mehr ausgehalten. ‹Er ist auseinandergefallen wie eine feuchte Brezel. Er hat sich in den Hurenhäusern volllaufen lassen und sein Studium vernachlässigt. Er ist zu einem dreckigen, vulgären und schlampigen Penner geworden, Mann.›
Ich war sprachlos. Zu Hause hatte mein Freund nie getrunken, er war ein pflichtbewusster Student gewesen, viel gewissenhafter als ich, da ich immer dazu neigte, aufs Geratewohl die Bibliothek zu durchforsten, sodass ich oft die Verbindung zu den Themen verlor, auf die ich mich für mein Studium hätte konzentrieren sollen. Ich war derjenige, der ihn gelegentlich überredet hatte, ins Kino zu gehen oder sich einen Tag freizunehmen. Grey erzählte mir auch, dass mein Freund in letzter Zeit sehr arrogant und anmaßend gewesen sei.
‹Man konnte einfach nicht mehr mit ihm zusammenleben. Nicht mal ich oder seine anderen amerikanischen Freunde. Mehrere davon sind Juden. Wir wohnen alle hier in derselben Pension. Gestern hat er dann das Fass zum Überlaufen gebracht, als er völlig betrunken einem der jüdischen Studenten eine Flasche auf dem Kopf zertrümmerte. Seit Wochen hält er jeden weißen Mann, der ihm in Deutschland über den Weg läuft, für einen Nazi … Sie haben sich übel geprügelt. Natürlich hatte der Junge was dagegen, eins über die Rübe zu kriegen. Vor allem von einem ‘Nigger’, wie er es ausdrückte. Das war ein großer Fehler. Aber er war stinksauer. Sie bewarfen sich mit Tellern. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, versammelten sich die Nachbarn vor der Haustür und auf der Straße und lachten sich krumm, weil zwei Amerikaner, ein weißer und ein schwarzer, nicht einmal dann miteinander auskamen, wenn sie nicht in Amerika waren. Ekelhaft!›
Ich fand es sehr traurig und beunruhigend, dass mein Freund sich so sehr verändert hatte. Doch wenn ich es mir recht überlege, kann ich nicht behaupten, dass das, was ihm passiert war, ungewöhnlich ist; ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es oft zu derartigen Szenen kommt, vor allem in größeren Städten, wenn alte Erinnerungen an die Heimat hochkommen oder wenn mich jemand bittet, einem Europäer die Rassenprobleme in Amerika zu erklären. Die Minderheiten, die von der Mehrheit unter Druck gesetzt werden, egal, wo sie leben oder arbeiten, bekämpfen sich manchmal gegenseitig, sei es aus Selbsthass, aus Angst oder, was noch erbärmlicher und zugleich auf geradezu perverse Art schön ist, aus der gewalttätigen und komplizierten Leidenschaft einer unaussprechlichen Liebe heraus. Vermutlich ist das eine von mehreren Erklärungen für das rätselhafte ‹Problem›, das Weiße und Schwarze im Süden Amerikas miteinander haben, wie es beispielsweise ein oder zwei amerikanische Schriftsteller, Mr. Faulkner und Mr. Caldwell gelegentlich bezeichnen. Aber wie schwer fällt es diesen Herren und den wenigen anderen, aber auch mir selbst, diese Wahrheit zu akzeptieren.
Kurz nach dem Streit, der offensichtlich am Abend zuvor stattgefunden hatte, war mein Freund aus Deutschland verschwunden. Grey erzählte, er habe nur eine kühle, unpersönliche Notiz gefunden, in der mein Freund ihm mitteilte, dass er weg sei. Und das erklärte zweifelsohne den Zustand, in dem ich Grey vorgefunden hatte, tief verzweifelt und einsam in einem offensichtlich unfreundlichen Land.
Die beiden mussten gut befreundet gewesen sein, wenn er so darunter litt! Ob mein Freund sein Studium in Amerika wieder aufgenommen hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Nachdem ich München verlassen hatte, habe ich Grey nicht mehr geschrieben. Aber ich weiß, dass er inzwischen verheiratet ist und einen Sohn und eine Tochter hat. Das erfuhr ich von einem Freund, der mir später schrieb und ihn zufällig erwähnte.
Seltsam, dass es so gekommen ist, dachte ich niedergeschlagen, als ich mich von Grey verabschiedete, der noch immer auf der Kiste saß. Mein Freund war so ein guter Student gewesen. Er hatte sich so sehr darauf gefreut, in Europa zu studieren und ein großartiger Arzt zu werden.
‹Ja›, hatte ich immer zu ihm gesagt. ‹Du wirst nach Deutschland gehen und ein großartiger Arzt werden.› Und er antwortete:
‹Und du musst nach Paris gehen und mindestens ein Dostojewski oder Proust werden.› Davon träumten wir damals, als wir in unseren Betten lagen, lange nachdem das Licht ausgegangen war …
Es ist so schade, dachte ich, als ich in eine breite, eintönige Straße einbog, in der nicht ein einziger Baum stand. Unter der sengenden Sonne überkam mich allmählich ein beklemmendes Gefühl. Und als ich unterwegs auf kleine Gruppen von Passanten stieß, dachte ich mit zunehmendem Unbehagen und Bedauern an Amsterdam – aber auch mit Sehnsucht. Dort war es mir besser ergangen. Grey hatte mir geraten, nicht in München zu bleiben, und ich beschloss, seinen Rat zu beherzigen.
Bis zum Stadtzentrum war es ein langer Weg. Die Sonne wurde zunehmend heißer und greller. Ich fragte einen Mann nach dem Weg zum Bahnhof. Er zeigte geradeaus, sagte etwas, was ich nicht verstand, und ging dann weiter. Ich lief in die Richtung, in die sein Finger gezeigt hatte. Nach einer Weile war ich vom Laufen und den deprimierenden Gedanken an meine Freunde so müde, dass ich beschloss, die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Als ich mich dem Zentrum näherte, bekam ich Durst. Ich betrat ein Lokal, das aussah wie ein Café, um bei einem Bier zu verschnaufen. Doch das Café entpuppte sich als Bierhalle.
Andererseits ist Bierhalle noch stark untertrieben. Der Saal, den ich ahnungslos betreten hatte, war ein Bierstadion! Riesig, mit einem feuchten Betonboden und vielen kleinen Abflüssen, durch die verschüttete Flüssigkeiten abfließen konnten. Es stank nach Bier, Urin und Schweiß. Reihen von langen Holztischen zogen sich vom Eingang bis zur hinteren Wand quer durch die Halle. An den Tischen saßen auf langen Holzbänken mit dünnen Stahlbeinen unzählige Menschen in allen Größen und Formen, mit unterschiedlich roten Gesichtern und tranken Bier aus riesigen Humpen. Kräftige Kellnerinnen schleppten mit Krügen voller schäumender brauner Flüssigkeit beladene Tabletts und setzten sie vor Männern und Frauen mit roten Nasen und wässrigen Augen ab, die das Bier dann durstig hinunterstürzten.
Ich ging hinein, setzte mich in den Lärm, winkte eine Kellnerin herbei und sagte: ‹Bier›. Kurz danach stellte sie mir das Glas vor die Nase. Gerade, als ich es zu meinen Lippen führte, setzte sich ein junges, pummeliges Mädchen von vielleicht achtzehn Jahren mit einem frechen Grinsen und einer Zahnlücke (sie sah aus wie aus einem Gemälde von Frans Hals), hinter mich und schob mir ihre plumpe Hand zwischen die Beine. Um ein Haar hätte ich mich übergeben. Sie sagte etwas auf Deutsch, das ich sehr gut verstand, obwohl die einzigen Worte, die ich kannte, Ja, Hamburger und Nein waren. Daher entschied ich mich für Nein, lächelte ihr kurz zu, und sobald sie ihre Hand weggezogen hatte, stand ich auf. Als ich den Saal schließlich verließ, beschloss ich, die Nacht doch lieber nicht in München zu verbringen. Allerdings stellte sich heraus, dass mir am Ende gar nichts anderes übrig blieb, weil der Zug zu einem ungünstigen Zeitpunkt abfahren sollte.
Todmüde taumelte ich auf der Suche nach einem billigen Hotel durch die Stadt. Die Luft war heiß und staubig von den vielen Gebäuden, die abgerissen oder neu gebaut wurden. Der Krieg, dachte ich und erinnerte mich an das Ghetto in Amsterdam. Nachdem ich durch viele Straßen gelaufen war und viele Fremde, die aussahen wie Militärs, Taxifahrer, Gepäckträger und Bahnbeamte, befragt hatte – offensichtlich trug hier jeder eine Uniform mit Schulterklappen –, landete ich bei einer sehr charmanten jungen Frau am Informationsschalter des Bahnhofs, die ausgezeichnet Englisch sprach. Sie erklärte mir genau, wo ich ein gemütliches und preiswertes Zimmer finden würde, und half mir, den Fahrplan zu entziffern. Ich bedankte mich bei ihr und lief zu Fuß zu dem Hotel, das sie mir empfohlen hatte. Dort ging ich sofort auf mein Zimmer, drehte den Schlüssel im Schloss um und fiel schwer auf mein Bett. Am nächsten Morgen gegen elf wachte ich auf. Und kurz nach eins stieg ich in den Zug nach Bern …
Während der Zug aus dem Bahnhof fuhr, ließ meine Beklemmung nach. Ein alter Nervenkitzel, den ich seit meiner Zeit als Soldat kannte, versetzte mich in Erregung, der Reiz des Unterwegseins mit einem neuen Ziel vor Augen. Als ich klein war, enthielt ‹morgen› immer die Verheißung auf etwas, was ich mir wünschte, egal was, aber heute nicht haben konnte … Vielleicht haben deshalb romantische und geheimnisvolle Dinge eine so wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Vielleicht habe ich deshalb immer befürchtet, dass das Unbekannte, das für mich mit all seinen unzähligen Möglichkeiten so kostbar ist, von der positivistischen Tendenz in ihrer ganzen Absurdität – heute fälschlicherweise als ‹wissenschaftlich› bezeichnet – einfach ausgeschlossen und ignoriert wird, weil es nicht berechenbar ist.
Wie heftig spürte ich das, als die düsteren Häuser, die an Kasernen erinnerten, grünen Feldern und Weiden wichen und die offene Landschaft mit den sanften Farben des Frühlings verschmolz! Blumen blühten, Kühe grasten, Bauern bestellten ihr Land. Wir kamen an einem Bach vorbei, ich holte tief Luft, und plötzlich kam mir ein Gedanke:
Ich kenne schwarze amerikanische Soldaten, die während des Krieges in Deutschland waren, und Soldaten, die nach dem Krieg hier Dienst taten und die Deutschen so liebten, dass sie deutsche Frauen heirateten und sie mit nach Amerika nahmen – was wirklich heldenhaft war! Es gab sogar welche, die nie nach Amerika zurückgekehrt wären, wenn sie gekonnt hätten … Jedenfalls haben sie das behauptet …
Diese Gedanken standen in gefährlicher Weise im Widerspruch zu den Erfahrungen, die ich in den letzten vierundzwanzig Stunden in Deutschland gemacht hatte, und sie beunruhigten mich. Offensichtlich hatte sich in Frankreich und auch in Deutschland nach dem Krieg vieles verändert. Ob andere deutsche Städte anders sind als München?, fragte ich mich. Lag es an meinen Freunden? Oder an mir?
Während ich mir über diese Fragen den Kopf zerbrach, sah ich wieder die Parolen an den Wänden und Zäunen von Paris vor mir, auf denen ‹Amis raus!› stand. Bei dieser Erinnerung zuckte ich zusammen. Und dann kam mir ein beruhigender Gedanke: Paris ist weit weg … Amsterdam ist weit weg … Die deutsche Landschaft entfernt sich … Meine Sinne wandten sich neuen Fragen zu, die sich in einer einzigen zu kristallisieren schienen: Was werde ich in Bern vorfinden?
Nun», setzte ich an, doch im gleichen Augenblick flammte die Beleuchtung auf, und das Mövenpick wurde von einem fahlen weißen Licht überflutet, einem kühlen, schmutzig-frostigen Glanz aus dem künstlichen Glasdekor am Rand des Balkons. In ihm gefror das intensive Grün der Blätter an dem imaginären Baum, der aus der Kasse wuchs, und dem anderen zwischen den beiden Tischen, die die Kellnerin schon vor langer Zeit für das Abendessen gedeckt hatte. Bei dieser Vorstellung musste ich schmunzeln. Nur ich konnte die Bäume sehen, alle anderen schauten zu, wie einer aufgeblasenen, modisch gekleideten Dame mit einer leichten Pelzstola und ihrem gleichermaßen aufgeblasenen Mann, dessen kahler Schädel leuchtend rosa wie ein gut genährter Magen glänzte, das Abendessen serviert wurde. Vor der Farbe des Schädels hob sich der Abend in einem intensiven Blau ab.
Meine Gefährten drängten mich fortzufahren, vor allem der Neue, der unbedingt wissen wollte, warum ich nach Bern gekommen war, doch ich bat sie, mich aufgrund der vorgerückten Stunde zu entschuldigen. Ich machte ihn auf die finsteren Blicke des Kellners aufmerksam und auf die Gefahr, wenn wir länger blieben. «Ich war früher mal Koch. Ich weiß, wie sich der Mann fühlt», erklärte ich. «In diesem Lärm kann man sich sowieso nicht mehr unterhalten. Außerdem bin ich zum Abendessen mit Freunden verabredet. Herr und Frau C. in Wabern (einem Vorort von Bern) haben mich zum Käsefondue eingeladen. Frau C. kann es nicht leiden, wenn man zu spät zu ihrem berühmten Fondue kommt, wenn es nämlich nicht sofort gegessen wird, verdirbt es, der Käse klumpt und bildet kleine Kugeln, so ähnlich wie Kaugummi. Und da ich kein Geld habe, um woanders zu essen, Gentlemen, nehmt ihr es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich die Geschichte irgendwann anders zu Ende erzähle …»
Ich war hungrig, erschöpft und irgendwie auch deprimiert nach der Anstrengung, meine beschwerlichen Schritte nach Bern zurückzuverfolgen. Außerdem frustrierte es mich, dass ich es nicht geschafft hatte, ihnen klarzumachen, worum es mir ging. Mein Gegenüber war unzufrieden, ich spürte es. Es hatte ihm nicht gefallen, was ich über Europa, die Franzosen und die Deutschen gesagt hatte. Vielleicht war er Welschschweizer, Deutschschweizer, Schweizerdeutscher oder Schweizerfranzose – ich zog alle Möglichkeiten in Betracht, sah aber ein, dass es zu spät war; der Schaden war bereits angerichtet.
«Ein anderes Mal», sagte ich, stand auf und verabschiedete mich. Ich trat durch die Schwingtür des Mövenpicks auf den Bahnhofplatz und fühlte mich nackt und beschämt. Bruchstücke von Gedanken wirbelten durch meinen Kopf, und das Geräusch, das sie verursachten, vermischte sich mit dem Verkehrslärm. Ich ging quer über die Straße Richtung Spitalgasse, schlenderte unter den Lauben von Loeb hindurch und ignorierte die modisch gekleideten Schaufensterpuppen unter den kristallenen Lüstern und die Menschenmenge, die durch die großen Eingänge strömte. Ohne es zu merken, ging ich in Richtung Sherrers, einem kleinen Restaurant in der Marktgasse, in dem ich oft aß, weil es so preiswert war. Dort setze ich mich in Ruhe hin, sagte ich mir. Dann fiel mir plötzlich ein, dass ich kein Geld mehr hatte. Madame C.s Käsefondue!, dachte ich, drehte mich um und stieß mit einem Mann mittleren Alters zusammen, der eine Melone trug und seinen schwarzen Pudel an einer gelben Leine führte. «Pardon!», entschuldigte ich mich, denn mir war klar, dass ich mich beeilen musste, wenn ich noch rechtzeitig zu Madame kommen wollte. Bis nach Wabern waren es gut fünfzig Minuten zu Fuß, und für ein Trambillet hatte ich kein Geld.