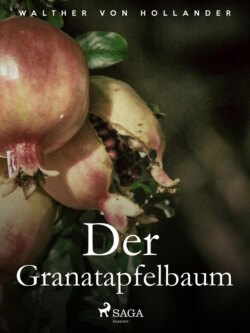Читать книгу Der Granatapfelbaum - Walther von Hollander - Страница 16
3
ОглавлениеDrei Tage lang wurden die Szenen der Unterwelt geprobt. Diedrichsen, der Dichter, fand, es seien die tiefsinnigsten, die bedeutendsten Szenen des Stückes. Sie schilderten die langsame Verwandlung der Seele, die den Styx überwindet, den Haßfluß. Dann den Acheron, die Wehströmung. Und Diedrichsens Idee war es, daß Pluto, der Herrscher des Hades, das geraubte Mädchen Kore, die erste Gestalt also Persephones, nicht zwingen konnte, den Haßfluß zu überqueren, den Schmerzfluß zu überwinden, sondern daß sie es freiwillig tun mußte, aus der Erkenntnis heraus, daß nur der zum Vergessen kommen kann, der zuvor durch den Feuerstrom und Tränenstrom gegangen ist. Ingo Keßler, der Bühnenbildner, ein spitznasiges, maus äugiges Männlein mit Existentialistenbart und Fransenfrisur, ein dreißiggjähriges Schattengebilde, wie für den Hades geschaffen, hatte ein großartig-unheimliches Bühnenbild geschaffen. Die fünf Flüsse aus schwarzen Stoffbahnen mit verschiedenfarbigem, phosphoreszierendem Bronzestaub bestreut, der Haßfluß fahlgrün leuchtend, die Wehströmung orangen, der Feuerstrom rot, der Tränenstrom silbergrau und Lethe, das Vergessen, fahl leuchtend, wolkengrau. Charon, der Fährmann, war in schwarzes Segeltuch gekleidet, begleitet von den drei Totenrichtern, die purpurne Kostüme hatten, in der Farbe also des Gerichts. Der Schnitt ihrer Kostüme war dem Charons-Kostüm gleich. Wenn sie die Arme ausbreiteten, wurden es Segel, und die Überquerung der Flüsse ging so vor sich, daß sie mit ihren ausgebreiteten Segelarmen über den Fluß wie auf Booten hinüberfuhren. Das Mädchen Kore in der Mitte, Pluto, den Herrscher, vor sich herschiebend. Bei der Überschreitung aber des Tränenstroms verschwand das Mädchen Kore zwischen den Richtern oder zwischen den Segeln, und in dem Augenblick, in dem Charon am Vergessenfluß, am Lethefluß die Hände Plutos und Kores zusammenfügte, um mit ihnen »heimzufahren«, in das Reich der Schatten, der ewigen Dämmerung, der zeitlosen Ewigkeit, der farblosen Endgültigkeit ... in diesem Augenblick tauchte Kore verwandelt in Persephone auf. Sie hatte das weiße Unschuldsgewand des Mädchens Kore abgelegt und trug das nachtschwarze Gewand der Unterweltskönigin mit einem merkwürdigen Kopfschmuck, einem spitzen, pagodenartigen Turm aus Bronzeglöckchen. Das war ein guter Einfall Diedrichsens, diese Glöckchenkrone Persephones, die über die Unterweltsflüsse hinweg, über Vergessen, Tränen, Feuer, Weh und Haß mit einem zarten Läuten sich abschiednehmend bemerkbar machte. Vielleicht, daß man sie auf der Oberwelt, vielleicht, daß die klagende Demeter sie hörte. Gleichzeitig aber war diese Krone mit ihrem ständigen, leisen Geläute ein Hindernis, je wieder in die Oberwelt emporzutauchen. Denn das Läuten in der Stille der Unterwelt verriet immer, wo sie war und machte die Flucht unmöglich.
Diedrichsen also fand diese undramatischen Szenen besonders schön, während Wyndthausen sie als Stimmungsschwindel bezeichnete, Beleuchtungseffekte, Farberzählungen »mit nichts drin«. Für Christine war es schwer, mit einem anderen Schauspieler zu spielen, nachdem sie sich an Wyndthausen gewöhnt hatte, an seine scharfe, schnelle, leise, an seine aus tausend winzigen Elementen zusammengesetzte Darstellung. Bossard – der Pluto – war ein ausgezeichneter Schauspieler, ein gutmütiger Riese mit einem dröhnenden, dunklen Baß, zur Bequemlichkeit und Fülle neigend. Ein Mann von fünfzig Jahren, der, in zweihundert Rollen erprobt, sich einen guten Namen erworben hatte, der »den ganzen Schwindel« kannte und durchschaute, der auf dreihundert Bühnen gestanden hatte, der nicht gewillt war, mehr zu tun, als er seinem Ruf schuldete. Für Christine ein ungewöhnlich langweiliger Partner. Sie hatte sich beim Studieren gerade auf diese Szenen gefreut. Aber jetzt konnte sie nur wenig damit anfangen. Dabei »standen« diese Szenen sehr bald. Auch Körner, der Unternehmer, fand sie am besten, am sinnfälligsten. Sie kamen mit ihren Breitwandeffekten dem Geschmack des durchschnittlichen, kinogeschulten Publikums am weitesten entgegen. Für ihn war Bossard der weitaus beste Schauspieler des ganzen Ensembles.
Mit Mumbo Petersen hatte Christine ihre einzige, heftige Auseinandersetzung. Sie standen nach der Vormittagsprobe im Speisesaal. Die Kellner, unter dem Befehl von Gustav, deckten tellerklappernd den Mittagstisch. Durch die schmalen Fenster an der Seite fiel ein wenig verschleierter Sonnenschein. Petersen hatte seinen Arm um sie gelegt und redete ihr gut zu. Sie werde diese Szene ebensogut spielen wie alle anderen. Aber Christine bat ihn dringend, die Flußüberquerung zu kürzen. Sie bat ihn, Bossard zu dämpfen und auf eine Linie mit ihr und Wyndthausen zu bringen. Sie mußte gleichzeitig für Henri sprechen. Mumbo wehrte mürrisch ab. Sie solle nur ihre Person und ihr Können verteidigen und es Wyndthausen überlassen, sich nach seiner Rückkehr durchzusetzen.
Ja – Wyndthausen war für drei Tage verreist. Grußlos, lautlos verschwunden. Er war nach München gefahren zu seiner Frau. Schuldete er Christine etwa Rechenschaft? Unsinn! Mumbo berichtete tückisch: »Wahrscheinlich wollte er seinen ›psychischen Fehltritt‹ beichten, seine Sünden mit Gertrude Schwarz. Er kann’s ohne Beichte nicht aushalten. Er braucht die Absolution seiner Frau. Wie finden Sie das?« Christine sagte unbefangen: »Nicht sehr angenehm für die Damen seines Herzens.« – »Das ist auch ein Standpunkt«, knurrte Mumbo. »Sie stehen also auf der Seite der Liebhaberinnen. Genau wie meine Frau. Aber gleichzeitig auch auf der Seite von Henri. Warum verzeiht ihr ihm eigentlich alles? Versteh’ ich nicht. Oder kannst du mir’s erklären?« Christine sagte leichthin: »Da ist nichts zu erklären. Es gibt Menschen, die sind wie sie sind. Mach was. Ändere sie. Geht nicht. Man kann nur ja sagen oder nein. Und Ihre Frau sagt eben ja.« Der Regisseur zuckte die Achseln: »Für meine Frau ist das Leben ’ne Bühne. Sie hat sich einen Stuhl in den Zuschauerraum gesetzt. Sie sieht sich alles neugierig an und findet es lustig. Kunststück! Es geht sie nichts an, was Wyndthausen treibt. Da läßt sich leicht ›ja‹ sagen.«
Die Schauspieler kamen lärmend zum Mittagessen. Christine ging zur Theke, um sich ihren Orangensaft zu holen. Gustav, der Kellner, hatte auch ein Glas für Henri hingestellt. Sie nahm die beiden Gläser. Es war ein gewisser Trost für sie, Wyndthausens Glas in der Hand zu halten. Er würde wiederkommen. Sie würden zusammen die gemuldete Treppe hinaufgehen, den Orangensaft schlüfen. »Sunkist«, würde er sagen. Der Regisseur trat noch einmal zu ihr. Er legte zärtlich seinen Arm um sie: »Manche Menschen möchte man in Watte wickeln und in einem Osterei verstecken«, sagte er und verbarg seine Rührung hinter heftigem Sächseln. Christine hob ihr Glas: »Na, dann Prost«, sagte sie lustig. (Das hatte sie am ersten Abend zum Schatten Wyndthausens gesagt.) Petersen wehrte ab: »Nee, nicht mit Orangensaft. Das kannste mit Wyndthausen machen. Mit mir trinkste heute abend ’n soliden Korn, Demeter – nach meiner Frau genannt. Verstanden?« Christine nickte. Und Petersen: »Du denkst immer, ich will dich warnen. Irrtum, mein Engel. So dumm bin ich nicht. Aber wenn du ja sagst, dann ist es kein Schauspiel wie bei meiner Frau. Es ist ernst. Es geht um Leben und Tod.«
Christine saugte scheinbar vertieft ihren Orangensaft durch den Strohhalm. Sie wollte ausweichen. Mit welchem Recht sprach Petersen so offen zu ihr? Sie sagte friedlich, als müßte sie ihn trösten: »Nanana. Höchstens um Oberwelt und Unterwelt. Um die Wiesen im Sonnenlicht – unvergeßlich – und die Weiden am eisigen Lethe-Fluß. Stimmt’s?«
Gustav, der Kellner, kam mit einer großen Schüssel vorüber. Mumbo hob den Deckel ab und sagte befriedigt: »Gulasch gibt’s heute. Solltest du auch mal essen. Statt eurer ewigen Orangen. Wie wär’s wenn du dich mal der Allgemeinverpflegung anschlössest?« Christine stellte das eine ausgetrunkene Glas auf die Theke. Sie sagte: »Ich dank’ Ihnen schön. Aber dies bekommt mir besser.« Damit ging sie hinaus.