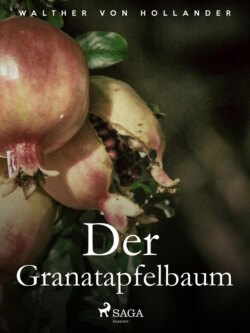Читать книгу Der Granatapfelbaum - Walther von Hollander - Страница 8
3
ОглавлениеDie Szene der ersten Begegnung oder vielmehr der Wiederbegegnung zwischen Triptolemos und Persephone war jene Blumenwiese, von der Pluto, der Fürst der Unterwelt, sie einst geraubt hatte, zu der sie auf das Geheiß Jupiters jetzt zurückkam. War sie nun, soeben der Unterwelt entstiegen, bereits von jenem Schattenleben des Hades befreit, hatte sie das inzwischen Erlebte, das in der Unterwelt, in der Dämmerung Erfahrene in dem Augenblick vergessen, in dem die grelle Sonne sie traf? Welch seltsamer Unterschied zwischen der Unterwelt, in der sie mit offenen Augen nur Graues sah und jetzt der Oberwelt, in der sie bei geschlossenen Augen Farben erblickte, ein goldenes Rot oder ein rosa Gold. Es war ihr noch nicht möglich, auf den Anruf des Triptolemos zu antworten, ihres irdischen Gemahls, der sie, zwischen Blumen liegend, anschaute, anlächelte und schließlich anrief: »Persephone ... Persephone!« Wyndthausen lag mit dem Kopf an einem Versatzstück. Obwohl er nichts in der Hand hatte, sah man den eben gepflückten Wiesenstrauß, den Willkommensstrauß, dem er Blüte um Blüte hinzufügte. Persephone! Persephone!
Unten, in der ersten Reihe, saßen Arno Petersen, der Regisseur, Ellen Heß, seine Frau, die Demeter und Diedrichsen, der Dichter der Persephone. Mumbo Petersen, der Dicke, beugte sich zu Diedrichsen. Er flüsterte: »Na, siehst es nun? Er hat mehr Melodie als deine schönsten Verse.« Das sollte heißen: Diedrichsen sollte es sich gefallen lassen, daß Wyndthausen eine Arie auf den Namen Persephone sang.
Ein reizvolles Kunststück, fand Christine. Aber paßte dieser Gesang zu der poetischen Auseinandersetzung zwischen dem irdischen, sonnenhaften Mann und dem jedem Wechsel unterworfenen, mondverwandten Wesen der Frau? Oder hatte Wyndthausen recht, daß ein Wiederbegegnen nach so langer Zeit sich dem Wort entzog, daß er sich deshalb in den Klang des geliebten Namens flüchten mußte? Sollte sie auch seinen Namen singen, wie er den ihren sang?
Sie öffnete die Augen. Sie ließ sich neben dem Mann nieder. Er durfte sie, seiner Rolle gemäß, nicht gleich erkennen, weil die Farbe der Unterwelt noch nicht aus ihrem blassen Gesicht verschwunden war, weil sie dort eine andere Gestalt verkörpert hatte und sich erst wieder in die irdische Person zurückverwandeln mußte.
Immer wieder der Ruf: »Persephone ... Persephone!« in allen Abstufungen, vom schattenhaften Geflüster bis zum tenoralen, hellen Schrei. Und endlich mündete dieser, allein aus dem Namen bestehende Monolog in die Handlung ein. Triptolemos hatte sie erkannt. Er nahm ihre beiden Hände. Genau wie Wyndthausen gestern bei der Begrüßung ihre Hände genommen und sie nach oben gedreht hatte. So tat er es auch jetzt. Und nun bekam diese Bewegung einen Sinn, der dem Dichter Diedrichsen unten im Parkett nicht eingefallen war und auch jetzt nicht auffiel. An den unveränderlichen Linien der Hand nämlich konnte Triptolemos erkennen, daß es unbezweifelbar die Verschwundene und die Wiedergekehrte, die in ihrem Wesen unveränderte Persephone war, die vor ihm stand, die sich zu ihm beugte, die sich neben ihn legte, die ihren Kopf an seiner Brust bettete. Und nun begann das leichte, leise Gespräch über das Verzeihen. Daß jeder des Verzeihens bedürftig sei, sie, weil sie gegangen war, wenn auch unter dem Zwang des Geschicks. Und er, weil er sie nicht festgehalten, nicht bewahrt hatte vor der Unterwelt.
Freilich auch er, vom übermächtigen Schicksal, von Ananke bezwungen. »Verzeih mir meinen Tod«, begann Christine. Es war endlich der von Diedrichsen gedichtete Dialog der Wiederbegegnung, des Wiedersehens. Persephone war von neuem auf dieser Erde. Sie fühlte die Wiese unter ihren Sohlen wie damals, ehe der Arm des Pluto sie umfaßte und sie auf den Wagen zog, der in die Unterwelt hineinraste. »Verzeih mir meinen Tod.« Sie sagte es gegen ihren Willen (und von welchem Willen gelenkt?), leise, unbetont, fast gefühllos. Sie griff nach den Blumen, die Triptolemos für sie gepflückt hatte, den Wiesenblumen, die nicht dufteten, aber einen Hauch von Sonne und Erdenluft atmeten. Eine poetische Szene, in der die beiden ein Zwiegespräch, ein ausweichendes Gespräch über die Blumen führten, durch das sie, ohne sich mitzuteilen, ohne über die Vergangenheit zu sprechen, das Vergangene ablegten und langsam, Wort für Wort, einander wieder vertraut wurden.
Christine hatte diese Szene besonders lange studiert. Sie wollte mit süßen Herztönen etwas über die wieder aufstrahlende, die irdische Liebe und ihr Begehren aussagen. Aber das, was sie studiert hatte, konnte sie jetzt nicht herausbringen. Sie mußte sich seiner Auffassung, seiner Tonart fügen. Das war etwas beinahe Gefühlloses, etwas Trockenes. Eine zu schlichte Aussage, deren Wahrheit den Zuschauer wahrscheinlich nicht ergreifen, nicht anrufen konnte. Sie empfand diese Unterkühlung des Gefühls als falsch. Aber als er – geradezu botanisch – die Blumen aufzählte, Trollblume, Wiesenschaumkraut, Margerite, Glockenblume und Zittergras, blühte erstaunlicherweise die Wiese auf. Nüchtern und dennoch poetisch. Gab’s denn das, poetische Nüchternheit?
Ihre Kraft ließ plötzlich nach. Wenn sie früher geprobt hatte, konnte sie viele Stunden spielen, abbrechen, weiterspielen, ohne daß es ihr etwas ausmachte. Aber diese Anpassung wider ihren Willen ertrug sie nicht. Sich fügen, dachte sie, ist schrecklich anstrengend. Darüber mußte sie lachen. Mit einer anmutigen Bewegung der flachen Hand durchschnitt sie das Zwiegespräch. Sie ging an die Rampe und knipste das Licht an. Unten hatten sich alle Schauspieler eingefunden. Die Totenrichter hockten mürrisch im Hintergrund, Gertrude Schwarz, die Psyche Hand in Hand mit Neander, dem Darsteller des Eros. Bossard, der Pluto, seinen historischen Roman unter den Arm geklemmt. Dicht vor Christine saß Olga Berliner, die Souffleuse, in der blechernen Halbkugel ihrer Unterwelt. Sie alle sahen neugierig auf die Bühne oder auf Mumbo Petersen, den Regisseur. Was würde er sagen? Das war eine unverständliche und doch anziehende Szene gewesen, eine Meßwarb, die man anders erwartet hatte, ein Wyndthausen, der sich viel mehr einsetzte als gestern bei seiner Szene mit Psyche.
Mumbo Petersen, der mit keinem Wort in die Probe eingegriffen hatte – es war sein Talent, die Schauspieler erst mal laufen zu lassen, ein Talent, das, wie sein ganzes Wesen in seiner Faulheit begründet war – Mumbo Petersen stand endlich auf. »Wollen wir weitermachen?« fragte er zu Christine hinauf. Sie zuckte die Achseln. Wyndthausen legte seinen Arm um ihre Schultern. Er sagte gönnerhaft: »Wir werden uns aneinander gewöhnen.« Das war sicherlich ein Lob. Aber sie freute sich nicht darüber. Aneinander gewöhnen? Sie hatte sich ihm angepaßt. Nichts weiter. Sie sagte: »Das war ich gar nicht.« Er antwortete: »Nein? Schade.«
»Es war schon ganz gut«, stellte Petersen fest. Wyndthausen verbeugte sich spöttisch: »Großen Dank. Wir sind uns leider nicht einig. Hat sie nun recht oder hab’ ich recht?« Diedrichsen, der Dichter, rief brummig: »Weder sie noch Sie. Ich hab’s anders gemeint.« Wyndthausen setzte mit einem Sprung über den kleinen Orchesterraum. Er schlug dem Dichter auf die Schulter und sagte vergnügt: »Ich kann nichts anderes rauslesen und auch nichts anderes reinlesen, Herr Diedrichsen. Wollte der Himmel, es stünde mehr drin.«
Damit ging er, ohne sich zu verabschieden, auf den Ausgang zu. »Verdammt nochmal, wir probieren noch«, schrie Petersen ihm nach. Wyndthausen drehte sich an der Tür um: »Muß mir erst mal überlegen, was man noch rauslesen könnte.« Damit knallte er die Tür zu.
Christine schaute ihm verärgert nach. Sie mochte solche Unbändigkeiten nicht. Olga Berliner reichte aus dem Souffleurkasten ihr Zigaretten-Etui hinauf. Daß Christine nicht rauchte, enttäuschte sie. Die Berliner qualmte und schwätzte vergnügt aus ihrer blechernen Unterwelt heraus. »Sie waren übrigens ... na toi ... toi ... wird man doch sagen dürfen. Ich habe viele Stars beflüstert. Für Sie beide bin ich überflüssig. Sie interessieren sich wohl für Ihren Beruf und können Ihre Rollen. Komisch.«
Sie klappte ihr Buch zu und schloß berlinerisch: »Det, was de machst ... det mach ooch. Ist so ’ne Art Wahlspruch von mir. Und was Sie beide machen ... das machen Sie auch.« Christine setzte sich neben den Blechkasten und ließ die Beine in den Orchesterraum baumeln. Die Souffleuse tätschelte ihr freundlich die Hand.. »Lassen Sie sich bloß nicht von Wyndthausen, von Henri, dem Siegreichen, in die Flucht schlagen. Er denkt, wenn er mit dem Fuß stampft, muß jeder weglaufen. Und wenn der andere statt dessen stehen bleibt und auch mit dem Fuß stampft, wird er wütend und freut sich darüber. Kapiert? Oder wenigstens verstanden? Ich kenne ihn genau. Hab’ schon drei Stücke mit ihm gemacht. Er wird wütend und freut sich, weil er dann ’n Gegner hat. Und wenn er ’n Gegner hat, dann hat er ’n Freund. Klare Brühe, was?« Christine mußte lachen. »Ich denke, Sie haben recht«, Frau Berliner tippte ihre Zigarette aus, gähnte herzhaft: »Dumme wie ich, treffen manchmal ins Schwarze.«