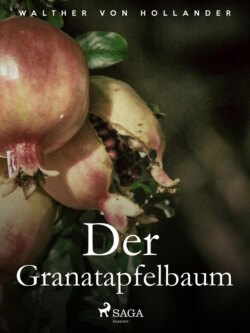Читать книгу Der Granatapfelbaum - Walther von Hollander - Страница 7
2
ОглавлениеEs war Abend. Aus der Ecke der Gaststube dampfte es wie aus einem Vulkan der Unterwelt. Die drei Totenrichter saßen dort. Der massige Kumminghaus, der dürre, langnasige Gernke und der ehemalige Bösewicht, Jan Schröder, dessen Bösigkeit längst in die Fettfalten seines Gesichts eingeschmolzen war. Deshalb mußte er, der noch vor wenigen Jahren die Hauptverbrecher in Kriminalfilmen gespielt hatte, jetzt eine drittklassige, eine Fünfzigworte-Rolle, eine Dreißig-Mark-Rolle spielen. Deshalb schielte er, der sonst beim Skat nicht links, nicht rechts schaute, immer wieder auf den Prominententisch, an dem die Götter und Helden, die Herren und Damen der Oberwelt sich versammelt hatten. »Die kommen noch alle zu uns runter«, räsonierte er, »in die Unterwelt mit Zigarre, hellem Bier und Kartenfreuden.« Er hieb dabei den Pik-Buben auf den Tisch und sammelte durch ihn die noch fehlenden »Augen«.
Am Prominententisch saß Christine mit Mumbo Petersen, dem Regisseur, mit Ellen Heß, seiner kornblonden Frau, der Demeter, mit Bossard, dem schwarzbärtigen Pluto. Neben Pluto Olga Berliner, eine rundliche Fünfzigjährige, die »Dame aus der Unterwelt«, die Souffleuse, die bald zu den Skatspielern hinüberzog.
Alle aßen Hennekes Beefsteak, die Spezialität des Hauses, die zum Ruhme des Dorfes Riedingen viel beigetragen hatte, ja vielleicht entscheidend für die Wahl des Dorfes als Probenort gewesen war. Es waren handgroße Beefsteaks mit Ananasscheiben belegt, mit krachendkrossen Bratkartoffeln geschmückt. Das Essen beanspruchte alle Seelenkräfte der Esser. Ellen Heß konnte nur die Hälfte bewältigen und legte die andere Hälfte ihrem Mann auf den Teller, was Mumbo mit fröhlichem Dankesgrunzen und freundlichem Gabelwinken quittierte. Zwischen Christine und Ellen hockte der Dichter der Persephone, Fritz Diedrichsen. Er war soeben angekommen, hatte – weil er sich gleich zurückziehen wollte – seinen Regenmantel nicht abgelegt. Den verknüllten Kragen trug er aufgeschlagen. Neben seinem Stuhl stand die große Reisetasche, aus der das Manuskript, das vielfach geänderte, herausragte.
Diedrichsen war etwa fünfundvierzig, kahlköpfig, mit einem grauen Haarrand um den Schädel, mit kleinen, kurzsichtigen, hellblauen Augen hinter einer randlosen, dicken Brille. Ein gleichzeitig pfiffiges und melancholisches Gesicht mit einer Stubsnase und vollen Lippen.
Er sprach rasend schnell und sehr leise auf Christine ein. Nichts, kein Komma, kein Ausrufungszeichen würde er mehr ändern! Eher würde er das Stück zurückziehen, als es verstümmeln oder aufschwemmen oder verarmen lassen. Er hatte vier Szenen für den windigen Wyndthausen eingestrichen oder neu geschrieben. Wenn Frau Meßwarb auch noch Änderungswünsche hatte ... bitte ohne ihn. Wenn ihr der Abschied Persephones z. B. nicht passe ... bitte sehr, dann würde sich eine andere Schauspielerin finden, die diese Szene verstand. Das war eben keine pathetisch-banale Liebesgeschichte, sondern ein Sinnbild des Wechsels von Herbst zu Winter, von Frucht zu Frost, von Farbe zu Schwarz. Kein Abschied mit prunkvollen Fanfaren, ein lautloses Verschwinden an irgendeinem Nebeltag. Eine naturgegebene Unterbrechung der Beziehungen zu Triptolemos, dem irdischen Gemahl. Das Vergessen, im Lethefluß errungen, in der Unterwelt gelebt, in der die berechtigte Gefühllosigkeit sich der Herzen bemächtigt. Ja, es gab die berechtigte Gefühllosigkeit und nicht nur die wärmende Liebe!
Christine winkte Gustav, den Kellner. Sie bestellte zwei Doppelkorn. Sie konnte Erklärungen ihrer Rolle nicht ertragen, ehe sie mit ihr fertig war. Diedrichsen schaute sie wütend an: »Aber ich trinke keinen Schnaps.« »Gut, dann trinke ich beide«, sagte Christine gleichmütig, »Bin abgehärtet. Wir hatten früher auf unserem Gut ’ne Schnapsbrennerei.« Sie prostete ihm zu. Diedrichsen nahm sein Glas, kippte den Korn und sagte mit erstickter Stimme: »Warum sind Sie mir denn böse?« Christine erklärte ihm, daß sie nicht böse war. Sie konnte nur den feierlichen Tiefsinn nicht leiden, der in jedem Gefühl eine doppelte Bedeutung versteckte wie ein buntes Osterei in Krokusblüten. »Entweder Osterei oder Krokus«, sagte sie.
Der Dichter fuhr fort, atemlos sein Stück, seine Figuren zu erklären. Christine hörte nicht mehr zu. Sie bestellte noch zwei Schnäpse. »Zwo Demeter«, sagte der Kellner Gustav bodenständig. Er kam mit der Flasche, auf deren Etikett Ähren abgebildet waren. »Unser Demeterschnaps«, stand drunter. »Ja, zwo Demeter«, lachte Christine und zu Diedrichsen: »Man kennt hier schon Ihr Stück.«
Sie sah in die andere Ecke hinüber. Dort saß jetzt Wyndthausen mit Gertrude Schwarz, der Psyche, einer blonden, faden Neunzehnjährigen. Er trug noch seine Proben-Uniform, die flaschengrünen Hosen, den gelben Pullover, das chinesisch-getuschte Halstuch. Er starrte mit seinen nachtschwarzen Augen abwesend über Psyche hinweg, die eifrig auf ihn einwisperte. Er bekam gerade den gleichen Schnaps, hob sein Glas und prostete zu Christine hinüber. Sie prostete mit dem leeren Glas zurück. Er lächelte. Sie stand auf, machte eine kleine, allgemeine Verbeugung, nahm Diedrichsens Manuskript an sich und ging hinaus.
Sie stand in ihrem Zimmer am Fenster. Der Halbmond ging drüben gerade hinter dem schmächtigen Dorfwäldchen unter. Er rutschte hurtig durch das Geäst hinab. Der milchfarbene Dorfteich glänzte noch einmal auf und verdämmerte. Gleich danach wurde im Zimmer nebenan Licht gemacht. In dem hellen Viereck erschien der Schatten Wyndthausens. Er wirbelte um sich selbst. Er übte also schon wieder seinen Monolog.
Christine grübelte. Würde sie sich, wie früher immer, an ihre Rolle verlieren? Ihre eigene Existenz einbüßen, die eigene Verantwortung? So wie sie mit 22 Jahren als Penthesilea an den Rand der Raserei getrieben wurde oder ein paar Jahre später als Alkmene in Giraudoux’s Amphitrion 38 in die Stürme einer heiteren Frivolität geraten war. »Gott schütze dich vor dem Gretchen«, hatte ihre Mutter einmal spöttisch gesagt, »sicher bekommst du dann ein uneheliches Kind.«
Der Schatten Wyndthausens stand jetzt mit erhobenen Armen im hellen Viereck. Er zog sich den Pullover aus und warf ihn hinter sich. Die Ärmel wehten in komischer Flatterbewegung. Christine sagte lustig: »Na ... dann prost.«
Wyndthausen aber, im Zimmer nebenan, setzte sich an sein Schreibtischchen. Dort lag ein Briefumschlag mit der Adresse Frau Irma Wyndthausen, München. Auf dem Löschblatt, mit der Schrift nach unten, ein angefangener Brief. Er las. Er lächelte. Das war ganz hübsch geschildert. Der behäbige Gasthof. Der gefräßige Mumbo Petersen, im Nebenberuf Regisseur, Ellen Heß, die Demeter, die aus Langeweile welkte. Psyche, der man erst eine Seele einhauchen müßte (aber er sei nicht berufen dazu), Bossard: Geschichtsliebhaber, Schauspieler von vorgestern, dröhnende Stimme aus einem leeren Faß. Ja, und nun ... Er schrieb:
»Nun also die Persephone, Christine Meßwarb. Noch keine zwei Worte mit ihr gesprochen. Einmal ihr zugeprostet. Sie stimmt mit ihrer Rolle völlig überein. Weißt ja, kann es nicht leiden, wenn jemand in seiner Rolle lebt. Oder aufgeht. Schultze soll Schultze bleiben. Schröder – Schröder. Wyndthausen muß tagsüber ein freundlicher, junger Mann aus Bayern sein, München, Isabellastraße. Ein Nichtsnutz oder Nichts. Christine Meßwarb also: das ist ein Frauenzimmer, lebhaft, recht hübsch. Kraushaare, Schafshaare ... würde ich sagen. Sind aber liebenswürdige Haare. Dunkelblaue Augen. Mag ich gern. Bis auf zuviel Seele drin akzeptiert. Müßte verwegene Hütchen tragen mit Schleier. Möchte wohl wissen, wie so ein Gesicht aussieht, wenn mal die Sonne scheint. Verstehst mich schon (von innen her. Sol – Seele). Kann sie strahlen? Kann sie leuchten? Soweit die Meßwarb. Woll’n morgen früh zusammen probieren. Vermute, es wird teils überraschend gut, teils, wie immer, eine Enttäuschung.«
Darunter schrieb er noch zwei zärtliche, freche Sätze, zwei liebenswerte Unverschämtheiten. Er malte eine winzige Karikatur von sich dazu. Die Nase vergrößert und angespitzt. Das Haar, das heute linksrübergekämmte, buschig gen Himmel strebend. Er holte aus der Schublade einen kleinen Malkasten. Er tuschte um den Hals der Karrikatur ein flatterndes, grauschwarzes Halstuch, tupfte die Farben sorglich mit einem Löschblatt ab, schob den Brief in den Umschlag und schrieb als Absender: Samuel Grundleder, Lehramtskandidat im Ruhestand, Eisleben am Südpol, Iglu 381. Seit drei Jahren schrieben sie sich Briefe mit unsinnigen Absendern. Manchmal waren in den Namen ganze Geschichten versteckt, Geständnisse, Liebeserklärungen, Fragen. In dem heutigen Lehramtskandidaten außer Dienst war nichts verborgen, außer reinem Unsinn. Wie angenehm, fand er, wenn man nichts zu gestehn und nichts zu verbergen hatte. Oder kaum etwas. Gertrude Schwarz, die Psyche, bedeutete ihm nichts. Na also!