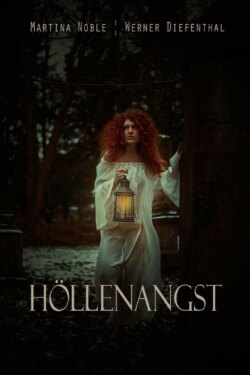Читать книгу Die O´Leary Saga - Werner Diefenthal - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Howth
ОглавлениеMargret ging am Ufer spazieren. Bei ihr war Samuel, der ihr nicht mehr von der Seite wich. Einerseits, weil er diese Frau wirklich sehr verehrte, andererseits aber auch, weil er spürte, dass sie ihn brauchte. Schweigend gingen sie nebeneinander her, dick eingepackt, um sich gegen den schneidenden Wind, der stetig blies, zu schützen.
»Ich weiß nicht, was hier los ist«, sinnierte Margret. »Ich habe gehofft, dass wir endlich Ruhe und Frieden finden würden.«
Sie hatte dem schweigsamen Mann alles erzählt, was sich in der letzten Nacht zugetragen hatte. Margret hätte es nie für möglich gehalten, aber der Schäfer war für sie jemand geworden, der ihr Halt gab, der sie stützte. Und sie musste sich selber eingestehen, dass auch sie, der immer der Fels in der Brandung gewesen war, jemanden brauchte, der ihr Kraft gab.
Samuel nickte. Er kannte mittlerweile die Geschichte von Sarah und Horatio und was sich in Ägypten zugetragen hatte.
»Ich würde es euch allen gönnen«, brummelte er. »Glaub mir, im Grunde genommen ist es hier friedlich.«
»Friedlich? DAS nennst du friedlich? Dieses seltsame Heim, dann die Albträume meiner Sarah. Und in der kurzen Zeit, in der wir hier sind, sind schon zwei Menschen unter ungeklärten Umständen gestorben. Das sind zwei zu viel, wenn du mich fragst …«
Sie stutzte, betrachtete die Wellen, die am Strand ausliefen und sich in weißer Gischt in der Ferne an den Klippen brachen.
»Was ist denn, meine Liebe?«, fragte Samuel und folgte ihrem Blick und der Hand, die sie ausstreckte.
»Samuel … sag mir, dass ich halluziniere. Ich glaube, da liegt schon wieder eine Leiche.«
»Was? WO?«
Dann sah er es auch. Nur wenige Schritte vor ihnen lag ein Körper im Sand, der immer wieder von den Wogen überspült wurde.
»Du bleibst hier!«, sagte er bestimmt und eilte zu dem, was er für einen Leichnam hielt, beugte sich über ihn und drehte ihn um.
»Ich kenne diesen Kerl!«, rief Margret, die sich trotz Samuels Anweisung genähert hatte.
»Ja, ich auch«, erwiderte der bärtige Mann. »Das ist Frank Ryan, einer der Fischergehilfen. Er ist schon seit ein paar Tagen verschwunden. Wahrscheinlich vom Schiff gefallen und ertrunken.«
»Dieser Kerl hat versucht, mir in Dublin meine Geldbörse zu klauen.«
Sie berichtete ihm von dem Vorfall auf dem Markt und dass sie immer wieder geglaubt hatte, ihn in Howth gesehen zu haben. Samuel kratzte sich am Kopf.
»Was machen wir? Einer müsste Andrew holen oder die Polizei. Aber ich kann dich weder hierlassen noch dich alleine losschicken.«
Samuel war in einem Dilemma. In diesem Moment hörte er das Schnauben eines Pferdes vom Weg oberhalb des Strands und blickte nach oben.
»Ist das …?
»Ja! MR. GORDON!«, brüllte Tante Margret.
Horatio, der mit Sarah von den Dohertys kam, wo er sie mittlerweile täglich hinbrachte, damit sie nach Frances sehen konnte, hielt die Kutsche an. Sarah richtete sich auf und sah zum Strand herunter.
»Mr. Kennedy? Tante Margret? Ist etwas passiert?«
»Kommt schnell her!« Tante Margret winkte hektisch.
Horatio sprang vom Kutschbock und rannte nach unten. Sarah folgte ihm auf dem Fuße.
»Was ist passiert?«, fragte sie. »Hast du dich verletzt?«
»Schon wieder eine Leiche!«, sagte Samuel leise. »Ich denke, er ist ertrunken.«
»Was? Nein!«
Horatio sah sich um, während Sarah sich die Hände vor den Mund hielt.
»Doch. Dort.«
Horatio betrachtete den Toten. Als er den Schnitt sah, der sich quer durch den Hals zog, zuckte er zusammen. Er kannte diese Wunden und warf Sarah einen schnellen Blick zu.
»Ihr bleibt hier, ich hole Andrew. Der ist nicht ertrunken.«
Samuel kam wieder näher.
»Wieso?«
Horatio zeigte den Schnitt.
»Dem wurde der Hals durchgeschnitten. Das war weder ein Unfall noch Selbstmord.«
»Wir müssen die Polizei holen!«, warf Sarah ein.
Horatio sah sie lange an.
»Sicher? Es werden viele Fragen gestellt werden.«
»Dazu sind doch diese Sesselfurzer da!«, zischte jetzt Tante Margret.
Margret vergaß immer mehr ihre gute Erziehung. Aber Horatio war nicht wohl dabei, die Polizei zu rufen. Er hatte den Mann auch erkannt, ebenso wie Sarah, die zu zittern begann. Es war der Gleiche, der ihr erst vor kurzem an die Wäsche gewollt hatte. Und nun lag er da, mit durchgeschnittener Kehle. Horatio hoffte, dass er sich irrte. Aber alles sprach dafür, dass der Tote ein Opfer des Rippers geworden war.
»Ich hole Andrew. Dann sehen wir weiter. Komm, Sarah, du kannst hier nichts mehr tun.«
In Wahrheit wollte er nur allein mit ihr reden. Der schreckliche Verdacht nahm ihm fast die Luft zum Atmen. Als sie auf dem Kutschbock saßen und er in Richtung Gut fuhr, warf er ihr einen langen Blick zu. Sie sah ihn störrisch an.
»Egal, was du denkst. Ich war es nicht.«
»Sarah … wenn du es doch warst, dann sag es mir bitte.«
»Was denkst du dir eigentlich?«, fuhr sie ihn an. »Ich habe ihn nicht umgebracht! Wenn ich jedem Mann den Hals durchschneiden wollte, der sich mir ungehörig nähert, hätte ich schon ganze Landstriche entvölkert!«
Er sah sie lange an, las in ihren Augen. War das noch Sarah oder war es wieder die Frau, die des Nachts durch London geschlichen war und Menschen getötet hatte? Sie schien jedoch ehrlich empört. Er seufzte.
»Ich glaube dir. Aber dass das Probleme aufwerfen wird, das ist dir hoffentlich klar.«
Das musste er ihr nicht erklären. Der dritte Tote, den man fand, und wieder hatte jemand aus ihrer Familie ihn gefunden.
Als Andrew später zurückkehrte, bestürmte Sarah ihn.
»Was hat der Inspektor gesagt? Wird er den Fall dieses Mal untersuchen oder ist er der Meinung, dass dieser Frank Ryan sich selber die Kehle durchgeschnitten hat und dann in die See gesprungen ist?«
Sie konnte ihre Verachtung für den Polizisten kaum verbergen. Zu stark waren die Erinnerungen an die Ausflüchte des Inspektors, der bei den letzten Toten die Leichenschau verweigert hatte und alles als Unfall oder Selbstmord bezeichnete. Andrew runzelte die Stirn.
»Nein, das nicht.«
»Aber?«, brauste Sarah auf.
»Er hält das für einen Mord unter Ganoven. Dieser Ryan ist bei der Polizei kein Unbekannter. Bisher hat man ihm allerdings nie etwas nachweisen können. Doch seine Verbindung zu anderen zwielichtigen Gestalten war bekannt.«
»Also unternimmt er nichts?«
Andrew hob die Schultern, ließ sie wieder fallen.
»Ich denke, er wird den Fall schnell zu den Akten legen. Als Margret ihm dann noch erzählte, dass sie in Dublin von ihm bestohlen worden ist, hat er nur gegrinst. Seine Vermutung geht dahin, dass Ryan wohl dem Falschen in die Tasche gegriffen hat oder aber seine Spielschulden nicht bezahlen konnte. Ein Mord unter seinesgleichen, meinte Brown.«
Sarah war fassungslos. Dass das Rechtssystem nicht optimal war, das wusste sie. Doch in London war zumindest immer der Schein aufrecht gehalten worden, während dieser Beamte für jedes Verbrechen eine Erklärung aus dem Hut zauberte, die dazu führte, dass die Untersuchung eingestellt wurde.
»Also läuft hier ein Mörder rum und die Polizei schläft«, stellte sie tonlos fest, drehte sich um und ging in ihr Zimmer.
Es war dunkel in dem Raum, in dem John Berkley sich mit seinen Auftraggebern traf. Nachdem er festgestellt hatte, dass die Ware, die er illegal nach England schaffen sollte, zum größten Teil wirklich unbrauchbar war, hatte er auf einem Treffen bestanden.
Seine Wut hatte er an Sally, seinem Hausmädchen, ausgelassen, und die Leiche des Mädchens anschließend auf einer Müllkippe entsorgt. Danach hatte er eine Nachricht an seine Geschäftspartner verfasst und sie ihnen zukommen lassen, was nicht ganz ohne Risiko war. Normalerweise wurde nur er kontaktiert und er sollte nur in Notfällen selber den Kontakt suchen, und als solchen empfand er die Situation. Die anderen drei Teilnehmer, die er weder persönlich noch vom Namen her kannte, standen etwas mehr als fünf Schritte entfernt, Kapuzen bedeckten die Gesichter, so dass er nur ihre Schemen erahnen konnte. Manchmal fand Berkley ihre übertriebene Vorsicht lächerlich. Manchmal dachte er, man könne nicht vorsichtig genug sein. Was man nicht wusste, konnte man nicht ausplaudern.
»Sie wollten uns sprechen?«, eröffnete einer der Drei das Gespräch. »Es ist, sagen wir mal, nicht sehr vorteilhaft, ja sogar gefährlich, wenn Sie uns kontaktieren. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund.«
»Den habe ich«, polterte der Schiffseigner. »Die letzte Ware, die mir geschickt wurde, ist unbrauchbar!«
»Was meinen Sie damit?«, fragte die mittlere Gestalt.
»Unbrauchbar! Ganz einfach. Was soll ich mit einer Ware, die bereits defekt ist? Meine Kunden erwarten sie in einem einwandfreien Zustand, damit sie mit ihr Geld verdienen können. Aber so, wie die Ware aussieht, legen sie noch drauf! Die Kosten für den Transport, die Versicherung. Und dann wollen Sie auch noch Geld. Doch dafür zahlen meine Kunden nicht. Das heißt, weder Sie noch ich sehen einen Shilling! Ich werde sogar noch Verlust machen!«
Die Gestalt zur Rechten schaltete sich ein.
»Wie kann das sein? Mir wurde versichert, es ist erstklassige Ware!«
Sie wandte sich an die Gestalt, die in der Mitte der Drei stand.
»Da müssen Sie sich drum kümmern! Mr. Berkley hat Recht. Wenn die Ware, wie er sagt, Ausschuss ist, muss sie ersetzt werden. Und das schnell!«
Er wandte sich an John.
»Wann läuft ihr Schiff aus?«
»Es ist bereits weg, dieses Mal ist es zu spät. Ich habe die Ware persönlich geprüft. Nur ein Drittel ist brauchbar, den Rest lasse ich unterwegs verschwinden. Aber der Verlust ist enorm, nicht nur an Geld und Ware, sondern auch das Vertrauen unserer Kunden ist damit erschüttert.«
»Sie haben Recht, das darf und wird nicht wieder geschehen. Aber leider ist unser Prüfer für die Ware nicht mehr aktiv.« Ein Blick zu der mittleren Person war nur zu erahnen, die daraufhin den Kopf senkte. »Ob wir dafür Ersatz finden, ist zur Zeit fraglich, also müssen wir uns anders behelfen. Teilen Sie unseren Kunden mit, dass die nächste Lieferung einwandfrei sein wird und als Entschuldigung nur die Hälfte kosten wird, nach Abzug Ihrer Unkosten.«
Berkley nickte. »In etwa drei Wochen brauche ich die Ware«, ergänzte er.
»Wir haben ein Problem«, begann die rechte Gestalt das Gespräch danach und wandte sich an die mittlere. »Sie müssen in zwei Wochen adäquaten Ersatz finden. Und zwar auf Ihre Kosten.«
Die vermummte Gestalt zuckte zusammen, nickte aber nur.
»Ich kümmere mich darum. Was genau wird gebraucht?«
»Wenn ich die Ladungsliste richtig im Kopf habe, zehn große und fünfzehn kleine Einheiten, dazu noch vier oder fünf in sehr klein.«
»Das wird knapp«, kam die Erwiderung.
»Das ist mir egal! Ich brauche sie! WIR brauchen sie. Und wenn wir ganz Irland auf den Kopf stellen müssen! Aber es gibt ein anderes Problem, Mr. Berkley.«
Der Reeder zuckte zusammen, ahnte, was kommen würde.
»Sie meinen den Toten, den man gefunden hat …«, begann er, wurde aber abgewürgt.
»Ja, genau den meine ich. Mir ist klar, dass Sie handeln mussten, als die Gefahr bestand, dass er auspacken würde. Aber die Ausführung war mehr als dilettantisch. Die Leiche hätte niemals gefunden werden dürfen. Nicht auszudenken, was hätte geschehen können.«
»Es tut mir leid, aber meine Männer …«
»Reden Sie sich nicht heraus«, fuhr ihn die rechte Gestalt an. »Und ausgerechnet die O´Learys mussten ihn finden! Wir werden zwar noch geschützt, aber auf Dauer kann es geschehen, dass es nicht mehr funktionieren wird.«
Berkley schwitzte. Sie waren eine Gemeinschaft, in der einer auf den anderen angewiesen war. Fiel einer um, würde er die anderen mitreißen. Und ihm wurde bewusst, dass er im Moment als das schwache Glied angesehen wurde. Was das bedeutete, war ihm klar.
»Noch einmal, es tut mir leid. Ich übernehme dafür die Verantwortung. Und es wird nicht wieder geschehen.«
»Das hoffen wir für Sie, Mr. Berkley.« Der Sprecher näherte sich ihm ein wenig, senkte seine Stimme. »Im Gegensatz zu Ihnen wissen wir, wie man eine Leiche verschwinden lassen kann.«
Damit drehte er sich um und verließ mit den anderen beiden den Raum. Zurück blieb der Reeder, der das Zittern seiner Hände kaum unter Kontrolle hatte. Die Drohung war ernst gemeint und er wusste, dass man ihm einen weiteren Fehler nicht verzeihen würde.