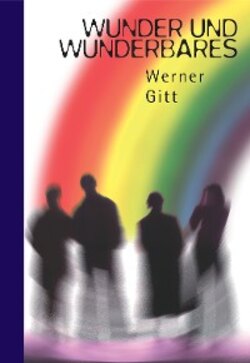Читать книгу Wunder und Wunderbares - Werner Gitt - Страница 56
2.1 Meine Kindheit in Ostpreußen Unbeschwert in Raineck
ОглавлениеIch wurde am 22. Februar 1937 in Raineck2 (Kr. Ebenrode; russ. Nesterow) im nördlichen Ostpreußen geboren. Das Dorf hatte 133 Einwohner (Stand: 7. Mai 1939)3 und war nur 15 Kilometer von der litauischen Grenze entfernt.
Meine Mutter Emma Gitt als Konfirmandin, 1917.
Eine Wiege habe ich nie besessen, dafür lag ich im Sommer in einem Wäschekorb unter den Bäumen des Gartens, der das etwa 100 Jahre alte Fachwerkhaus umgab. Ich verbrachte eine schöne und unbeschwerte Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof. Soweit ich mich erinnern kann, waren heiße Sommer und kalte Winter mit sehr viel Schnee damals das Normale. Wenn es einmal so heftig regnete, dass der Hof überflutet war, dann schwammen die meterlangen Futtertröge für die Enten und Gänse auf dem »Hofsee« und wurden von mir sogleich als Boot genutzt.
Oft strolchte ich auf der Wiese umher, die an das Haus grenzte und zu der auch ein Teich gehörte. Der Teich versorgte die Kühe mit dem notwendigen Trinkwasser, und die Enten schnäbelten im Wasser nach allerlei Essbarem. Tauchte ich im Sommer hier auf und ging dann in Richtung Hof, verließen alle Enten schlagartig den Teich und folgten mir im Entenmarsch. Sie hatten sich gemerkt, dass nun bald der Tisch für sie reich gedeckt werden würde, denn auf dem Hof angekommen, eilte ich zum Getreidespeicher, um mit reichlich Körnern zurückzukommen. So wurde ich zum Liebling der Enten.
Ganz anders beurteilten mich die Hühner. Manchmal öffnete ich die Tür des Hühnerstalls, nachdem das Federvieh sich bereits auf den Stangen zum Schlafen eingefunden hatte. Mein lauter Schrei »Husch, husch!« unterbrach die Ruhe, und alle Hühner flatterten wild im Stall umher. Was ich als Gaudi empfand, war für die Hühner weniger zum Lachen. So galt ich bei ihnen wahrscheinlich als der Hühnerschreck.
Im Winter gab es oft so viel Schnee, dass sich meterhohe Schneeberge auf dem Hof türmten, die durch Schneeverwehungen zustande kamen. Zwischen der Scheune und den beiden Ställen konnte der Wind vom verschneiten Feld ständig neuen Schnee herbeischaffen. Statt Lederschuhen trug ich ausschließlich »Klompe«, also Holzschuhe, die mein Vater selbst in der gut ausgestatteten Werkstatt anfertigte. Mit diesem Schuhwerk bekam man keine kalten Füße, und wenn der Schnee schon »pappte«, bildeten sich manchmal zehn Zentimeter hohe oder noch höhere Schneebatzen, die am Holz klebten.
Die liebevolle Art meiner Mutter rührt mich noch heute in meiner Erinnerung. Überall, wo sie etwas auf dem Bauernhof verrichtete, durfte ich dabei sein. Sie hatte ein Herz für alle. Immer wieder kamen Bettler und Landstreicher zu uns. Niemand verließ unseren Hof, ohne reichlich mit Essen versorgt worden zu sein. Meine Mutter ließ die Landstreicher manchmal sogar übernachten.
Bauernhof Gitt in Raineck. Im Vordergrund steht mein Vater auf dem Feld. Rechts: Stall mit davor stehender Baumreihe. Links: Hinter den hohen Birken befindet sich das von hier aus nicht sichtbare Wohnhaus, 1943.
Wenn Vater vom Feld kam und im Wohnzimmer seinen Stammplatz einnahm, eilte ich auf seinen Schoß, und er erzählte mir allerlei Geschichten. Er hatte immer Zeit für mich.
Vater war mit großer Freude Bauer. Er erzählte später oft, wie er jene Felder, die an der Straße lagen, besonders gut düngte, um Vorübergehende in Staunen zu versetzen. Rüben an der Straße hatten oft Übergröße und wären heutzutage weltrekordverdächtig, denn sie standen wie die »Thomasmehlsäcke«. Mein Vater verglich gern seine Rüben mit den 50 kg schweren Säcken für Düngemittel.
Er war sehr fortschrittlich und hatte oft als Erster im Dorf eine neue landwirtschaftliche Maschine, die gerade auf den Markt gekommen war. Im Gegensatz dazu war mein Großvater, was Neukäufe anbetraf, sehr zurückhaltend. Da alle im selben Haus miteinander wohnten, gab es vor jeder größeren Anschaffung heftige Diskussionen.
Während sich die heutigen Bauern aus wirtschaftlichen Gründen entweder auf Viehzucht oder auf Getreideanbau spezialisieren, gab es damals auf einem Bauernhof von allem etwas. Wir hatten Pferde, Kühe, Schweine, Schafe und eine Vielfalt an Federvieh: Puten, Gänse, Enten und Hühner. Angebaut wurden verschiedene Getreidesorten und Hackfrüchte. Auch der Mohn für den berühmten ostpreußischen Mohnkuchen durfte nicht fehlen. Die Kühe wurden selbstverständlich noch von Hand gemolken. Wenn das Vieh versorgt war, ging es von frühmorgens bis abends aufs Feld. Da kam im Sommer keine Langeweile auf. Im Winter sah das schon anders aus. Da galt es nur die Tiere zu versorgen und die Geräte auszubessern, so dass wir viel Zeit hatten, um abends zusammen am Kachelofen zu sitzen.
Lageplan des Dorfes Raineck, vor 1945.
Bei uns auf dem Land wurde ausschließlich Platt gesprochen, und so konnte ich kein einziges Wort Hochdeutsch4, als ich im Sommer 1943 eingeschult wurde. Die Rainecker Dorfschule hatte, wie es damals auf dem Lande so üblich war, nur ein einziges Klassenzimmer, in dem die Schüler aller acht Klassen gleichzeitig unterrichtet wurden. Die erste Klasse saß auf den ersten beiden Bänken des linken Blocks. Die achte Klasse saß in der letzten Reihe des rechten Blocks, dazwischen saßen nach Jahrgängen geordnet die anderen Klassen. Der Lehrer konnte natürlich immer nur zu den Schülern einer Klasse sprechen – es sei denn, er sagte zum Beispiel: »Nun die Klassen drei bis sechs hinhören.« Die anderen lasen, rechneten, schwatzten oder schauten einfach nur in die Luft. Lehrer Brehm unterrichtete zwar auf Hochdeutsch, aber er akzeptierte es, dass ich alles auf Platt sagte. Wie die anderen mit mir eingeschulten Kinder sprachen, daran kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern.
Als ich eingeschult wurde, hatte mein acht Jahre älterer Bruder Fritz (* 29. Oktober 1929) bereits die Rainecker »Bildungsstätte« durchlaufen und arbeitete als angehender Bauer auf dem Hof.
Unser Lehrer war offenbar schon damals seiner Zeit weit voraus und verfügte über feinste pädagogische Sensibilität. Da ich bezüglich Musik weder eine »Resonanzstelle« hatte noch eine natürliche Begabung mitbrachte, vermied es unser Dorfpädagoge, mich auch nur zum Lernen der Liedstrophen zu animieren, um meine »musikalische Entwicklung« nicht etwa zu gefährden. So kam es, dass ich bei dem gemeinsamen Gesang in der Klasse meine eigene Melodie erfand und in Unkenntnis des Liedtextes ein neues Libretto kreierte. Die gleiche individuelle Art legte ich an den Tag, wenn es bestimmte Kräuter zu sammeln galt. Ich pflückte irgendetwas, von dem ich meinte, das könnte wohl das verlangte Kraut sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Sammlung jemals nicht akzeptiert wurde.
Außer über uns Schüler verfügte unser Lehrer über ein wenig Land und eine Kuh. Sicher wollte er nur das Beste für uns, wenn er uns zur Verrichtung kleinerer Aufgaben auf seinem Grundstück heranzog. Schließlich besteht das Leben nicht nur aus Theorie, sondern auch aus der Praxis. Zur Zeit der Erdbeerreife engagierte er uns zum Pflücken. Während er anderen Dingen nachging, taten sich seine Erntehelfer gütlich an den wohlschmeckenden Früchten. Hatte er seine eigene Jugendzeit vergessen oder unseren ungebremsten Appetit falsch eingeschätzt? Seine Dankesworte jedenfalls fielen recht harsch aus, als er sich die kärgliche Ernte ansah.
Obwohl sich Deutschland zur Zeit meiner Einschulung bereits im vierten Kriegsjahr befand, lebten wir nach meinem Empfinden in Ostpreußen immer noch wie im tiefsten Frieden. Etwas Neues war jedoch hinzugekommen: In der Schule wurde ständig irgendeine Sammlung durchgeführt. Waren es einmal nicht die Kräuter, dann waren es Lumpen oder auch Tierknochen. Ich staunte, was man so alles noch verwerten konnte. Eines Tages, ich ging noch nicht zur Schule, wurden in meines Bruders Klasse und wohl auch in anderen Klassen Knochen gesammelt. Mutter hatte ihm ein Päckchen zusammengestellt, das er aber vergessen hatte mitzunehmen. So beauftragte sie mich, dieses zur Schule zu bringen. Ich machte mich auf den Weg, öffnete die Tür des Klassenzimmers, ging direkt auf den Tisch des Lehrers zu und legte die Knochen dort ab. Dies tat ich – natürlich auf Platt – mit den Worten: »Eck bring dem Fretz sine Knoakes.« (Ich bringe die Knochen von Fritz). Ich verstand nicht, warum die ganze Klasse in fröhliches Gelächter ausbrach.
Im Frühjahr und Frühsommer war die Zeit der Verwandtenbesuche. Mit Pferd und Wagen konnte man zu den meisten Verwandten an einem Tag hin- und zurückfahren – so kurz waren die Entfernungen. Der Höhepunkt des Zusammentreffens bestand jeweils in einer guten und reichhaltigen Mittagsmahlzeit, zu der traditionsgemäß mehrere deftige Bratensorten gehörten. Ja, essen konnte man gut in Ostpreußen! Nach dem Nachtisch gab es ein paar zünftige Schnäpse, die dem Magen wieder auf die Beine halfen. Derart gestärkt besichtigten der Besuch und meine Eltern die Felder und rühmten den Stand des Korns. Nun kam meine Stunde: Ich ging von Platz zu Platz und leerte aus jedem Glas auch noch den letzten Tropfen! Wer weiß, ob ich dadurch ins Torkeln kam oder mich in ostpreußischer Standfestigkeit übte?
Bis zu dieser Zeit erlebte ich eine schöne und unbeschwerte Kindheit in ländlich-bäuerlichem Umfeld. Aber bald sollte sich vieles ändern.
Die jungen Bauern waren bereits zum Krieg eingezogen, so dass auf den meisten Höfen nur noch Frauen und alte Männer wirtschafteten. Da mein Vater handwerklich sehr geschickt war und es allgemein bekannt war, dass er Reparaturen an Landmaschinen, Elektroanlagen, Pumpen usw. ausführen konnte, wurde er zum Ortsbauernführer gewählt und darum uk gestellt. Mit diesem »unabkömmlich« war er vom Wehrdienst befreit mit der Auflage, auch bei den anderen Bauern die Hilfe zu leisten, die den Fortbestand der Landwirtschaft sicherte.
In jener Zeit war es gefährlich, sich kritisch zum Naziregime zu äußern, was mein Vater nicht immer beachtete. Eines Tages wurde er von dem Knecht eines Nachbarn angezeigt mit den Worten: »Der Gitt ist politisch nicht zuverlässig.« Bald darauf erschien ein Beauftragter der Partei zur Überprüfung. Als er auf den Hof kam, begrüßte er meinen Vater mit einem lautstarken »Heil Hitler!« Darauf mein Vater: »Ich bin nicht der Hitler!« – »Da haben wir es ja schon«, stellte der Parteibeauftragte sofort fest. Schon wenige Tage danach wurde die uk-Stellung aufgehoben und der Gestellungsbefehl zur Wehrmacht folgte. Mein Vater kam zu einer kurzen Ausbildung nach Preußisch-Holland in Ostpreußen und wurde danach als Soldat nach Frankreich beordert und an der Atlantikküste bei St. Nazaire zur Küstenbewachung eingesetzt. Nachträglich kann man nur sagen, dass es eine gute Fügung war. In St. Nazaire gab es während des ganzen Krieges keinerlei kriegerische Handlungen, so dass er dort nicht einen einzigen Schuss abgeben musste. Wäre er in Ostpreußen geblieben, hätte er unausweichlich zum Volkssturm gehen müssen, und diese Männer sind fast ausnahmslos gefallen, wie auch mein Onkel Franz, der Mann meiner Tante Lina.