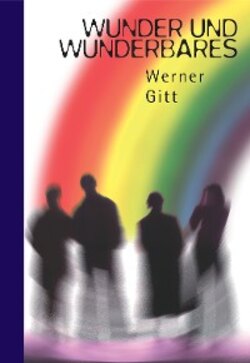Читать книгу Wunder und Wunderbares - Werner Gitt - Страница 57
Flucht vor der Roten Armee
ОглавлениеIm Oktober 1944 rückte die Rote Armee bis an die ostpreußische Grenze vor.5 So mussten auch wir die Flucht ergreifen. Ich war damals sieben Jahre alt und gerade in die zweite Klasse der Dorfschule gekommen. Im Gegensatz zu den anderen Bauern des Dorfes, die gemeinsam mit Pferd und Wagen flüchteten, entschied meine Mutter, zunächst nach Altlinden (12 km westlich von Gumbinnen) aufzubrechen, wo ihre Halbschwester Lina auch einen Bauernhof besaß. Mein bei uns lebender Großvater mütterlicherseits (Friedrich Girod)6 baute einen Erntewagen zum Fluchtwagen um; die leinenen Transportbänder des Selbstbinders (Vorläufer der heutigen Mähdrescher) gestaltete er zu einem Spitzdach. Ich empfand den Aufbruch mit Pferd und Wagen als etwas Abenteuerliches und erkannte keineswegs den Ernst der Lage. Wir fünf – Mutter, Großvater, Bruder Fritz, die Hausangestellte Meta und ich – wohnten dann einige Wochen in Altlinden, bis wir gemeinsam mit den Altlindener Verwandten7 am 20. Oktober mit drei Fuhrwerken erneut aufbrachen. Nach zwei oder drei8 Tagen erreichten wir Gerdauen und warteten dort etwa zehn Tage, in der Hoffnung, es gehe bald wieder zurück. Weil die Rote Armee weiter vorrückte, mussten wir jedoch die Flucht nach Südostpreußen fortsetzen. Anfang November erreichten wir das etwa 180 Kilometer9 entfernte Peterswalde und wurden alle zusammen im Haus der allein stehenden Lehrerin Troyka einquartiert. Dieses 688-Einwohner-Dorf10 liegt 18 Kilometer südlich von Osterode. Hier blieben wir, und ich ging auch wieder zur Schule (mit Frau Troyka als Klassenlehrerin). Aber eigentlich warteten wir nur darauf, dass es wieder nach Hause zurückging. Ich kann mich noch recht gut an das Weihnachtsfest 1944 erinnern. Wir hatten einen Weihnachtsbaum, und es gab reichlich Gänseschenkel zu essen, die aus dem Vorrat von Tante Lina stammten. Die in Weckgläsern eingemachten Fleischvorräte gehörten unbedingt zum Fluchtgepäck. Als bei dem eiligen Aufbruch von Altlinden versehentlich die Gänseschenkel im Rauchfang vergessen wurden, kehrte Rena vom Nachbardorf aus um, um den wichtigen Proviant noch herbeizuschaffen.
Damals war es üblich, dass ein älterer Mann die amtlichen Bekanntmachungen im Dorf ausrief. Mit dem Fahrrad fuhr er jeweils einige Häuser weiter, blieb dann stehen, klingelte mit seiner nicht zu überhörenden Handglocke – daraufhin öffneten die Bewohner die Fenster – und dann rief er sein monotones lang gestrecktes »Amt – li – che Be – kannt – ma – chung!« Von einem Papier verlas er dann das, was den Dorfbewohnern mitzuteilen war. Es war am 22. Januar 194511, das Thermometer war auf etwa 25 bis 30 Grad unter Null gefallen, und diesmal war alles anders. Ungewohnt war seine Eile. Auch seine Meldung war so knapp wie nie zuvor: »Die Russen kommen, rette sich, wer kann!« Nun war die Aufregung groß. Schnell wurden die wenigen Habseligkeiten auf zwei Wagen geladen, die Pferde angespannt, und los ging es in Richtung Deutsch-Eylau nach Westen. Da ich gerade zu der Zeit hohes Fieber hatte, wurde ich einschließlich Federbett auf dem Fuhrwerk verstaut. Ein Wagen wurde von meiner Mutter gelenkt, der andere von meiner Tante. Onkel Franz war Anfang Dezember 1944 zum Volkssturm eingezogen worden und ist, wie fast alle Männer, gefallen.
Wegen der bald verstopften Straßen kamen wir nur sehr langsam voran. Konnten wir die erste Nacht noch in irgendeinem Saal eines Dorfes übernachten, mussten wir an den Folgetagen bei eisiger Kälte die Nächte auf dem nach beiden Seiten offenen Planwagen verbringen. Tante Marie hatte sich in diesen Tagen einen Finger erfroren, der nach etlicher Zeit schwarz wurde und dann schmerzlos von der Hand abfiel.
Ab und zu fielen Granatsplitter auf die Abdeckung unseres Fluchtwagens, die zweifellos tödlich sein konnten. Aber niemand von uns wurde dadurch verletzt. Vor einem etwas größeren Ort wurde der Treck von der Roten Armee gestoppt. Russen gingen von Wagen zu Wagen. Mein Bruder Fritz, damals 15 Jahre alt, wurde heruntergeholt. Was würde mit ihm geschehen? Tiefe Angst befiel uns. Wir waren über Nacht zu Rechtlosen geworden, mit denen man machen konnte, was man wollte. Meine Mutter ging nach einiger Zeit zur russischen Kommandantur, um ihn abzuholen. Man sagte ihr, er komme morgen wieder. Es stimmte nicht – er kam nie wieder. Vielleicht haben sie ihn erschossen, weil sie ihm unterstellten, er sei in der Hitlerjugend gewesen.
Von einem unserer beiden Fuhrwerke wurden uns die Pferde weggenommen. Daher ging es mit nur einem Wagen nach Peterswalde zurück, wo wir am 24. (oder 25.) Januar 1945 wieder eintrafen.12 Wir bezogen das Nachbarhaus von Frau Troyka, ein inzwischen leer stehendes Bauerngehöft. In diesem Dorf und auch schon bei der Fahrt dorthin erwartete uns ein Bild des Grauens und der Verwüstung: Tote Menschen und Pferde lagen am Straßenrand, Häuser waren abgebrannt. Es begann eine schreckliche Zeit, denn der sowjetische Diktator Stalin hatte den Soldaten erlaubt, sieben Tage lang alles zu tun, was sie nur wollten. So waren Raub, Plünderung und Vergewaltigung13 an der Tagesordnung. Am meisten gesucht wurden Uhren und Stiefel. Alle waren von großer Angst erfüllt, wenn ein Russe das Haus betrat.
Als eines Tages wieder ein Russe auftauchte, verlangte er mit wütender Stimme unsere Uhren. Längst besaßen wir keine mehr, und meine Tante sagte es ihm. Darauf reagierte der Russe mit erhobenem Gewehr: »Urr – oder ich schieße!« Ich staune noch heute, wie meine couragierte Tante darauf antwortete: »Dann schießen«. Nun war er überzeugt, dass hier nichts mehr zu holen war, und schoss nicht.
Erst im Februar trat eine gewisse Entspannung ein. Der Hauptteil der Armee war weiter nach Westen gezogen, und es gab jetzt erheblich weniger Russen als zur Zeit des Einmarsches. Eines Tages ging ein Russe durchs Dorf von Haus zu Haus und forderte alle Einwohner auf, zum Dorfplatz zu kommen. Man ahnte nichts Böses, und die meisten folgten der Aufforderung, weil man annahm, jetzt gäbe es etwas zu essen oder es würde angesagt, wie das Leben unter der Besatzung weitergehen wird. Es bildete sich schnell eine lange Schlange, in der sich auch meine Mutter, ihre Schwester Lina, Meta und ich befanden. Rena war schon einige Tage zuvor von russischen Offizieren abgeholt worden, damit sie in deren Quartier für sie kochte. Die vorbeiziehende Schlange bewegte sich auch an diesem Haus vorbei. Plötzlich entdeckten wir Rena mit einem Russen auf der Treppe des Hauses. Renas Mutter, also meine Tante Lina, wurde aus der Schlange herausgeholt und schnell in das Haus gebracht. Renas Bitte an den Russen, auch meine Mutter aus der von bewaffneten Russen bewachten Menschenmenge herauszuholen, wurde abgelehnt mit den Worten: »Eine ist genug!« Nun war klar: Das ganze Vorhaben hatte nichts Gutes zu bedeuten.
Auf dem Dorfplatz angekommen, wurden noch arbeitsfähige Frauen aussortiert. Wir Kinder wurden gewaltsam von unseren Müttern getrennt, auch wenn wir uns noch so fest an sie klammerten. Wie schrecklich war es, als man uns Kindern die Mutter wegnahm. Wir ahnten nicht, dass dies der Tag sein sollte, an dem wir unsere Mütter zum allerletzten Mal sahen. Wenn etwa zehn Kinder beisammen waren, ordnete man willkürlich eine Frau den Kindern zu mit den Worten: »Du Mutter für alle!« Leider wurde meine Mutter nicht einer der Kindergruppen zugeordnet. Mit anderen Frauen, die als arbeitsfähig angesehen wurden, darunter auch Meta, trieb man sie nun zu Fuß in Richtung des nächsten Dorfes. So etwas Schreckliches hatte ich bisher noch nicht erlebt. Man hatte mir in herzloser Weise die Mutter genommen. Was sollte nun werden? Nachdem die Kolonne sich schon weit entfernt hatte, rannte ich laut weinend die Dorfstraße entlang zu meiner Tante.
Obwohl die ganze Aktion gewaltsam geschehen war, hatten wir uns immer noch einen Schimmer an Hoffnung bewahrt. Wir fragten uns, ob die Frauen nur zu einem kurzfristigen Arbeitseinsatz abgeholt worden waren. Täglich schauten wir aus dem Fenster in Richtung Dorfstraße und erwarteten die Rückkehr meiner Mutter.14 Erst nach Wochen schwand diese Hoffnung mehr und mehr, bis sie schließlich endgültig starb. Niemand kam mehr zurück, und so wurde uns klar: Es handelte sich um eine Verschleppung ins entfernte Russland. Erst nach Jahren erfuhren wir von einer Augenzeugin, dass meine Mutter schon im April 1945 in der Ukraine gestorben ist. Sie starb in den Armen dieser Zeugin mit den Worten: »Was wird nur aus meinem kleinen Werner werden?«
Den Sommer 1945 verbrachten wir – meine Tanten Lina und Marie, mein Großvater und ich – immer noch in dem Nachbarhaus von Frau Troyka. Rena war im März von Russen zu dem etwa sechs Kilometer entfernten Gutshof Schmückwalde gebracht worden, der schon zur Kolchose umfunktioniert worden war. Dort musste sie schwere Arbeit in der Mühle verrichten. Mein Großvater baute im Sommer einen zweirädrigen Handwagen mit einer Ladefläche von etwa 2 × 2 Metern. Er hatte die Idee, zu Fuß nach Raineck zurückzugehen (Luftlinie = 160 km). Dazu ist es nie gekommen. Vielmehr wurde der Wagen für einen sehr traurigen Zweck benutzt: Durch das Dorf fuhren regelmäßig vier russische Lkw, die von uns sehr argwöhnisch beobachtet wurden. Als eines Tages ein Vater mit seiner erwachsenen Tochter Kartoffeln aus der Miete (= Kartoffelvorrat, der mit Stroh und Erde abgedeckt war) holen wollten, kamen gerade diese Autos vorbei. Erschrocken rannten die beiden über das freie Feld. Das war ihr Verderben, denn wer weglief, galt als Partisan. Die Wagen stoppten, und ein russischer Fahrer erschoss die Flüchtenden. Opas Wagen wurde nun zum Abtransport der Leichen benutzt. Auffällig war für uns, dass in der Folgezeit nur noch drei Lkw durchs Dorf fuhren.
Ohne es zu ahnen, befand ich mich etwas später mit einem anderen Jungen in ähnlicher Todesgefahr. Wir spielten auf der Dorfstraße. Plötzlich entdeckten wir, wie hinter der Straßenbiegung ein russischer Reiter herannahte. Voller Angst liefen wir, so schnell wir nur konnten, weg, zuerst in Richtung »unseres« Hofes, bogen dann aber doch zum Nachbargehöft ab, krochen mit Mühe unter einen Bretterzaun hindurch und erreichten dann den Friedhof. Hier versteckten wir uns zwischen Gräbern und Büschen und harrten so lange aus, bis uns die Gefahr vorüber schien. Als ich nach Hause kam, berichtete meine Tante, dass der Reiter wütend in das Haus gekommen sei und intensiv nach uns gesucht habe. Hätte er uns gefunden, wären wir als verdächtigte Partisanen wahrscheinlich auch sofort erschossen worden. Ich ahnte nicht, in welcher Todesgefahr ich geschwebt hatte.
Eines anderen Tages blieb ein Lkw vor dem Haus von Frau Troyka stehen, und der Russe eilte in ihr Haus, um nach dem Weg zu fragen. Sie glaubte, er wollte sie vergewaltigen, und schluckte sofort ihre stets griffbereit liegenden Gifttabletten. Da sie nicht sofort starb, versuchte meine Tante sie durch Verabreichung von Brechmitteln zu retten. Sie lehnte jedoch jede Hilfe ab, denn in dieser wirren und hoffnungslosen Zeit wollte sie nicht weiterleben.
In jener Zeit lebten wir von dem, was noch auf dem Hof vorhanden war: Getreide und Kartoffeln. Zum Glück gab es auch Brennmaterial. Da wir jedoch keine Streichhölzer hatten, musste ständig das Feuer erhalten werden. Zu Beginn der Nacht legte man ein Brikett in den Ofen, bis es glühte, tat Asche darauf und entfachte die Glut am anderen Morgen zu neuem Feuer.
Im Laufe des Sommers bekamen wir zusätzliche Mitbewohner auf »unserem« Hof. Eine polnische Frau mit ihren fünf Kindern zog bei uns ein. Sie sprach gut Deutsch, und ich habe sie als freundliche Person in Erinnerung. Auch sie waren Vertriebene, denn sie kamen aus jenem östlichen Teil Polens, der an die Sowjetunion abgetreten worden war. Der südliche Teil Ostpreußens war durch die damit einhergehende Westverschiebung Polens den Polen zugewiesen worden.15