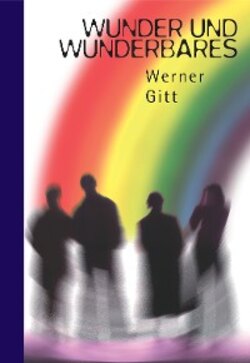Читать книгу Wunder und Wunderbares - Werner Gitt - Страница 63
2.3 Nach fünfzig Jahren wieder in Ostpreußen
ОглавлениеFünfzig Jahre nach der Flucht und Vertreibung waren wir zum ersten Mal wieder in Ostpreußen20, und zwar im nördlichen Teil, in dem auch mein Geburtsort Raineck lag. Zehn Tage hielten wir uns dort auf, um Vorträge zu halten. Gebangt hatten wir uns vor der Abreise gefragt, wie man wohl aufgenommen werden würde in einer Gegend, die so viele Jahre militärisches Sperrgebiet war und in die niemand aus dem Westen einreisen durfte. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte sich auch diese Tür geöffnet.
In den zehn Tagen erlebten wir beides: Negatives und Großartiges. Die Auswirkungen von fast fünfzig Jahren Kommunismus sind verheerend. Die Städte und Dörfer in einem einstmals schönen Land sind völlig zerstört. Den Menschen erging es nicht besser; sie lebten weitgehend ohne Hoffnung und Ziel. Karl Marx hatte einmal gesagt: »Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit.« Zumindest mit diesem Satz hat er Recht. Wer Anschauungsunterricht über die praktischen Auswirkungen des Kommunismus sucht, der findet dort genug Beispiele. Wie würden diese Menschen, die jetzt hier wohnen, auf das Evangelium reagieren? Unser erstes Ziel war Palmnicken.
1. Palmnicken: Palmnicken ist ein ehemals wunderschöner Kurort an der Samland-Küste der Ostsee, weltbekannt durch seine reichen Bernsteinvorkommen. Auf Russisch heißt Bernstein »jantar«, und davon ist auch der heutige Ortsname abgeleitet. 94 % der Weltbernsteinproduktion kommt von hier. Wir kamen am Samstag gegen Mittag an. Ursprünglich hieß es, wir seien zu einer Bibelstunde eingeladen, und ich hatte mir einen kleinen Hauskreis vorgestellt. Wer nach Russland reist, um zu evangelisieren, muss wissen, dass er immer wieder mit Desorganisation konfrontiert wird. So erging es uns auch in Jantarny. Als wir dort ankamen, hatte es den Anschein, als ob uns niemand erwartete. Es war ein schöner sonniger Tag, und wir vertrieben uns die Zeit auf dem Rasenplatz vor dem Kino. Zunächst geschah nichts, bis nach und nach einige Leute aus dem Dorf auftauchten: erst vereinzelte, dann mehrere, schließlich waren es etwa fünfzig. Sie gingen alle zielstrebig in den Kinosaal. Ob da wohl gleich ein Film lief? Neugierig gingen wir hinein. Kurz danach wurde uns klar, dass wir uns in unserer eigenen Veranstaltung befanden. Einen Verantwortlichen konnten wir immer noch nicht ausmachen, aber die Leute schienen etwas Besonderes zu erwarten. Es war ein bunt zusammengewürfeltes Völkchen. Die meisten von ihnen schienen uns ungläubig zu sein. Nach Absprache mit Harry erkannten wir: Das Gebot der Stunde heißt Evangelisation. Es war also nicht eine Bibelstunde für Gläubige, wie wir ursprünglich angenommen hatten. Wer nach Russland geht, muss oft blitzschnell reagieren, umdisponieren, Gedanken umschalten, Planungen umwerfen. Kurz entschlossen trugen wir eine verständliche evangelistische Botschaft vor. Das Erstaunliche: Von den fünfzig Leuten bekehrten sich am Ende zwanzig zu Jesus. Das war für uns ein großes Wunder.
Der Königsberger Dom, 1998.
2. Palast der Eisenbahner: Das eigentliche Ziel unserer Reise war jedoch die Evangelisationswoche in der Stadt Königsberg (russ. Kaliningrad). Die einstige ostpreußische Metropole und auch die anderen Orte sind geradezu vollständig russifiziert. Es ist kaum noch eine deutsche Spur zu finden, und wo es an Gebäuden aus deutscher Zeit Inschriften gab, hat man diese beseitigt. Hier also sollten die Veranstaltungen stattfinden. Wir waren schon sehr darauf gespannt.
Der Palast der Eisenbahner, ein Gewerkschaftshaus in der Nähe des früheren Südbahnhofs, war der Vortragsplatz. Als wir am ersten Abend erst kurz vor Beginn am Veranstaltungsort ankamen, enttäuschte uns der fast leere große Parkplatz. Ob niemand kommen würde? Würden wir in einem Saal zu leeren Stühlen predigen? Doch dann waren wir überrascht über die große Menschenmenge, die drinnen schon Platz genommen hatte. Fast alle waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen oder hatten einen langen Fußmarsch hinter sich. Nach der Predigt luden wir all jene ein, auf die Bühne zu kommen, die sich an diesem Abend für Jesus Christus entscheiden wollten. Jeden Abend war es eine stattliche Gruppe, die sich da einfand, so dass Harry und ich uns auf eine Bank stellen mussten, um von allen gut gesehen und verstanden zu werden.
Etwas Unvergessliches erlebten wir am letzten Abend: Wir baten alle diejenigen, die sich in den vergangenen Tagen für den Glauben entschieden hatten, einmal auf die Bühne zu kommen. Es war bewegend: Erst kamen einige, dann mehr und mehr, so lange, bis die Bühne bis hinten hin überfüllt war. Viele hatten Tränen in den Augen, weil sie von der Verlorenheit zum ewigen Leben durchgebrochen waren.
Wir erlebten eine Art des Dankens, wie wir sie hierzulande gar nicht kennen. So bekamen wir z. B. einen Rosenstrauß geschenkt. Eine Kostbarkeit, wenn man bedenkt, dass eine Rose umgerechnet 2,50 Euro (damals 5 DM) kostete. Und drei Rosen, das entsprach 7,50 Euro oder 15 000 Rubel (nach damaligem Kurs). Das waren immerhin etwa zehn Prozent eines durchschnittlichen Monatsgehalts! Andere wiederum brachten mit selbst verfassten Gedichten, die sie auf der Bühne vortrugen, ihren Dank gegenüber Gott zum Ausdruck. Sie freuten sich, dass sie in diesen Tagen Jesus als ihren Retter gefunden hatten. Das alles hat uns tief beeindruckt, und wir waren froh, diese Reise unternommen zu haben.
3. Universität: In den folgenden Tagen waren auch einige Vorträge an der Universität Königsberg angesetzt. Nach einem Vortrag am Mathematischen Institut stand ein Professor während der Diskussion auf und sagte: »Sie haben uns heute viel fachlich Interessantes gesagt, aber was Sie über Gott gesagt haben, das hat mich noch viel stärker beeindruckt.« Ich weiß nicht, ob wir uns eine vergleichbare Situation an einer deutschen Hochschule vorstellen können: Ein Professor steht vor versammeltem Auditorium auf – vor Studenten, Assistenten und Kollegen – und bekundet sein größeres Interesse an Glaubens- denn an Fachfragen. Übrigens: In dem Hörsaal hing ein großes Porträt von einem der bedeutendsten deutschen Mathematiker, David Hilbert21 (1862-1943). Darunter stand in großer deutscher Antiqua-Schrift sein viel zitierter Satz »Wir müssen wissen. Wir werden wissen.«
Hinweis: Später waren wir noch dreimal im nördlichen Ostpreußen und haben immer wieder – wie auch die noch folgenden Einzelberichte zeigen – Gottes gnädiges Handeln erfahren. Diese überwältigende Aufgeschlossenheit gegenüber dem Evangelium haben wir bei den Folgereisen allerdings nicht mehr so erlebt.