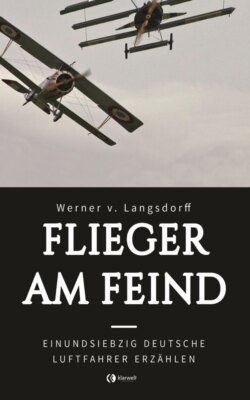Читать книгу Flieger am Feind - Werner von Langsdorff - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aus dem Tagebuch eines Bombenfliegers - Von Georg Wulf
Оглавление8. Juni 1916: Der erste Film ist heute abgelaufen. Vorläufig ist’s auch der letzte. Was ich heute erlebt habe, werde ich nie vergessen. Wir hatten als Ziel photographische Aufklärung weit hinter der Front. Nachdem wir uns auf dreitausendachthundert Meter geschraubt hatten, flogen wir bei Ostende aufs Meer hinaus. Ein prachtvolles Bild bot sich uns: Das Meer selbst und die darauf manövrierenden Kriegsschiffe! Wir hatten mit sturmartigem Wind zu kämpfen und kamen nur langsam voran. Endlich waren wir nicht mehr weit von Dünkirchen. Unter uns sahen wir wieder Kriegsschiffe (Panzerkreuzer), aber französische oder englische.
Wir flogen nun ins Land hinein, unserem eigentlichen Ziele zu, das wir auch erreichten, und wir lösten unsere Aufgabe. Wir waren schon ein Stück zurück, als ich plötzlich eine feindliche Maschine unter mir sah. Der Gegner hielt sich immer genau unter uns, und wir kamen kaum zum Schuss, während er dauernd zu uns heraufschoss. Ich sah ihn überhaupt nicht und versuchte durch Kurven und schnelle Richtungsänderung aus der gefährlichen Lage zu kommen. Ob ich nun zu sehr auf den Gegner geachtet habe, ob die Windverhältnisse schuld haben, weiß ich nicht; genug, es ereignete sich zum ersten Mal im Lauf meiner Militärfliegerei, dass ich regelrecht abgerutscht bin. (Der L. V. G.-Maschinentyp neigt sehr dazu.) Die Maschine rutschte also über einen Flügel, stellte sich Kopf und begann, sich rasend zu drehen. Die normale Steuerbewegung machte die Sache nur schlimmer. Ich stellte den Motor ab, fühlte mit den Steuern und fand, dass die Maschine auf die verrückteste Bewegung reagierte, nämlich auf die, die das Flugzeug im Normalflug gekippt hätte. So gelang es mir, die Maschine zu fangen. Vierhundert Meter waren wir gestürzt, aber kaum hatten wir uns erholt, da kam plötzlich ein kleiner Kampfdoppeldecker und griff uns von unten an. Wir hatten ihn nicht bemerkt; so kamen wir kaum zum Schuss. Plötzlich gab mir mein Beobachter ein verabredetes Zeichen, das so viel heißt, wie kampfunfähig (Ladehemmung usw.). Nun musste ich machen, dass ich heimkam. Mit einem großen Luftsprung entzog ich mich dem Feuer des Gegners und war glücklich hinter unseren Linien. Als ich dann einen Augenblick nach meinem kleinen Hamburger sah, war er völlig in sich zusammengesunken. Im ersten Augenblick dachte ich, er sei tot, aber auf Anruf sagte er mir, er sei verletzt. Als ich landete, war er bei Besinnung; er hatte einen starken Streifschuss über der rechten Schläfe. Im Lazarett verbunden, ist er aber ganz selbständig nach Hause gegangen. — Nun wird er wohl auf Urlaub fahren und das Eiserne Kreuz 1. Kl., das er sowieso haben sollte, bekommen, und ich habe für längere Zeit meinen besten Kameraden nicht. Das ist das Ende des Films, aber die Bilder sind gut und der Zweck ist erreicht.
24. Juli 1916: In der Nacht vom 20. zum 2l. machten wir Nachtflug. Der Flug war darum schon interessant, weil man sich ziemlich orientieren musste. Unterwegs suchten uns viele Scheinwerfer, aber unbeirrt flogen wir unserem Ziele zu: einem großen Depot mit Munitionsfabrik der Engländer für die große Offensive bei Audruicq. Es soll alles (drei Uhr nachts) hell erleuchtet gewesen sein; als ich, als letzte Maschine, eintraf, war alles finster, nur Scheinwerfer und eine Abwehrbatterie tobten. Je mehr Bomben kamen, desto nervöser wurden sie. Als wir etwa zehn Minuten weg waren, fing es in den Anlagen an zu brennen und nach geraumer Zeit war ein Riesenbrand ausgebrochen, den wir noch sahen, als wir (achtzig Kilometer davon) niedrig über unserem Platze schwebten. Ab und zu schoss eine riesige Stichflamme empor, was auf explodierende Stoffe schließen lässt. Am anderen Tag haben andere Flieger noch riesige Rauchwolken aufsteigen sehen. Mein Beobachter hatte also mit glücklicher Hand die zündende Brandbombe geworfen. Der Rückflug dauerte endlos lang, weil wir starken Gegenwind hatten. Plötzlich bemerkten wir nördlich Lichter und stellten fest, dass ein feindlicher Flugplatz Nachtbetrieb machte. Da wir noch eine Bombe hatten, haben wir auch ihn bedacht. Die Signalfeuer gingen, ob des unerwarteten Besuchs ziemlich plötzlich aus. — Als wir daheim ankamen, herrschte große Aufregung. Man vermisste uns schon, und außerdem war starker Bodennebel aufgetreten, dem zum Trotz ich die Maschine aber glatt landete. Unser Heeresbericht sagt zwar nichts über den Flug und die Engländer sagen auch nichts, aber ich hoffe, dass mal bei den Neutralen was durchsickert.
Die Hauptsache ist, dass der Zweck erreicht wurde. Am selben Tage habe ich noch einen photographischen Flug gemacht, der auch ein gutes Resultat zeitigte. (Nach Angabe des Mitglieds des britischen Parlaments King handelte es sich hier um die größte Explosion, von der man bis dahin je gehört hatte. Der Verlust an Munition wurde von ihm auf fünfundzwanzig Millionen Dollar geschätzt)
8. August 1916: Wir flogen am Sonntagnachmittag los, um am Yserkanal zu fotografieren, und zwar wollten wir diesseits bleiben, also eine gar nicht so gefährliche Sache. Ich hatte meinen kleinen Hamburger Leutnant Müller an Bord und das Fotografieren ging schnell. Als wir etwa noch zwei Ausnahmen zu machen hatten, kam ein kleiner Doppeldecker jenseits des Kanals herangeflogen. Da er aber noch weit und höher war als wir, habe ich ihn gar nicht beachtet, sondern nahm nach der letzten Aufnahme einfach Richtung „Heimat“. Die feindlichen Flieger müssen dann aus großer Entfernung geschossen haben, jedenfalls waren sie weit weg, als ich mich nach dem Schuss umsah. — Ich saß also ganz ahnungslos da und wollte gerade zum Gleitflug abstellen, als ich plötzlich eine etwas riesenhafte Backpfeife erhielt. Ich hatte gar nicht das Empfinden eines Schusses, sondern dachte eher an ein Sprengstück oder an eine Explosion in der Maschine. Der Unterkiefer stand mir ganz schief. Ich konnte ihn nicht bewegen und kam mir ganz sonderbar vor. Als ich aber einen Blick auf den Spiegel warf, sah ich, dass ich ganz voll Blut war und im selben Moment kam mir auch etwas Blut in die Luftröhre, so dass ich Blut spucken musste. Mein Beobachter war sehr besorgt, dass wir stürzen würden, und redete mir dauernd Mut zu. Ich behielt aber die Besinnung und habe die Maschine aus der großen Höhe gut bis zum Platz gebracht und gelandet. Ein Auto steht immer bereit. Ich sprang schnell hinein und war nach einer Minute im Lazarett. Hier werde ich nun sehr liebevoll behandelt — ein Flieger ist ja auch nichts Alltägliches. Ich sitze augenblicklich im Garten, schreibe und lasse mich von der Sonne bescheinen. Die Wunden sind zu, feste Nahrung kann ich natürlich noch nicht nehmen; außerdem habe ich ein Gesicht wie ein Bratapfel, so dick! (Schuss durch beide Backen ohne Verletzung von Kiefer oder Zähnen.)
12. Oktober 1916: In der Nacht vom 10. zum 11. gegen zwei Uhr habe ich meinen ersten Nachtflug an der Somme gemacht. Es war Vollmond und verhältnismäßig klar, aber windig. Am Abend hatte ich meine Maschine noch mal geflogen und dann mit hundertsiebzig Kilogramm Bomben fertigmachen lassen. Um zwölfeinhalb Uhr nachts wurden wir geweckt und bald darauf rollte ich auch schon an den Start. Schnell noch alles einmal geprüft und dann mit „Vollgas“ nach langer Zeit zum ersten Mal wieder gegen den Feind! Die Orientierung ist sehr leicht. Quer durch das Gebiet der Sommeschlacht zieht sich eine alte Römerstraße, die schnurgerade verläuft. Durch ihre Geradheit ist sie auffällig und daher unser ständiges Merkmal. An dieser Straße haben wir uns außerdem noch ein paar Signale aufgestellt, so dass wir immer heimfinden. Diese Signale haben die feindlichen Flieger, die unseren Landeplatz vergeblich suchten, zu unserem Gaudium lebhaft bombardiert. Anscheinend dachten sie, es gäbe da wohl was zu treffen. Die schönste Munitionsverschwendung! Unsere Abteilung hat, sogar in den finsteren Nächten, schon einige tausend Kilogramm Bomben hinübergeschleppt und hat sicher auch was angerichtet. Wenn sie uns also entdecken, können wir uns auf einen netten Bombensegen gefasst machen; na, dann ziehen wir eben einfach um! Wir haben aber auch vorgesorgt. Bei Tage kommen sie hier nicht ganz her und bei Nacht machen wir nur in dem Augenblick Licht, wo ein Flugzeug landet. — Als ich also noch nicht lange unterwegs war, sah ich schon die Signale. Meine Maschine stieg trotz der Last prächtig. Wir hatten aber starken Gegenwind und kamen nur langsam voran. Die Front war leicht zu erkennen an dem Geschützfeuer, das in dem Augenblick allerdings gering war. Es ging dann über die berühmte Somme hinweg, die sich wie eine schwarze Schlange tief unten krümmte. Plötzlich tauchte vor mir ein Licht auf, dann zwei, drei, vier usw. bis zwanzig Stück, alle in einer Reihe, wie ein Strich wilder Enten. Wir nennen das die „fliegende Wurst“. Das sind Brandgeschosse aus einer Revolverkanone. Sie sehen sehr hübsch aus, sind aber unangenehm, besonders, weil es deutsche sind. Wir gaben Signal und die Schießerei hörte auf. Nun ging es ins feindliche Gebiet. Scheinwerfer waren bei der Arbeit, und als wir unserem Ziele näher kamen, tauchten plötzlich ringsumher, wie Glühwürmchen herumirrend, lauter leuchtende Punkte auf. Es waren Abwehrbrandgeschosse, die in großen Mengen da herumflitzten. Sie kümmerten uns aber wenig und wir gingen herunter bis schließlich auf sechshundert Meter und warfen in aller Ruhe unsere Bomben ab. — Mein Beobachter behauptet, von fünfzehn Bomben zehn Treffer gehabt zu haben. — Das wäre ein gutes Resultat! — Wir machten dann kehrt, und nun ging es mit dem Winde in unheimlichem Tempo nach Hause; und nach insgesamt eineinhalb Stunden Flug waren wir glücklich wieder auf der Erde. Ein feindliches Flugzeug sahen wir auch gespensterhaft im Mondlicht herumschleichen; es suchte uns anscheinend. Wir drehten einfach ab und flogen ungesehen weiter.
22. März 1917: Zufällig war unser Oberleutnant (mein Beobachter) draußen gewesen und hatte gesehen, dass es wunderbar sternenklar war. Wir beschlossen, sofort zu fliegen; mit der einen Maschine, die zurzeit noch für Nachtflug intakt war, flogen wir eine Stunde später los. Es war eine richtige „rabenschwarze“ mondlose Nacht, nur die Sterne sah man und vom Boden die Lichter. An der Aisne tobte wütender Artilleriekampf. Schaurigschön sahen die Abschüsse und Einschläge aus. An vielen Stellen brannte es und taghell erleuchteten die Signalraketen das Sturmgelände. Es war einem ordentlich gut zumute, dass man denen da unten helfen konnte trotz der finsteren Nacht, in der man kaum wusste, was oben oder unten war.
Meine Maschine hat brav ausgehalten; der Motor sang recht schön gleichmäßig. Drüben hatte man nicht mit Fliegerangriff gerechnet. Alle Lager waren hell erleuchtet. Das erste beste griffen wir an; die Bomben raus und kehrt! Kaum hatte ich gedreht, als meine Maschine taghell etwa fünf bis sechs Sekunden beleuchtet wurde. Wir hatten Glück gehabt. Ein Munitionslager weniger! Eine Explosion folgte nun der anderen; Stapel auf Stapel ging in die Luft. Als ich das sah, dachte ich: „Wenn du nun bei der Landung Bruch machst, so schadet das nichts, das ist der Erfolg wohl wert!“ Das Bewusstsein, gerade da dem Feinde schwer zu schaden, wo er jede Granate für seine Offensive nötig hat, ist wirklich schön. Es werden schon einige Munitionszüge nötig sein, um das Loch, das wir gerissen haben, wieder zu füllen. Die Landung verlief trotz der ungünstigen Verhältnisse gut. Um zwei Uhr dreißig Minuten kam ich ins Bett.
27. März 1917: Diese Nacht wird es wohl wieder einen kleinen Film geben. Es ist klar und sogar der Mond zeigt sich wieder. Das Munitionslager ist doch größer gewesen, als wir erst glaubten. Artilleriebeobachtungsstellen an der Front haben gemeldet, dass sie noch nach zweieinhalb Stunden Explosionen wahrgenommen haben. Der Erfolg wird natürlich, da er bestätigt ist, in meinen Personalpapieren „gebucht“. Hoffentlich habe ich noch mehr solch Glück! Im Allgemeinen ist die Lage an der Front und in der Heimat wieder gut. Das beruhigt sehr. —
Gestern Abend musste ich wieder unterbrechen, da Nachtflugwetter war. Fast wäre ich wieder bei „Joffre“ geblieben. Mein Motor setzte mordsmäßig aus. Mit vier Zylindern (zwei versagten) bin ich, stetig fallend, noch gerade nach Hause gekommen. Wieder mal unglaubliches Glück! Der Motor fliegt jetzt aber raus aus der Maschine.
2. Februar 1918: Gewiss könnte ich meine Flüge etwas einschränken, wo ich technischer Offizier der Abteilung geworden bin, aber ich bin nun mal an der Front und fühle mich wieder fähig zu tatkräftigem Wirken, da leiste ich auch mein Teil. Ohne Selbstüberhebung kann ich sagen, wenn alle so dächten und handelten wie ich, dann könnte es wohl heißen: Lieb Vaterland, magst ruhig sein! Diese Nacht scheint es wieder schwere Arbeit zu geben, die Sterne leuchten so klar und hell! Bei den letzten Malen schoss der Engländer tüchtig. Er soll Hörapparate haben, mit denen er Richtung und Höhe des Flugzeuges feststellen kann. Er schoss aber meistens zu hoch. Ich bin dabei, an meinen Motoren Schalldämpfer anzubringen; vielleicht geht er auf den Leim. Bei einem der letzten Frontflüge flog unser Kommandeur bei mir als Gast mit; morgen muss ich ihn von Brüssel abholen, wohin er geflogen war und Bruch gemacht hatte. Ich habe also schon ohne die technische Arbeit fliegerisch genug zu tun.
10. März 1918: Am 8. März hieß es fliegen und nochmals fliegen, und in der Nacht ging es nach Paris! Es ist ein eigenartiges Gefühl zu sagen: Ich war über Paris! Es war völlig finstere Nacht, als wir starteten, nur die Sterne leuchteten zu der schweren Arbeit. Vorher sah das Wetter ziemlich schlecht aus, und alles war übler Stimmung, weil wir dauernd alarmbereit dasitzen mussten; und ich war heilfroh, als der Startbefehl kam. Als wir glücklich mit der schwerbeladenen Maschine „abgedampft“ waren und in der Luft hingen, war das Schwerste überwunden. Am Boden war nichts zu sehen, wonach man sich hätte orientieren können, so ging es denn freiweg nach dem Kompass in die Geographie hinein. Kurz hinter der Front kamen wir an die Scheinwerfersperre der Franzosen. Sie waren aber so dumm, dass es ein leichtes war, hindurchzukommen. Bei Soissons setzte man uns zufällig eine Granate vor die Maschine, doch störte uns das weiter nicht, weil sie uns nichts tat. Um zwölfeinhalb Uhr hatten wir die Scheinwerfer- und Granatensperre um Paris durchbrochen und wenige Minuten darauf gingen unsere schweren Grüße zu den sicherlich entsetzten Parisern, die wohl nicht geglaubt hatten, dass sie in solch finsterer Nacht Besuch bekämen. Der Angriff war von ungeheurer Wucht. Jedenfalls hat der Angriff den beabsichtigten Erfolg gehabt, unsere Städte vor feindlichen Angriffen zu schützen, denn heute, wo wir ein zweites Mal hinfliegen wollten, kam kurz vor dem Start das Verbot. Anscheinend haben die Franzosen die Zusicherung gegeben, nur noch militärische Anlagen angreifen zu wollen. Der Rückflug war sehr angenehm; die Landung verlief glatt. Nach fast dreistündigem Flug waren wir im Heimathafen. Ich hatte am Tage noch zwei Flüge gemacht und habe somit kurz hintereinander in fünf Stunden fünfhundert Kilometer hinter mich gebracht. Das ist eine gute Leistung. Gestern war ich dafür aber auch so müde, dass ich gar nichts unternehmen konnte. Man kam von einem Tran in den anderen; dafür habe ich nun aber elf Stunden geschlafen und ich war heute sehr munter. 23. März 1918: Seit drei Tagen will ich schreiben und erst heute komme ich dazu, wo ich meine Knochen endlich wieder so einigermaßen beieinander habe. Ich komme mir vor, als wäre ich mordsmäßig verhauen worden! Überall Flecke und Beulen. Es war in der Nacht, die dem Beginn der Offensive folgte. Wenn irgend möglich, sollte nach einem wichtigen Ziel geflogen werden, das ich schon während der Sommeoffensive wohl zehnmal bombardiert habe. Es war dunstiges Wetter und dünne Wolken zogen am Monde vorbei, aber wir waren draufgängerisch gesinnt durch die ersten Nachrichten von dem Gelingen des großen Kampfes und um achteinhalb Uhr „sockten“ wir los und noch drei Maschinen hinter uns her. Die letzte von den dreien hatte Defekt, musste umkehren und hielt dadurch zum Glück den Start des übrigen Geschwaders so auf, dass man die Anfänge des Nebels bemerken konnte, und nach einer Viertelstunde war alles in dichte Schleier eingehüllt. Währenddessen flogen wir ahnungslos unter sternenhellem Himmel zum Ziel. Die weiße Decke unter uns hielten wir für Wolken. Diese nahmen aber gar kein Ende. Allmählich wurde die Sache „spanisch“ und wir warfen die Bomben dort ab, wo wir nach Kompass und Zeit das Ziel vermuteten. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde heimwärts geflogen waren, wollten wir durch die vermeintlichen Wolken stoßen, um uns zu orientieren. Ich ging im Gleitflug herunter und beobachtete den Höhenmesser: 2000 — 1500 — 1000 800 500 300 Nun? Immer noch nicht in Wolkenhöhe? Jetzt tauchen wir endlich ein und schwarze Finsternis, umgibt uns. Wie ein Blitz zuckt es durch uns alle: Nebel! Unser schlimmster Feind, der uns blind macht und täuscht und mit der Maschine Fangball spielt. Vollgas! Höhensteuer! Nur noch nach den Instrumenten gesehen, und in wenigen Sekunden sind wir wieder über der fürchterlichen Decke. Was nun? Wir haben noch für eineinhalb Stunden Betriebsstoff, wir können nicht länger hier oben bleiben. Wo ist der Hafen? Wir fliegen einen Kreis und halten Umschau. Da, dort steigen zwei Leuchtkugeln! Das ist unser Richtungsgeschütz an der Front! Dorthin gedreht, von dort aus wird nach dem Kompass nach Hause geflogen. — Wir sind richtig. Durch den Nebel sehen wir, wie milchige Flecke, auf vierhundert bis fünfhundert Meter unsere vieltausendkerzigen Richtungslichter, die wir sonst auf dreißig bis vierzig Kilometer Entfernung sehen, und nun finden wir den Platz. Fortwährend steigen Leuchtbomben durch die Nebeldecke zu uns herauf. Man hört uns unten ja ganz deutlich! Ganz trübe leuchten die starken Scheinwerfer. Senkrecht kann man wohl durch den Nebel sehen, aber wenn man darin ist, sieht man nichts mehr. Niemand kann sich das vorstellen, der es nicht erlebt hat. Wir wussten es ja, aber wir hatten doch Vertrauen auf unser Glück. — Ich kreiste zweimal, richtete genau ein und stellte ab. Wenige Sekunden später tauchten wir wieder ein in die schaurige Finsternis. Nichts war mehr zu sehen. Kein Lichtschein, kein Boden, nichts! Ich blickte auf den Höhenmesser. Nur der konnte mir sagen, wann der Boden kam. Erfahrungsgemäß hängt der Höhenmesser beim Gleitflug nach. Ich schätzte auf etwa hundert Meter, das heißt, er zeigt auf hundert Meter, wenn man schon unten am Boden ist.
Ich achtete nun genau darauf, wie der Zeiger fiel: 300 Meter — 250 —— 200, da ein donnerähnlicher Krach, ein Bersten und Splittern — ich konnte nur noch denken: Nun ist der Boden doch schon da — dann einen kurzen Augenblick Besinnungslosigkeit, um mit dem Gefühl zu erwachen, völlig gefesselt zu sein von den Trümmern. Überall hielt es mich fest. An den Knien, quer über der Brust, im Genick, am Kopf, an den Armen. Plötzlich ein Lichtschein (es war nur meine Taschenlampe, die anging) — mein erster Gedanke ist: Feuer! Eine wilde Angst vor dem Verbrennen steigt in mir auf. Eine gewaltige Anstrengung, und die Arme sind frei; dann nur noch wenige Sekunden und ich rutsche aus den Trümmern heraus.
| Heinrich Ellerkamm | Richard Euringer |
| Georg Wulf | Eduard Ritter v. Schleich |
| Horst Merz | Friedrich Knevels |
| Rudolf Berthold | Erwin Böhme |
Ich kann mich erst mal einen Augenblick besinnen, da fällt mir ein, ich habe ja noch drei Mann mitgehabt. Wo sind sie? Ich tappe im finsteren Nebel herum und finde endlich den Oberleutnant, der gerade zum Bewusstsein kommt. Nun kommen auch unsere Mannschaften, um zu retten. Den Hauptmann und den Maschinengewehrschützen haben sie auch schon gefunden. Sie liegen 15 Meter weit von den Trümmern. Der Hauptmann hat ein Bein gebrochen, ist aber ganz munter. Na, wenn alles lebt, dann geht es ja. Nun schnell zum Aufenthaltsraum, zum Arzt. Dort angekommen, finden wir noch mehr Blessierte.
Die andern beiden Maschinen sind auch in die Erde gerannt, aber auch hier sind alle mit Schrammen und Beulen, nur ein Kieferbruch, davongekommen. Ich hatte nebenbei eine leichte Gehirnerschütterung. Ins Auto und ins Bett! Wie ich so da lag, kam mir erst so recht zum Bewusstsein, was ich hinter mir hatte. Aber ich dachte nicht lange darüber nach. Ich hatte genug zu tun, den Kopf zu kühlen, um die Schmerzen zu bannen, dann schlief ich ein. Als ich am anderen Tag aufwachte, fühlte ich aber meine Knochen. Alles tat weh. Arme und Beine, Genick und Kreuz, Kopf und Brust. Selbst das Atmen sehmerzte. Im Bett konnte ich auch nicht liegen. Da bin ich denn aufgestanden, habe erst meine Leidensgenossen besucht, die vielen Glückwünsche entgegengenommen und dann habe ich mir den Bruch besehen und Abschied genommen Von der treuen, braven Maschine, die mich zweimal sogar nach Paris getragen hatte! Wüst sah sie aus. Mein dicker Schal, hat mir das Genick gerettet; ich saß mit Kopf und Hals zwischen zwei dicken Stahlrohren. Wäre der Schal als weiches Polster nicht gewesen, dann konnte es leicht schief gehen. — Allmählich komme ich nun wieder in Gang. Meine neue Maschine ist im Anrollen und in acht bis vierzehn Tagen geht es wieder los. Eine Vorrichtung, um im Nebel landen zu können, habe ich auch schon im Bau, dann ist alles in Ordnung. — Inzwischen ist die Offensive im Gange und die Engländer laufen. Dreitausend Gefangene und sechshundert Geschütze — ein schöner Anfang. Wenn es nur so weiter geht.
10. Juli 1918: Nun bleibe ich selbstverständlich bei der Staffel; wäre auch schon dabei geblieben, als ich den Kommandeur kennenlernte. Er ist der Sohn des Admirals von Schröder und ein ausgezeichneter Mensch.
War schon als Friedensbeobachter mal in Bremen; damals saß ich gerade bei einem deutschen Klassenaufsatz, als seine Taube über die Stadt wegbrummte. Ich hatte natürlich keine Ruhe mehr, beendete in kürzester Zeit (auf der Oberrealschule konnte man nach Beendigung der Arbeit nach Hause gehen), nämlich in zwei Stunden, den Aufsatz (für den ich später „gut“ bekam) und fuhr dann auf dem Rade ins Neuenlander Feld.
Als ich dem Hauptmann neulich diese Geschichte erzählte, freute er sich sehr. Ich habe bei ihm überhaupt eine große „Nummer“; er hat mit mir eine ganze Anzahl Feindflüge, auch Überlandflüge gemacht.
23. Juli 1918: Morgen oder übermorgen muss nun auch wohl mein Ritterkreuz eintreffen; bin ganz gespannt darauf. Man sagte mir, dass es wunderschön gearbeitet sei, und ich muss wohl sagen, ich freue mich erst richtig, wenn ich den Orden selbst in Händen habe.
Vom Kommandeur bekam ich noch, als er mir die Verleihung mitteilte, ein dickes Lob (er selbst hat übrigens den Hohenzollern noch nicht, da ist es sehr anständig, dass er mich ohne weiteres eingereicht hat).