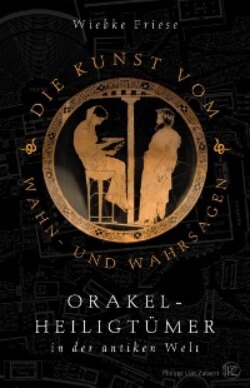Читать книгу Die Kunst vom Wahn- und Wahrsagen - Wiebke Friese - Страница 16
Zwischen Wahn und Wahrsagen
ОглавлениеWie glaubhaft ist aber die religiöse Trance der Pythia? War etwa alles nur gespielt, um den Klienten zu beeindrucken? In Ekstase weissagende Medien gab es bereits in der babylonischen Kultur, doch waren ihre Weissagungen im Gegensatz zu den bewusst herbeigerufenen Zuständen der delphischen Priesterin eher zufällig. Zudem waren sie gesellschaftlich längst nicht so anerkannt. Auch für die minoische und mykenische Welt existieren bis heute keine stichhaltigen Beweise für eine zu dieser Zeit praktizierte inspirierte Mantik. Und auch nicht die homerischen Seher, wie Kalchas oder Mopsos, oder die weissagende Apollonpriesterin Cassandra in der Ilias können als ekstatisch oder besessen bezeichnet werden.
Den Zustand, den man in der heutigen Religionswissenschaft als spirituelle Besessenheit bezeichnet, nannte man im antiken Griechenland éntheoi (einen Gott im Inneren haben) oder kátochoi (von einem übernatürlichen Geist gehalten werden). Im 5. Jh. v. Chr. beschrieb Platon in seinem Werk Phaedrus die beiden Begriffe manike (göttliche Besessenheit) und mantike (Weissagekunst) als zwei identische Bezeichnungen für ein und dasselbe Phänomen, zu denen er schließlich auch die poetische Inspiration zählt (Plat. Phae. 244–245). Die Resultate dieser drei ekstatischen Zustände waren zwar grundlegend unterschiedlich (Krankheit, Orakel und Dichtkunst), doch hätten alle denselben Ursprung – den Kontakt eines Individuums mit dem Gott Apollon. Platon beschreibt weiter, dass prinzipiell jeder Mensch bzw. dessen Seele eine gewisse mantische Fähigkeit besäße, die gewisser äußerer bzw. übernatürlicher Umstände bedürfe, um sie zur vollen Entfaltung zu bringen. Die mantische Fähigkeit sei demnach ein Geschenk der Götter, das zwar theoretisch jeder nutzen könne, tatsächlich aber nur bestimmte Menschen träfe. Diese Auserwählten waren im wahrsten Sinne des Wortes „besessen“: Sie agierten nicht mehr durch den eigenen Willen, sondern als Werkzeug des Gottes.
Auch in vielen modernen Kulturen und Glaubensrichtungen ist die inspirierte Mantik immer noch verbreitet. Spätestens seit der Definition des Religionsphilosophen Mircea Eliade (1964), zählt man sie heute zu dem – im Gegensatz zur Antike nicht immer ernst genommenen – Oberbegriff des Schamanismus. Erstmals für die Medizinmänner in Sibirien und Nordamerika formuliert, übernahm Eliade die Bezeichnung für alle religiösen Techniken und Ritualen, bei denen sich eine bestimmte Person in Trance oder Ekstase befindet. Im brasilianischen Candomblékult etwa kleiden sich die filho de santo (Eingeweihten) an bestimmten Feiertagen festlich ein, um dann in einem gemeinschaftlichen Tanz die Ankunft der Orixás (Götterboten) zu erwarten. Nimmt ein Geist Besitz von einem Tänzer, äußert sich dieses, wie bei der Pythia, in ekstatischen Zuckungen und einer veränderten Stimme. Dabei kann jeder Eingeweihte an der Art der Bewegungen, an der Stimmlage und der Ausdrucksweise erkennen, von welchem der vielen Orixás das Medium befallen ist. Auch in den vor allem in Europa und Nordamerika verbreiteten so genannten neopaganen Kulten ist rituelle Trance weit verbreitet. So beschreibt die britische Schamanin und Heilerin Kay Gillard ihre Trance: „Und wenn ich selbst Orakel gebe, fühle ich wie die Energie des Gottes in meinen physischen Körper eindringt.“ Ihre Kollegin Emily Ounsted aber gibt den eher praktischen Hinweis, „dass es eine gute Idee ist, sich bei dieser Technik anfänglich hinzusetzten, bis man voll mit ihr vertraut ist – da dies verhindert, dass man vorneüberfällt, wenn der Gott den Körper betritt oder verlässt“.
Ähnliche Erfahrungen mag auch die delphische Pythia gemacht haben. Plutarch weist den Geist, der die Phytia bei der erzwungenen Befragung ergreift, aufgrund ihres von den normalen Trancezuständen abweichenden Verhaltens und ihrer Stimme als „böse“ und „sprachlos“ aus, die Priesterin selbst als „rasend“. Eine „normale“ Besessenheit durch den sonst wohlwollenden Gott Apollon rief vermutlich ein ganz anderes Verhalten der Priesterin hervor. Schon Plutarch berichtete, dass weder die Sprache noch die Metrik oder der Ton der Pythia vom Gott selbst komme, sondern allein von der Priesterin. „Apollon verursacht nur ihre Inspiration und entzündet das Licht der Zukunft in ihrer Seele“ (Plut. Über die Orakel der Pythia 7. 397 CD). Die Pythia ist also eher als eine Art Übersetzerin des Gottes zu verstehen, die in ihrer eigenen Sprache ausdrückte, was der Gott ihr eingab.