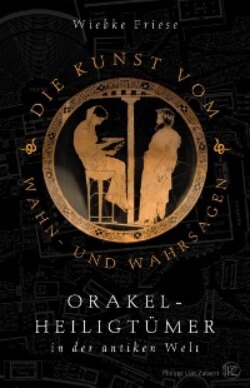Читать книгу Die Kunst vom Wahn- und Wahrsagen - Wiebke Friese - Страница 8
Mesopotamien
ОглавлениеEine altmesopotamische Schaffungslegende besagte, dass die Götter die Welt nicht nur entworfen, sondern auch deren Schicksal bis zum Ende ihrer Tage vorbestimmt hatten. Wie dieses Schicksal aussah und wie es vorherzusagen war, blieb dabei zunächst das Geheimnis der Götter. Shamash (der Gott der Justiz) und Adad (der Wettergott) jedoch verrieten es an Enmeduranke, den Herrscher der Stadt Sippar. Von da an wurde diese Wissenschaft unter den Menschen, aber immer nur an ausgewählte Gelehrte weitergegeben.
Die wichtigste mesopotamische und bereits in der zweiten Hälfte des 3. Jts. v. Chr. weit verbreitete Orakelform war die Omenschau. In einer für die meisten zeitgenössischen Menschen nur schwer fassbaren und daher oft feindlichen Welt konnte alles ein Zeichen der Götter sein – angefangen bei außergewöhnlichen Naturereignissen, wie Überschwemmungen, Gewittern oder Missgeburten, bis hin zu ganz alltäglichen Ereignissen, wie der Flug eines Vogels, das Verhalten der eigenen Herde oder die Physiognomie eines Nachbarn. Fast eben so wichtig wie das Omen selbst war der Kontext, in dem es auftrat. Das Sichtfeld des Betrachters wurde dabei in bestimmte Zonen aufgeteilt (links/rechts, davor/dahinter, oben/unten), die alle eine unterschiedliche Bedeutung hatten. Im Laufe der Zeit entstand daraus ein kompliziertes System von Omina, das bald nur noch Fachleuten zugänglich war. Bereits seit der Mitte des 2. Jts. v. Chr. wurden die Interpretationen daher schriftlich fixiert. Grundlage für die Deutung der Omina bildeten nun Listen mit kausalen Zusammenhängen, wie etwa „wenn eine Frau ein taubes Kind gebärt – wird das Haus außerhalb der Stadt florieren“ oder „wenn eine Wüstenblume innerhalb einer Stadt erblüht – wird diese untergehen“. Verantwortlich für die Auslegung dieser Zeichen und Zusammenhänge waren die so genannten baru. Sie waren keine „Seher“, sondern Zeichendeuter und gehörten keiner bestimmten Priesterschaft an. Vielmehr waren sie direkt am Hofe oder aber im militärischen Dienste angestellt und arbeiteten in der Regel allein. Zu ihren Aufgaben gehörte seit dem 2. Jts. v. Chr. auch die so genannte Opferschau. Bei einem solchen Ritual bat der baru den Gott seine Antwort auf die Eingeweide, vor allem auf die Leber des geopferten Tieres zu schreiben. Um diese Zeichen zu entziffern, bediente er sich eines Tonmodells, wie es, eng beschrieben mit babylonischer Keilschrift, in verschiedenen Ausgrabungen gefunden wurde (Abb. 1).
Eher selten hören wir in der mesopotamischen Kultur dagegen von prophetischen Orakeln. Einige wenige frühe Dokumente stammen aus Mari (um 1780 v. Chr.). Eines beschreibt eine Frau, die sich inmitten eines Ältestenrates auf den Boden warf und in einem tranceähnlichen Zustand von Zuckungen des Körpers begleitet eine Botschaft der Götter mitteilte. Der Gott traf die Wahl seines Sprachrohres selbst. Dies konnte männlich, weiblich, alt oder jung sein, stammte aber fast immer aus einer der unteren Schichten und unterschied sich von der restlichen Bevölkerung höchstens durch eine gewisse spirituelle Neigung. Der Gott sprach zu diesem apilu oder ma/uhhu genannten Medium im Traum oder in einer Vision – seltener in einem oft als krankhaft bezeichneten Zustand der Besessenheit. In der Regel bedurfte die Botschaft dabei keiner Interpretation. Man konnte jedoch professionelle Deuter zu Rate ziehen.