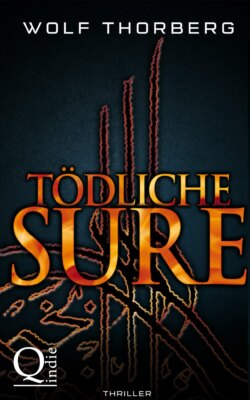Читать книгу Tödliche Sure - Wolf Thorberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAn dem Samstag, der mein Leben veränderte, war mein Bruder vierzehn gewesen und ich sechzehn. Ich schlief bei Freundinnen, so hatte ich es den Eltern erzählt. In Wahrheit verbrachte ich die erste Nacht mit meinem ersten Freund. Der erste Joint, der erste Zungenkuss und, ich konnte mir Dinge nie einteilen, der erste Herr aus Fleisch zwischen den Schenkeln.
Stefan, mein Bruder, kam in der Nacht nach Hause, er war in einer Disco der katholischen Jugend gewesen. In der Wohnung brannte Licht und der Fernseher lief. Im Flur traf er auf umgestürzte Möbel. Dann auf das erste Blut. Er rannte ins Wohnzimmer und fand noch mehr Blut, an der Wand, auf der Couch. Auf dem Boden bildete es eine klebrige Pfütze, in der die Hausschuhe unserer Eltern standen.
Der Täter musste geklingelt und mein Vater geöffnet haben. Er öffnete immer, wenn es klingelte. Jemand da draußen konnte ja Hilfe brauchen oder nur ein gutes Wort. Was der Eindringling auch gewollt hatte, Papa musste es ihm diesmal verwehrt haben. Darauf deuteten eine stumpfe Verletzung am Schädel, Kampfspuren und Schleifspuren ins Wohnzimmer hin. Unter Umständen wäre es glimpflich verlaufen, wenn er sich nicht gewehrt hätte, das denke ich bis heute. Im Augenbindegewebe meiner Mutter fand man Spuren von Pfefferspray, mein Vater musste schon benommen gewesen sein. Danach ging es wenigstens schnell für beide. Der Täter hatte beim Durchschneiden ihrer Kehlen auf Anhieb mindestens eine Halsschlagader durchtrennt. Sie waren bewusstlos binnen Sekunden, danach schnell ausgeblutet.
Die Polizei ging von einem Raubüberfall aus. Schränke und Schubladen waren durchwühlt, eine Münzsammlung fehlte ebenso wie der Schmuck meiner Mutter und tausend Euro Bargeld. Nur zwei Details passten nicht ins Bild: Das erste war ein Flugblatt der Siebentagsadventisten, eine Einladung zu einem Gottesdienst. Es war am Wochenende zuvor in der Fußgängerzone der Stadt verteilt worden. Vielleicht hatte der Täter die Hand nur nicht rechtzeitig weggezogen und es ungelesen in die Tasche gestopft, aus der es gefallen sein mochte, als er die Kabelbinder hervorzerrte. Das zweite Detail: Ein Nachbar bemerkte am selben Tag einen hochgewachsenen, älteren Mann mit ungepflegten Haaren und einem verfilzten Bart, auf dem Kopf eine Baseballkappe und Plastiktüten in den Händen. Angeblich zuckte der Mann seltsam und sein Blick flackerte.
Man hat den oder die Täter nie gefunden und alles bleibt Spekulation. Doch im Verborgenen blüht die Vorstellung und im Dunkel wuchert die Angst. Daran hatte mich Volker erinnert. Und ob ich es wollte oder nicht: Mein Verstand stellte Verknüpfungen her zwischen dem zuckenden, bärtigen Mann, dem Sektenflugblatt und Eschenbach.
Das war es, woran ich wieder denken musste an dem Morgen, an dem Eschenbach aus dem Iran zurückkehren sollte und ich seine Akte studierte. Zum ersten Mal fragte ich mich, ob ich überhaupt als Strafverteidigerin arbeiten konnte. Bei Coretech ging es nur um Geld und der Mandant tat mir eher leid, wie viele, die in ihrem Leben einmal und nie wieder auf einer Anklagebank landeten. Aber nicht alle.
Doch ich nahm mir jetzt die Zeit, das Attest des Psychiaters näher unter die Lupe zu nehmen. Und stieß auf Ungereimtheiten, deren erste und nicht geringste war, dass der Aussteller nie mit dem Probanden gesprochen hatte. Einmal hatte er ihn, getarnt als Kunde, heimlich in der Galerie beobachtet. Sonst stützte er sich lediglich auf Aussagen von Eschenbachs Frau und seiner Angestellten. Auf diese Weise kam er zu dem weitreichenden Ergebnis, mein Mandant leide an einer »verhärteten Form einer wahnhaft-paranoiden Persönlichkeitsstörung, aggressive und autoaggressive Durchbrüche nicht ausgeschlossen«. Er empfahl, ihn zur diagnostischen Abklärung notfalls zwangsweise vorübergehend stationär zu behandeln.
Nun müssen Psychiater aus naheliegenden Gründen des Öfteren ohne aktive Mitwirkung ihrer Untersuchungsobjekte auskommen. Trotzdem. Die Feststellungen schienen mir, gelinde gesagt, ambitioniert angesichts dürftiger Fakten und der eher kursorischen Machart des Ganzen.
Dahingehend ermutigt, recherchierte ich nunmehr über den Arzt. Und seufzte. Er war nicht nur Oberarzt in der hiesigen Psychiatrie, sondern Haus- und Hofgutachter im Gerichtsbezirk und galt wie Eschenbach als Koryphäe auf seinem Gebiet. Es war ein Auf und Ab, denn anschließend stieß ich wieder auf etwas, das Hoffnung machte: ein Foto, das den Mediziner neben Frau Eschenbach zeigte, bei einer Feier, einer beschwingten Runde zugunsten einer Krebshilfestiftung.
Sieh an. Man kannte und man schätzte sich, wie der um Frau Eschenbachs Schulter gelegte Arm vermuten ließ. Methodische Schwächen und ein möglicher Hinweis auf Befangenheit. Auch wenn das Gericht das Attest in jedem Fall zur Kenntnis nehmen würde: Mit einem eigenen Gutachten, das ich der Staatsanwaltschaft zu den Akten legen würde, würde es Remis stehen. So würde der Vorgang erneut unten in dem Stapel offener Verfahren landen, der den Schreibtisch jedes Staatsanwalts begrub. Und bis er sich wieder hochgearbeitet hatte, war, wenn alles glattging, der Eschenbach´sche Rosenkrieg längst Geschichte.
Wenn alles glattging. Ich dachte wieder an meine Eltern und zog Eschenbachs Foto aus der Akte, hielt es gegen das Licht wie eine zweifelhafte Banknote und betrachtete es eingehend: Nur ein soignierter älterer Herr mit Lachgrübchen um die Mundwinkel und einem weißen Märchenbart? Oder war da doch etwas Dunkles in den Augen?
Was, wenn der Psychiater am Ende recht hatte?