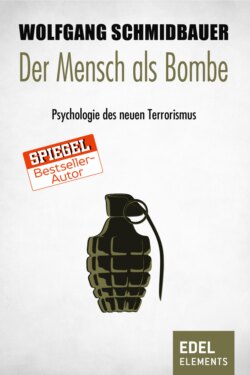Читать книгу Der Mensch als Bombe - Wolfgang Schmidbauer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Teil opfern, um das Ganze zu erhalten
ОглавлениеAus der Unfallmedizin ist der Begriff der Zentralisation bekannt. Wenn der Kreislauf eines Menschen gefährdet ist, werden nur mehr die Organe durchblutet, welche für ein Fortbestehen des Lebens absolut unentbehrlich sind: Gehirn, Herz und Lunge. Gliedmaßen, Verdauung, Nieren, Genitalien werden nicht mehr ausreichend versorgt. Der Nutzen dieser vom unwillkürlichen Nervensystem eingeleiteten Umschaltung ist es, den Tod aufzuhalten. Der Preis dafür sind Schäden der vernachlässigten Organe, die – je nach Dauer der Zentralisation – umkehrbar sind oder bestehen bleiben.4
Wird eine Blutmenge von über einem drei viertel Liter entzogen, dann wird diese Kompensation allmählich überfordert. Die Zentralisation charakterisiert den Zustand zwischen einer gerade noch ausreichenden Regulation und dem vollständigen Zusammenbruch, der in kurzer Zeit zum Tode führt.
Als psychische Zentralisation lässt sich eine Reaktion auf extreme Belastungen erwachsener Menschen definieren. Sie tritt ein, wenn über längere Zeit der normale Reizschutz überfordert wird. Es handelt sich um einen Vorgang, der von einer bewussten Konzentration unterschieden werden kann. Die Phantasie- und Gefühlstätigkeit wird eingeschränkt auf das lebensnotwendige Minimum. Die Anstrengungsbereitschaft und das Interesse für alles, was nicht mit dem unmittelbaren, physischen Überleben zu tun hat, nehmen ab. Vergangenheit und Zukunft sind belanglos geworden. Die Gegenwart reduziert sich auf wenige, aber überlebenswichtige Fragestellungen.
Ausdrücke wie nervöses Erschöpfungssyndrom oder Erschöpfungsdepression treffen nur einen Teil dessen, was mit Zentralisation gemeint ist. Vor allem wird von solchen Ausdrücken der spezifische Vertrauens- und Phantasieverlust nicht erfasst, der mit gut erhaltener, möglicherweise sogar überdurchschnittlicher beruflicher Leistungsfähigkeit der Traumatisierten einhergeht.
Eine spezifische Qualität der Zentralisation liegt in der Schädigung der Aggressionsverarbeitung. Eigene seelische Strukturen, die einen gezielten und kontrollierten Einsatz von Aggressionen ermöglichen, sind anscheinend abgebaut worden. Die traumatisierten Kriegsheimkehrer können sich oft nicht vorstellen, dass ihre Frau oder ihre Kinder verletzt reagieren und sich von ihnen zurückziehen, wenn sie sie mit Grobheiten oder Zynismen behandeln, die unter ihren Kameraden als harmlose Scherze gegolten hätten. Die Zentralisation führt dazu, dass die eigene Aggressivität nicht mehr durch Einfühlung in die Verletzung des anderen, sondern durch Angst vor dem gemeinsamen Feind oder vor dem Vorgesetzten reguliert wird.
Der Traumatisierte ist immer ein Vereinfacher, der danach strebt, die Erschütterung seiner Fähigkeiten zur Reizverarbeitung dadurch zu kompensieren, dass er die Probleme, auf die er stößt, zu einem einfachen Muster von Schwarz und Weiß reduziert. Die Extremtraumatisierten zeigen das auf die gröbste Weise, indem sie vor jedem neuen Reiz erschrecken und die kleinste Veränderung des Erwarteten mit einem Wutausbruch beantworten. Aber mildere Formen der Traumatisierung führen ebenfalls dazu, in einer im Prinzip ähnlichen Weise alles abzuwehren, was doppeldeutig ist, eine Ambivalenz enthält, eine eigene Beteiligung an einem Konflikt nahe legt. Alles Erträgliche ist auf der eigenen Seite, alles Unerträgliche dort, wo die eigene Sicht auf die Welt beunruhigt wird. Das Erträgliche ist das einzig Gute, das Unerträgliche das rein Böse, das nichts anderes verdient als Vernichtung.
Warum sollen wir uns mit solchen Mechanismen beschäftigen? Weil wir in guten Zeiten der kulturellen Entwicklung die Traumatisierten erkennen, behandeln, zum Teil heilen, zum Teil doch in ihren zerstörerischen Reaktionen zügeln können. In schlechten Zeiten aber beginnen sie, uns zu regieren. Aus ihrer Mitte entstehen Propheten und Politiker, die fähig sind, ihre eigenen Verletzungen zu kompensieren, indem sie Macht gewinnen. Dann beschäftigen sich demokratisch gewonnene Mehrheiten mit ihrer Selbstauflösung. Es geht zum Beispiel nicht mehr um die komplexen Konflikte zwischen Deutschen und Juden, zwischen Christen und Muslimen, sondern nur darum, die eine Seite als das Unglück der anderen darzustellen. Vertreibung des Gegners aus dem eigenen Bereich und – wenn dies nicht möglich ist – seine physische Vernichtung erscheinen plötzlich als die einzige und eben deshalb auch als gerechte Lösung. Das Schlagwort ist die erste Waffe des Terrors. Traumatisierte entfalten ihn, um ihre geistige Welt vor den Überforderungen einer offenen und toleranten Wahrnehmung zu schützen. Die Welt wird einfachgeredet. Die Vergleiche verlieren ihre Metaphorik. Eine ganze, fremde Kultur ist «der Satan», «unser Unglück», «der Erbfeind».
Ein neues Schlagwort ist «die Globalisierung». Wenn die vielen Verflechtungen der Moderne auf diese Formel gebracht werden, wird oft sehr deutlich, wie sich die Anforderungen an unsere Reizverarbeitung und die konkreten Möglichkeiten von Bevölkerungsmehrheiten gleich einer Schere öffnen. Das öffentliche Unbewusste ist von Bildern dominiert, in denen schier unverwundbare Helden die Welt wieder und wieder gegen alle Wahrscheinlichkeit vor Superbösewichten oder Angreifern aus dem Weltraum retten, die zunächst alle Trümpfe in der Hand haben.
Mir scheint, dass kein nachdenklicher Mensch heute die seelische Belastung abweisen kann, die dadurch entsteht, dass wir in einer Welt leben, deren Unübersichtlichkeit, ja Undurchschaubarkeit uns mit jedem Schritt bewusster wird, den wir erkennend in sie eindringen. Dieser Belastung standzuhalten, ihr nicht durch den Rückgriff auf Gewissheiten einer tradierten Offenbarung auszuweichen oder sie mit Schlagworten niederzuknüppeln ist mühevoll. Es wird nie zu einer guten Lösung und ist doch die beste, die wir haben. Camus hat diese Situation mit der Metapher von Sisyphos beschrieben: eines Menschen, welcher der Last des nicht Erreichbaren standhält, ohne zu verzagen.
Wer sich die forschende Haltung bewahren kann und daher allen Lösungsvorschlägen eine provisorische Qualität zuschreibt, ist sicher besser als der Rechtgläubige jedes Evangeliums davor geschützt, den Gefahren des explosiven Narzissmus zu erliegen. Aber er muss sich mit der bitteren Einsicht auseinander setzen, dass die Verführungskraft der Vereinfacher parallel mit der latenten Verletzung unserer Sicherheitsbedürfnisse durch eine stärker vernetzte und technisch wie organisatorisch immer reichere Welt zunimmt.
Besonders unheilvoll an den gegenwärtigen Problemen scheint die Verbindung von verletzter Sicherheit, Neid und explosivem Narzissmus. Ein Modell bieten die vielen Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen. Wer immer aus seiner Heimat verjagt wurde, und wie auch immer dieses Schicksal politisch zustande kam, er wird nicht nur in seiner, sondern auch in der Lebenszeit seiner Kinder und Enkel diese Verletzung spüren und günstige Umstände brauchen, um sie zu überwinden. Er muss unendlich viel Neues verarbeiten und ist dazu schlechter fähig als die Menschen, denen sein Schicksal erspart blieb. Kein Wunder, dass er sie um ihre Ruhe beneidet und ihrem Glück noch eine Gegenprojektion seines eigenen Unglücks hinzufügt: Sie haben alles, was ihm fehlt. So ist es eigentlich eher staunenswert, wie friedfertig und dankbar viele Vertriebene sind.
Die Rachephantasie gehört zum Inventar der Kränkung. Je schwerer das Trauma wiegt, desto weniger ist es auch möglich, die Destruktivität dieser Phantasie zu erkennen. Sie erscheint gerecht, sie macht die Welt überschaubarer und einfacher, sie ebnet den Unterschied zwischen den Vertriebenen und den Beheimateten ein, indem sie auch den Beheimateten ihre Heimat zerstört. Dann sind alle wieder gleich, und aus den Trümmern wird eine neue Welt wachsen.
1 V. S. Naipaul: Eine islamische Reise. München [dtv] 2001, S. 56, Erstausgabe 1981
2 Ebd. S. 249
3 Ebd. S. 139
4 Vgl. W. Schmidbauer: «Ich wusste nie, was mit Vater ist!» Das Trauma des Krieges. Reinbek [Rowohlt] 1998