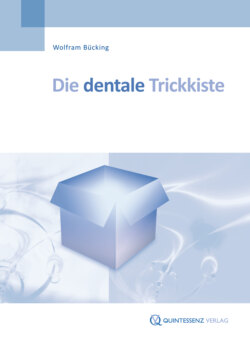Читать книгу Die dentale Trickkiste - Wolfram Bücking - Страница 23
ОглавлениеBruchreparatur von Prothesen
Problem: Bruchreparatur
Seit es Prothesen in der Zahnmedizin gibt, kommt es immer wieder zum Bruch derselben. Prothesen werden heute fast ausschließlich aus heiß- oder kaltpolymerisierendem PMMA (Polymethacrylsäuremethylester) gefertigt. Früher im zahntechnischen Labor kam die Heißpolymerisation zum Einsatz, während heute aus betriebswirtschaftlichen Gründen überwiegend die Kaltpolymerisation angewendet wird. Die Qualität des Heißpolymerisats ist sehr viel höher, aber die Kaltpolymerisate haben sich entscheidend verbessert. Prothesenbrüche werden jedoch ausschließlich mit Kaltpolymerisat repariert.
Wenn ein Patient mit den Prothesenteilen in der Hand in unsere Praxis kommt, sollten wir ihm so schnell wie möglich helfen (Abb. 1). Dazu gilt es folgende Fragen zu beantworten:
Abb. 1 Die zerbrochene Unterkiefertotalprothese
Warum ist die Prothese gebrochen?
Wie können wir die Prothesenteile fixieren?
Wie schnell kann die Reparatur durchgeführt werden?
Lassen sich die Ursachen für den Bruch beseitigen?
Kann die Bruchstelle verstärkt werden?
Die erprobte Lösung: Bruchreparatur mit Glasfaserverstärkung
Zuerst befragen wir den Patienten über den Hergang des Bruches:
Ist die Prothese heruntergefallen und gebrochen?
Wurde die Prothese ungleichmäßig belastet?
Hat sich der Prothesenbruch beim Essen ereignet?
Ist die Prothese schon mehrmals gebrochen?
Nach Abklärung des genauen Sachverhalts wird probiert, ob die Prothesenteile eine klar definierte Bruchstelle aufweisen und exakt zusammenpassen (Abb. 2). Dann werden die Bruchstücke mit flüssigem Sekundenkleber (Cyanoacrylat) an der Bruchstelle bestrichen und definiert fest zusammengedrückt (Abb. 3). Um ein Ankleben der Finger und das Abtropfen des Klebers zu vermeiden, kann als Alternative die Verwendung von Sekundenkleber in Gelform empfohlen werden (Abb. 4). Nach dem Kleben wird die Prothese im Mund einprobiert und auf korrekte Fixierung kontrolliert.
Abb. 2 Die Bruchstücke
Abb. 3 Fixierung der Bruchstücke mit flüssigem Sekundenkleber (Cyanoacrylat)
Abb. 4 Alternative: Sekundenkleber in Gelform (Cyanoacrylat)
Im Labor erfolgt die Herstellung eines Modells der Prothese aus Hartsilikon (Abb. 5a und b). Alternativ lässt sich auch schnellabbindender Abform- oder Montagegips verwenden, der anders als Silikon nicht verbiegen kann und unter Umständen billiger ist. Der Bruchspalt wird aufgeschliffen und erweitert. Die Prothesenteile sollten auf dem Silikonmodell eindeutig fixiert werden können (Abb. 6). Da die Bruchstelle mit Glasfasern verstärkt werden soll, muss dafür im Prothesenkörper ausreichend Platz geschaffen werden. Deshalb wird eine horizontale Rille ausgeschliffen (Abb. 7) und mit einem Stück Wachsdraht oder Wedjet ausgemessen (Abb. 8 und 9). Anschließend wird der Bruchspalt mit korrekt nach Gebrauchsanweisung angeteigtem Kaltpolymerisat geschlossen und im Drucktopf endgehärtet (Abb. 10 bis 12).
Abb. 5a Herstellung des Silikonmodells
Abb. 5b Das Silikonmodell zur Reparatur
Abb. 6 Fixierte Bruchteile mit erweitertem Bruchspalt auf dem Modell
Abb. 7 Ausschleifen einer Rinne für die Glasfaserverstärkung
Abb. 8 Ausmessen des Hohlraums mit Wachsdraht
Abb. 9 Alternative: Wedjet
Abb. 10 Anteigen des Kaltpolymerisats
Abb. 11 Schließen des Bruchspalts
Abb. 12 Endhärtung im Drucktopf
Zur Verstärkung wird ein Glasfasernetzstrang (Dentapreg, Abb. 13) ausgewählt, abgemessen und im Hinblick auf die benötigte Länge markiert (Abb. 14a und b). Mit der Verpackung wird der Faserstrang abgeschnitten. Dabei sollten die Fasern von einer Assistenz auf Zug gespannt sein, denn nur so ist ein exaktes Durchschneiden der Glasfasern möglich (Abb. 15). Nach Öffnung der Folienverpackung mittels Skalpell wird der Faserstrang mit der Pinzette entnommen, in den sublingualen Hohlraum einprobiert und dort mit der Handlampe sorgfältig lichtgehärtet (Abb. 16 bis 18). Nun wird neues Kaltpolymerisat angeteigt und in den Hohlraum eingebracht. In das eingebrachte Kaltpolymerisat wird das Glasfasernetzbündel eingedrückt und mit einer weiteren Schicht abgedeckt. Anschließend erfolgt wiederum die Aushärtung im Drucktopf unter Wasser mit 2 bar Druck (Abb. 19).
Abb. 13 Glasfasernetzstrang
Abb. 14a Abmessen der benötigten Länge
Abb. 14b Markieren der Länge
Abb. 15 Abschneiden der benötigten Länge durch die Folienverpackung auf Zug
Abb. 16 Entpackung des Glasfasernetzstrangs
Abb. 17 Einprobe des Glasfasernetzstrangs
Abb. 18 Lichthärtung mit der Handlampe
Abb. 19 Das Glasfaserbündel wird in Kaltpolymerisat eingebettet
Nach der Aushärtung wird die Prothese wie gewohnt mit Fräsen und Schleifpapier ausgearbeitet und am Poliermotor auf Hochglanz poliert (Abb. 20 bis 23). Abschließend erfolgt am Patienten eine Kontrolle der reparierten Prothese auf Passung sowie Okklusion und ggf. eine Korrektur (Abb. 24). Falls die Basis nicht stimmt, sollte noch eine indirekte Unterfütterung vorgenommen werden. Dies ist in dem hier gezeigten Beispiel nicht der Fall – die Patientin geht nach 2 Stunden Wartezeit erleichtert aus der Praxis (Abb. 25).
Abb. 20 Ausarbeitung mit der Kunststofffräse
Abb. 21 Ausarbeitung mit dem Schleifpapier
Abb. 22 Reparierte Prothese nach der Politur
Abb. 23 Reparaturstelle im Durchlicht
Abb. 24 Kontrolle der Okklusion
Abb. 25 Das herzliche „Dankeschön“ der Patientin
Danksagung
Seit vielen Jahren ist Frau Sabine Mann die Seele unseres Praxislabors. Sie hat die Entstehung vieler Beiträge für die „Dentale Trickkiste“ praktisch begleitet. Dafür danke ich ihr an dieser Stelle ganz herzlich.
Materialliste
1 Glasfasersystem Dentapreg (Fa. Dentapreg, Würzburg; www.dentapreg.de).
2 Glasfasersystem Everstick (Fa. Loser, Leverkusen; www.loser.de).
3 Prothesenkunststoff: Paladur rosa (Fa. Heraeus Kulzer, Wehrheim; www.heraeus-kulzer.de).
4 Modellsilikon: Coltoflax (Fa. Coltène Whaledent, Langenau; www.coltenewhaledent.com).