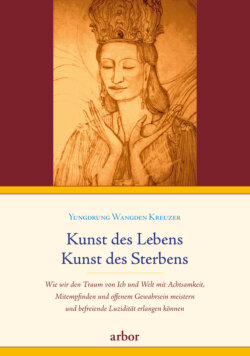Читать книгу Kunst des Lebens, Kunst des Sterbens - Yungdrung Wangden Kreuzer - Страница 19
Vanitas oder Der Traum des Sisyphos
ОглавлениеVerlieren und wieder verlieren ist der Weg des Tao.
Laotse
Der Weise ist frei von Geschäftigkeit, der Tor ist gebunden durch sich selbst.
Szoszan
Weise erblicken nichts, was zu tun wäre, wie Schlummernde ruhen sie in sich selbst.
Ashtavakragita
Halte an nichts fest, und du wirst frei sein, wo immer du auch bist.
Rinzai
Was ein gutes und sinnerfülltes Leben ist und wie es verwirklicht werden kann, war seit der griechischen Antike bis in die frühe Neuzeit hinein auch im Westen das eigentliche Thema der Philosophie, und in den meisten Überlegungen hierzu zeigt sich, dass die Suche nach dem Sinn unseres Lebens von der Suche nach einem Zustand bleibenden Glücks und innerer Zufriedenheit nicht zu trennen ist.
Für Aristoteles führte ein gutes Leben zum Zustand der »Eudaimonie«, zu einem »glücklichen Geist«, in dem unser Wesen schließlich alle in ihm angelegten Qualitäten des höchsten Guten in sich selbst erkennt und so Ganzheit erlangt. Auch für ihn, den Schüler des Platon, ist tugendhaftes Handeln und Selbsterkenntnis noch der Weg zu wahrer Glückseligkeit, und der Erwerb vortrefflicher Tugenden, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften auf dem Weg ist ihm das Zeichen eines geglückten Lebens.
Den Lehren Platons habe ich in diesem Buch viel Raum gewidmet, da sie das wichtigste Bindeglied zwischen der wahren, einer zeitlosen Lebensweisheit verpflichteten Philosophie des Westens und den philosophischen Lehren des Buddhismus und des Hinduismus darstellen.
Der Sisyphos-Mythos ist eine immer wieder berührende lehrhafte Darstellung der Conditio humana, und als solche wurde sie in der Antike auch gern erzählt. In der existenzialistischen und marxistischen Auffassung des Mythos wird Sisyphos als ein treffendes Bild für den modernen Menschen in seiner »Geworfenheit« betrachtet, ein Held des Absurden und der Arbeit, welcher den alten Göttern widersteht und mutig ihrem Gebot entgegenhandelt. Weil er so schlau ist, gelingt es ihm mehrmals, Thanatos, den Tod, zu überlisten. Durch einen Trick entflieht er diesem sogar einmal aus dem Hades, und zur Strafe wird er zwar von den Göttern zu einer sinnlosen, sich immer wiederholenden Tätigkeit verdammt, aber er ist stolz auf seine Kraft und seinen Widerstand und lässt sich nicht entmutigen.
Trotz der »vollkommenen Sinnlosigkeit« seines Tuns führt er seine monotone Arbeit mit munterem Sinn aus, und: »Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen«, so heißt es am Ende des bekannten existenzialistischen Essays von Camus über den Mythos des Sisyphos.
Es ist interessant zu beobachten, wie in dieser gewagten Umdeutung aus dem, was den Griechen der Antike noch eine Strafe und Verdammung war – weil Sisyphos ähnlich dem Prometheus, der das Feuer stahl, in seiner Hybris gegen göttliches Gesetz verstoßen hatte –, für moderne Denker nun ein Gleichnis für den Normalzustand des heutigen Menschen und seines angeblich sinnlosen Lebens geworden ist.
Ich erwähne dies hier nur deswegen, weil auch heute noch viele, vor allem junge Menschen, vom deprimierend nihilistischen Denken des Existenzialismus und Absurdismus geprägt und beeinflusst werden, denn im schulischen und im universitären Rahmen sind diese Denkrichtungen immer noch en vogue.
In der zeitgenössischen akademischen Philosophie gelten die Themen »Sinnsuche« und »Lebenskunst« schon seit Längerem als überholt, als veraltet und kindisch, um nicht zu sagen: als Fauxpas – von Gedanken über die Natur des Geistes vor jedem Gedanken gar nicht zu reden. Sieht man doch in der Nachfolge Descartes’ stehend das eigene Sein als mit dem gehirnlichen Denkprozess identisch und von diesem abhängig an.
Man möchte sich als professioneller Denker, als originell und auf der Höhe der heutigen Zeit und Wissenschaft zeigen und sicher nicht als Idealist – als rückwärtsgewandt, unwissenschaftlich oder gar religiös auffallen.
Man kann über vieles nachdenken und immer neue Auffassungen formulieren, doch im Grunde sind in der westlichen Philosophiegeschichte, was das Verständnis der ganzheitlichen Natur des Menschen und seiner Erfahrungen und Welt betrifft, Platon und sein später Schüler Plotin unübertroffen und oft von zeitloser Aktualität.
Die Natur muss nicht korrigiert und verbessert, die Wirklichkeit kann und braucht nicht erfunden und erdacht werden, sie ist immer schon da. Sie ist das, was ist, oder »Thatata« – die »Soheit« des Seins. Wir lernen gut, und auch große Erfindungen sind möglich, wenn wir durch direkte Beobachtung von der Natur lernen.
Die Suche nach gewollter Originalität ist eine Sache des Verstandes und führt nur in immer neues verwirrtes Denken, in immer neue persönliche Ansichten.
Das Erkennen der Wahrheit aber ist völlig unpersönlich, denn je weniger man das Geschaute interpretiert, umso unmittelbarer schaut man die Wahrheit.
Es gibt natürlich im Grunde nichts Neues im Wesen und Funktionieren unseres Geistes und auch nichts Neues in der Beschaffenheit eines menschlichen Körpers und der sechs Sinne. Sie waren beide zur Zeit des Buddha und lange davor schon dieselben wie heute.
Als der Buddha am Anfang seines öffentlichen Wirkens einmal gefragt wurde, warum er lehre, antwortete er: »Ich lehre, weil alle Wesen glücklich sein wollen und niemand leiden will.« Als er dann des Weiteren gefragt wurde, was er denn lehre, antwortete er: »Ich lehre, wie die Dinge sind.«
Direkt an die unmittelbare Erfahrung jedes Menschen anknüpfend, lehrte der Buddha zuerst, der »Vergänglichkeit aller Erscheinungen« gewahr zu werden und sich durch direkte, nichturteilende und ruhige Beobachtung von dieser Wahrheit selbst zu überzeugen. Auch lehrte er, sich mit offenem Geist und Herzen des Leidens und der Unzufriedenheit als allgegenwärtig in der täglichen Erfahrung aller Wesen und im eigenen Geist gewahr zu werden und Geburt, Krankheit, Alter und Tod als die natürliche Folge unseres Geborenseins in einem Körper zu erkennen. Unser Geborenwerden in einem materiellen Körper erklärte er als eine natürliche Folge unseres Lebensdurstes und unseres Festhaltens an flüchtiger Erscheinung. So legte er die Hand auf den Puls eines jeden Wesens wie ein guter Arzt, und nach der Diagnose des Leidens lehrte er »die Ursachen des Leidens«. Nämlich dass zwar alle Wesen glücklich und gesund sein wollen, aber wegen ihrer offensichtlichen Unvernunft oder Unwissenheit die allesamt vergänglichen Phänomene ihrer Erfahrungswelt festhalten, so als ob sie bleibend wären. Durch diese falsche Annahme und Prämisse geht der Einklang mit der Natur der Dinge verloren, und eine Kette von Fehlwahrnehmungen und falschen Interpretationen entsteht daraus, die unweigerlich zu Leiden und Enttäuschung führen.
Der eigene Geist, eigentlich völlig offen, wird für ein Selbst »gehalten«, und die eigenen Erfahrungen, ihrer Natur nach frei und fließend, werden für dies und jenes und für etwas anderes als man selbst »gehalten«. Dieses »Halten« aufgrund von Unwissenheit ist die Ursache all unserer vielfältigen Störungen, Irrtümer und Leiden. Aus diesem grundlegenden Irrtum entstehen die 84 000 neurotischen Störungen, welche eingeteilt werden können in jene des Spektrums der Dummheit oder Uneinsichtigkeit, in die des Anhaftens und Verlangens und die der Aversions- und Angststörungen.
Als Nächstes lehrte der Buddha die heilende Therapie oder den »Weg zur Aufhebung der Ursachen des Leidens«. Er lehrte, dass auch diese Störungen vergänglich sind und nur eingebildet und dass sie deswegen aufgelöst werden können. Wir sind im Grunde völlig gesund und heil und ganz, und das ist unsre wahre Natur. Der Weg besteht darin, die Vergänglichkeit zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen. Wenn wir an nichts mehr gedanklich festhalten oder anhaften, wird uns die Vergänglichkeit aller Phänomene zu einer unerschöpflichen Quelle des Trostes und der Freude.
Durch die meditative Übung der Geistesruhe, frei von Konzeptualisierung und durch achtsame Beobachtung der eigenen Erfahrungen, ohne darauf mit Anhaften oder Aversion zu reagieren, reinigt sich der Geist von der Dunkelheit der Unachtsamkeit und von der tief eingefahrenen Gewohnheit des Festhaltens und Konzeptualisierens seiner Erfahrungen. Auf diese Weise können die Ursachen des Leidens in uns aufgelöst werden.
Das sogenannte »Nirvana« am Ende des Wegs ist der Zustand des höchsten Friedens und nichts anderes als der uranfängliche Zustand der Gesundheit und Ganzheit unseres Geistes. Dieser ist frei von Unwissenheit, frei von Durst, frei von Fieber, frei von Anhaftung, frei von Fehlwahrnehmungen, wie der Buddha sagt. Er ist höchstes Glück – deswegen heißen die Buddhas auch »Sugatas« oder »die, welche in das Glück gegangen sind«. Und er ist höchste Luzidität, deshalb eben heißen sie »Buddhas« oder »die, welche erwacht sind«.
Nun sind wir alle zu unserem Leidwesen noch nicht völlig aus dem Traum erwacht. Insoweit mag die Parabel von dem Widerstand des Menschen gegen das, was ist, und von seinem selbstgeschaffenen Fatum eines vergeblichen und andauernden Mühens, welches der Mythos des Sisyphos uns erzählt, auch für uns zutreffen. Sodass es hier für uns durchaus noch etwas zu lernen gibt – sind wir ja den früheren Generationen in unserem Fühlen, Denken und Verhalten nicht so unähnlich, wie wir meinen.
König Sisyphos, so geht die Erzählung, war so stark wie zwei Männer, und er war sehr schlau. Sein Name selbst bedeutet »der Schlaue«, und es gelang ihm dank seiner Intelligenz wie gesagt mehrmals, den Gott Thanatos zu überlisten und so sein Sterben hinauszuzögern. Und selbst aus dem Hades entfloh er durch einen Trick. Thanatos klagte ihn daraufhin bei den Göttern an; und weil er sich mit seinem Handeln dem göttlichen Gesetz (der Vergänglichkeit) widersetzt hatte, wurde er dazu verdammt, im Schattenreich, im Hades, eine sinnlose Handlung immer wieder aufs Neue zu wiederholen.
Homer erzählt im elften Gesang der Odyssee, wie Odysseus ihn und viele andere Verstorbene sah, nachdem er den Schatten des Jenseits ein großes Totenopfer dargebracht hatte und ihm Einblick gewährt wurde in das unterirdische Reich der Toten: »Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert einen schweren Felsen mit großer Kraft bewegen. Er stemmt sich dagegen und müht sich mit Händen und Füßen, ihn vom Talgrund den Berg hinauf zu wälzen. Doch hat er ihn auf dem Gipfel, da entfällt ihm die Last, und hurtig, mit Donnergepolter, entrollt ihm der tückische Stein. Und von vorne arbeitet er, stemmt sich dagegen, dass der Angstschweiß seinen Gliedern entströmt und Staub sein Antlitz umwölkt.«
Hier ist für eine dem Geist der griechischen Antike angemessene Deutung anzumerken, dass für das philosophische und aristokratische Denken dieser Zeit arbeiten müssen und Handel treiben kein Privileg oder der »Edelheit« des Menschen angemessener Zustand, sondern eher die Folge eines Verlusts unserer ursprünglichen Unschuld, Bedürfnislosigkeit und Freiheit war. Die unsterblichen Götter selbst genießen, von allem Irdischen, von aller Tätigkeit, Notwendigkeit und Zeit entbunden, ein erhabenes Glück und ewige Ruhe. So hatten die Griechen auch zwei Worte für Zeit. »Kairos« bezeichnete die »göttliche Zeit oder den ewigen Augenblick«, das Gegenwartsbewusstsein – und »Kronos« die profane, säkulare, sequenzielle Zeit des menschlichen Denkens und Ermessens.
Die Moral der Sisyphos-Erzählung impliziert ein Verständnis von Arbeit, das mit dem in der biblischen Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies vergleichbar ist. Dort heißt es nach der Übertretung des göttlichen Gebots, »nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen«: »… und im Schweiße eures Angesichts sollt ihr ab jetzt euer Brot verdienen!« Und damit sind wir beim Fall in den Modus eines dualistischen Erkennens und der daraus folgenden Exilierung aus dem Paradies, aus einer reinen, unschuldigen und leidlosen Schau.
Die Paradieserzählung entspricht dem Mythos von einem goldenen Zeitalter, der sich zum Beispiel auch im Taoismus, Hinduismus und Buddhismus findet. Im Mahabarata wird vom »Satya-Yuga«, vom »Äon der Wahrheit« erzählt – Hesiod sprach vom chrýseon génos oder dem »Goldenen Geschlecht« und die römischen Dichter Vergil und Ovid vom aurea aetas.
Nach diesem ersten Äon der Unschuld folgen drei weitere, die nach Metallen von geringerem Wert benannt sind, weil in ihrem Verlauf gleichzeitig mit einer Zunahme weltlicher Wünsche und Arbeiten eine Abnahme der Tugenden und des Friedens und ein zunehmender moralischer Verfall einhergeht, bis schließlich im eisernen Zeitalter ein eigensüchtiges, diskursives Denken und destruktive Emotionen wie unstillbares Verlangen und viele Ängste die Menschen beherrschen, welche folglich ständige Unruhezustände, Kriege, Unzufriedenheit und vielerlei Leiden erzeugen und erdulden müssen. Tröstlich zu wissen, dass, auf dem großen Rad der Zeit, nach den Zerstörungen und Kataklysmen am Ende eines ehernen Äons immer wieder ein neuer Anfang, ein neues goldenes Zeitalter kommt.
Ein Neubeginn ist dann wieder für die Menschheit möglich. So wie der Einzelne als neugeborener Säugling die Spuren seiner früheren Erfahrungen zwar in sich trägt, doch sich an diese weder erinnert noch seine früheren »Besitztümer, Errungenschaften, Erfindungen und Geräte« im Außen seines neuen Lebens wiederfindet, kann auch die Menschheit, auf der durch ein Diluvium gereinigten Erde, von dieser Position einer anfänglichen, unbewussten Unschuld aus einen neuen Anfang machen.
Es ist der Sage nach nicht das erste Mal, dass sich eine Menschheit durch ihre eigenen hochentwickelten »technischen Errungenschaften« und wegen ihrer unterentwickelten Vernunft, Weisheit und Empathie, schließlich selbst zugrunde gerichtet hat.
Am goldenen Beginn der vier Zeitalter, so heißt es, hatten die Menschen noch keine überflüssigen Gedanken, und sie mussten keinerlei Nahrung zu sich nehmen. Ihre Körper waren Körper aus Licht, es gab keine Leiden, und ihre Lebensdauer betrug über zehntausend Jahre. Ein Äon später dann begannen sie, eine von selbst erscheinende, nährende Substanz zu sich zu nehmen, ähnlich dem göttlichen Nektar, Amrita oder Manna; und da sie eine Anhaftung an diese Speise entwickelten, vergröberten sich ihre Körper und ihre geistigen Sinne mit der Zeit. Langsam entstand ein diskursives Denkbewusstsein in ihnen, und sie verloren dadurch ihre intuitiven Fähigkeiten. Im nächsten Äon entwickelten sich Geschlechtsorgane und ein Verdauungssystem, und die Lebenszeit verkürzte sich weiter.
Schließlich mussten sie selbst grobstoffliche Nahrung, wie Getreide anbauen und zu sich nehmen, um leben zu können, und ihre Wünsche wurden mehr. Die Lebenszeit sinkt im eisernen Zeitalter auf hundert Jahre. Die Menschen erfinden Waffen, töten sich damit gegenseitig, und sie töten Tiere, um von ihrem Fleisch zu leben. Selbstsucht und gehirnliche Denkfähigkeit entwickeln sich, und der Anspruch, etwas allein zu besitzen, wird mit der Waffe und als das »Recht des Stärkeren« verteidigt.
Akzelerierend dominiert schließlich ein ständiges Denken, Wünschen und Handeln, ein fortwährendes Erfinden, Erwerben und Wegwerfen, Bauen und Wiederzerstören im »Menschheitstraum« dieser ehernen Zeit; und immer unruhig, strebend und arbeitend, müht sich der listenreiche Mensch, sich die Welt untertan zu machen und die äußere Natur zu unterwerfen und zu »verbessern«.
Die Lehre von den vier Zeitaltern erzählt vom Urzustand des Menschen als Zustand der Vollendung und Zufriedenheit und von seiner »Evolution« als Degeneration, als stufenweiser Verfall und Verlust seiner höheren Fähigkeiten und Tugenden. Das heißt, sie stellt dar, wie der Mensch im Außen suchend und immer weiter fortschreitend zwar vieles findet und sich aneignet, sich selbst und seine Einheit mit der Natur dabei aber immer mehr vergisst und, von selbstgeschaffenen Ketten und Zwängen gebunden, in heilloser, destruktiver Tätigkeit am Ende sogar die Welt und damit die Grundlage seiner physischen Existenz und die seiner Kinder zerstört.
Die Hybris des menschlichen Strebens, angetrieben von Begehrlichkeit und gestützt von einem listigen, aber kurzsichtigen Verstand, war den lebensweisen Menschen der Antike so sehr bewusst, dass sie deren unheilsame Folgen in Parabeln wie in der des Ikaros, des Prometheus, des Sisyphos und des Tantalos darstellten und als ein Caveat in ihre volkstümlichen Erzählungen flochten. So konnte man sich ihrer, als eines abschreckenden Beispiels, immer wieder erinnern und eine gute Lehre daraus ziehen. Über die Dummheit des Königs Midas machte man sich gern lustig, welcher einen Wunsch frei hatte und sich in seiner Besitzgier wünschte, dass alles, was er berühre, zu Gold werden möge – und dann erst erkannte, dass man Gold nicht essen kann.
Vergeblich und eitel, Vanitas ist das Sichmühen des Menschen, der Glück und Erfüllung in vergänglichen Dingen sucht und der wie Sisyphos, gleichzeitig die Vergänglichkeit, das göttliche Gesetz der Natur nicht wahrhaben will, dagegen ankämpft und ihm zuwiderhandelt. Er kämpft mit seiner Schläue gegen die Natur und gegen den Tod, doch erkennt er nicht, dass gerade, weil er sein Leben festhält, er dieses immer wieder schmerzlich verlieren muss. Obwohl er sich so sehr müht, etwas zu erwerben, und das Erworbene festhält mit aller Kraft, wird ihm das so schwer Erreichte und Erworbene doch immer wieder entgleiten wie dem Sisyphos sein Fels.
Er leidet daran, und doch kann er seine Last und unruhig gespannte Tätigkeit von Körper, Rede und Geist nicht lassen. Alles ist Mühe an ihm, aber sein Mühen ist vergeblich und endet seine Schmerzen nicht, denn an etwas anhaften, das seiner Natur nach vergänglich ist, erzeugt notwendigerweise Angst vor Verlust und viele andere Leiden.
Sisyphos ist nicht durch die Götter verdammt, sondern durch sich selbst. Er selbst kann nicht loslassen, will noch nicht loslassen und leidet an seinem Widerstand gegen die Natur und an seiner selbstauferlegten Last. Niemand wird sie ihm nehmen, wenn er sie selbst noch behalten will – so ist es eingerichtet, dass ein jeder für sich selbst erkennen soll, was sein Tun für Folgen hat, und selbst spüren, ob er genug getan und nun bereit zur Ruhe ist.
Wenn der Mensch aber bereit ist, lässt er los; und wenn er sich nicht mehr selbst bindet, ist er frei. Frei und unsterblich sind wir dann, denn nur wegen unseres Festhaltens ist es, dass wir einen materiellen Körper haben, der dem Tod unterworfen ist.
Sei es durch Enttäuschungen oder eine direkte Begegnung mit dem Tod in der Verwandtschaft oder im Kreis der Freunde und Bekannten oder ohne ersichtlichen Anlass von innen her, von der Stimme im eigenen Herzen erweckt – ich glaube, jeder Mensch beginnt sich irgendwann im Laufe seiner persönlichen Entwicklung zu fragen, ob seine Bemühungen um vergängliche Objekte und weltliche Ziele über das nötige Maß hinaus überhaupt sinnvoll sind. Er beginnt mit Recht zu zweifeln, ob sie das Glück, die Erfüllung und Zufriedenheit, die er in ihnen sucht und sich wünscht, wirklich geben können; und vom ständigen Wiederholen derselben Erwartungen und Handlungen frustriert, versucht er, deren Sinn und Wirkung zu verstehen. Vielleicht wird auch er dann ein Suchender nach Wahrheit, einer, der sein Leben und Tun infrage stellt und beginnt, das Treiben und Denken, das Wünschen und Fürchten in sich selbst zu beobachten.
Im Menschen denkt ja der Geist über sich selbst nach und versucht, sich selbst zu verstehen und zu erkennen. Das ist das eine, und wir suchen mit unserem Denken im Außen und in vielerlei Schriften nach Antwort.
Das andere ist, dass wir um der Wahrheit willen schließlich über Denken und Philosophie hinausgehen und in unseren stillen Meditationssitzungen lernen, das Kommen und Gehen unserer Gedanken zu beobachten, ohne auf diese zu reagieren. Dadurch erkennen wir nach und nach deren Qualität und Natur und entdecken den Zustand reiner Präsenz, frei von allen Gedanken. In der Stille reinen Erkennens ruhend, erfahren wir Sinn und Sein als eins. Wir ruhen dann im unaussprechlichen Sinn, wie es im Dzogchen genannt wird.
Es ist nicht einfach, sich aus der Bezauberung durch die Vielfalt der eigenen Wahrnehmungen und die sie begleitende Trance des begrifflichen Denkens zu befreien. Es ist, wie der erste Patriarch des Zen in China Bodhidharma sagte, das schwerste und gleichzeitig sinnvollste Werk, das ein Mensch vollbringen kann.
Die Träume des Mikrokosmos Mensch steigen aus den Tiefen seines Unterbewussten auf, in dem die Spuren all seiner früheren Erfahrungen und Handlungen mit ihrem Wohl und Wehe gespeichert sind; und er hat schöpferisch und leidend Anteil am Traum des Makrokosmos, am Traum der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Universen, die ihrerseits aus dem kollektiven Speicherbewusstsein aller Wesen entstehen und von ihrem Denken aufrechterhalten werden.
Dem Buddhismus nach erscheint ein jeder Traum, der ja nur aus dem Lebenslicht des eigenen Geistes gebildet ist, als Ausdruck eines bestimmten Denkens und Wollens und einer Sehweise, welche normalerweise selektiv und völlig von früheren Gewohnheiten konditioniert ist. Einstein formulierte eine Erkenntnis aus seinen Forschungen mit den Worten: »Die sogenannte Realität ist eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige.«
Wir sind in der Begegnung mit unserer eigenen Vision genauso eingeschränkt und verblendet wie in unserer Begegnung mit der Welt da draußen, die wir fälschlich für wirklicher halten als unsere Vision im Traum.
Zum besseren Verständnis will ich einen Traum erzählen, den ich vor vielen Jahren hatte und der mir manchmal einfällt, weil er sehr signifikant war. Ich träumte, in einem weiten, leeren Raum zu schweben, als plötzlich eine große Kugel neben mir auftauchte. Sie war etwas kleiner als einer dieser Heißluftballons, aber offensichtlich aus Eisen oder Stahl und sehr massiv.
Ich schwebte direkt neben ihr und konnte sie mit Händen berühren und an ihr kratzen. Ich klopfte darauf, um das Material zu erkunden, und hörte, dass sie hohl war. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich gerade träume, und mir kam die Idee, einfach in das Innere der Kugel hineinzugehen. Ich versuchte es, aber es gelang nicht. Ich versuchte es einige Male, doch vergeblich. Es gelang mir nicht, obwohl ich wusste, dass es ein Traum ist.
Warum gelang es nicht? Wir berühren hier einen ganz wichtigen, signifikanten und entscheidenden Punkt der Bardo-Lehren, auch für den Zustand des Postmortem. Es gab offensichtlich etwas in meinem Unterbewusstsein, eine sehr tiefsitzende Überzeugung, dass eine so hart und realistisch aussehende Materie einfach undurchdringlich ist. Da es ja nur ein Traum war, ist klar, dass nur etwas in mir selbst mich daran hinderte, meinen Willen zu erfüllen – und genau so ist es.
Nur unsere tiefsitzenden Überzeugungen und fixen Vorstellungen, wie die Dinge sind und was wir sind, hindern uns daran, uns frei zu bewegen, zu fliegen und durch Wände zu gehen, alles das ist möglich für den, der sich von diesen Konzepten und unbewussten Glaubenssätzen wirklich gereinigt hat. Viele Yogis der Mahamudra- und Dzogchen-Linien haben in den letzten Jahrhunderten durch die Methode der kontinuierlichen Selbstbefreiung aller Konzepte diese Reinigung karmischer Spuren erreicht und diese freie Beweglichkeit durch vollkommene Luzidität verwirklicht. Sie sind geflogen, konnten ihre Gestalt verändern, konnten durch Wände gehen, haben ihre Hände in Felsen gedrückt, als ob es Butter wäre, sind über das Wasser gegangen und vieles mehr.
Der Tertön Pema Lingpa lebte im 15. Jahrhundert in Bhutan, und eines Tages verkündete er, einen Terma-Schatz des Guru Padmasambhava heben zu wollen. Über hundert Menschen kamen in seinem Geleit und wurden Zeugen eines wunderbaren Schauspiels. Am Ort des ihm geweissagten Schatzes angelangt, einem tiefen Fluss im Gebirge, stieg er mit einer brennenden Kerze in der Hand und voll angekleidet in das reißende Wasser und verschwand in den Fluten. Nach einiger Zeit stieg er zum Erstaunen aller aus dem Fluss wieder herauf und hielt unter seinem Arm eine kleine Truhe mit dem Schatz und in der anderen Hand die noch immer brennende Kerze. Seine kostbaren Kleider aus Seide und Brokat waren vollkommen trocken.
Dieses sublime Wesen, Inkarnationen vorher schon einer der engen Schüler des Meisters Padmasambhava, war ein Siddha, ein Verwirklichter, der schon lange vor diesem Ereignis vollkommene Luzidität erlangt hatte. Er hat die Leerheit aller Erscheinungen realisiert und war selbst völlig leer von jeder Vorstellung.
Den von Padmasambhava sechs Jahrhunderte vor dieser Entdeckung verborgenen Terma-Zyklus von Sadhanas und Dzogchen-Texten haben wir heute noch, und ich habe einige Übertragungen aus diesem Zyklus von S. E. Gangteng Tulku Rinpoche erhalten, einem meiner Lehrer.
Viele Yogis haben durch die systematische Praxis des Dzogchen am Ende ihres Lebens ihren physischen Körper der fünf Elemente aufgelöst in die fünf Farben des klaren Lichts und haben so ein wunderbares Zeichen ihrer völligen Befreiung vom Samsara gegeben.
Der Yogi ruht hierbei in tiefem Samadhi noch im Körper, und dieser wird in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen nach dem Tod immer kleiner, bis er verschwindet, und nur die unbeseelten Teile des Körpers, also Haare und die Nägel von Fingern und Zehen, bleiben zurück. Gleichzeitig erscheinen Regenbogenlichter am Himmel und um das Haus, die auch für normale Sterbliche sichtbar sind. Es sind dies die untrüglichen Zeichen, dass ein Individuum vollkommene Buddhaschaft erlangt hat.
Fälle von dieser Art von Verwirklichung, die durch die Methoden des Dzogchen auch heute noch erreichbar ist, waren in Tibet häufig; und auch bis in unsere Zeit sind noch einige Fälle gut bezeugt. 1998 zum Beispiel erreichte in Azi Rong in Osttibet ein alter Mönch der Nyingma-Linie, Khenpo Chöying Rangdröl, achtzig Jahre alt, den jah-lüh oder »Regenbogenkörper«. Er ließ nicht einmal Haare und Nägel zurück.
Der Buddha lehrte, dass alles, dem wir ein Sein und Wirklichkeit zuschreiben, uns nur als solches und als dauerhaft und fest erscheint, weil wir uns an diese Sichtweise und Zuschreibung seit Langem gewöhnt haben und diese selektive Sichtweise mit Gedanken und Worten immer wieder festhalten. So ist es auch mit unserem Körper. Dauerhaftes Festhalten an Körper, Ich und Welt erzeugt die Illusion einer scheinbar dauerhaften Existenz, die vollkommen illusionär ist. So heißt es in einem Sutra: »Mit dem Denken erscheinen die Myriaden von Welten, wenn das Denken aufhört, so verschwinden diese.«
So erscheinen alle Welten für einen Buddha als sein eigener Geist und als sein eigenes Licht und reine Energie, für jene aber, die noch im Denken und Wünschen befangen sind, erscheinen sie als eine eigenständige Wirklichkeit, als Körper, Ich und Welt, als Gott und Teufel, als Leben und Tod, als ein Etwas oder als drohende Vernichtung, als zu Begehrendes oder zu Fürchtendes, als Fremdes, Gewaltiges und Übermächtiges. Bis endlich ein jedes Wesen Buddha wird, indem es wieder zu sich kommt und erwacht, werden leider noch viel nichtluzide, von Ignoranz und den Störgefühlen bestimmte Träume erlebt werden, doch sie alle sind vergänglich und ohne wirkliche Substanz.
Das aber, was wirklich ist, ist von selbst wirklich und damit beständig, und was nur zugeschriebene Wirklichkeit besitzt, muss immer neu gedacht, behauptet und geglaubt werden; und es verschwindet augenblicklich, wenn man nicht daran denkt. So ist es zum Beispiel mit allen Gedanken und Vorstellungen von uns selbst. Wir denken etwas, und im selben Augenblick löst es sich auf, denn es hat keine Wirklichkeit.
Vergänglich sind alle Träume von Welt und Mensch, von Dämonen und von Gott – Träume, in denen der Sinnende den Sinn sucht, Geist den Geist begehrt und hasst und verblendetes Denken, immer zwischen eingebildeten Gegensätzen kreisend, seine eigenen Schöpfungen für wirklich haltend, das Rad des Lebens antreibt und sich in immer neuen Gestalten verkörpert.
Alle Dinge, Gefühle und Gedanken sind ohne Zweifel vergänglich, nicht verlässlich, und so erweisen sich all unsre Bemühungen im Lebenstraum, diese zu erwerben und festzuhalten, als vergeblich und werden von der Gewissheit unseres Todes als dem sicheren Ende dieses Traums immer kontrastiert und infrage gestellt.
Vergeblich sind unsere Bemühungen um Ansehen und Anerkennung, mühsam ist es, Besitz zu erwerben, eine Stellung zu erreichen und zu halten – mühsam wie das Mühen des Sisyphos, der dazu verdammt ist, immer wieder einen Felsen den Berg hinaufzuwälzen. Oben angelangt, versucht er, diesen festzuhalten, um gleich darauf mit ansehen zu müssen, wie er ihm entgleitet und wieder den Berg hinabrollt.
Das Hinaufwälzen und Festhalten ist voller Mühen, das Hinabrollen und Im-Talgrund-zur-Ruhe-Kommen aber völlig mühelos, denn es folgt der Natur der Dinge. Das gibt uns also zu denken über Vanitas und Wahn, über Schein und Sein und über das Vergebliche und Verblendete oder Sinnvolle in unserem Tun und Streben. Alles, was angehäuft wurde, wird wieder zerstreut. Was sich getroffen hat und eine Zeit lang unzertrennlich schien, geht wieder auseinander.
Wir treffen uns hier, um gemeinsam zu praktizieren; und ein paar Stunden später ist der Raum, wo wir zusammen waren, wieder leer. Und so ist es mit allen Dingen und Situationen. Nichts davon bleibt – alles ist vergänglich.
Die Ursachen von Leid und Glück im eigenen Geist erkennend, stellt sich Sisyphos nicht mehr gegen die Vergänglichkeit und den Tod und damit gegen das göttliche Gesetz. Er lässt alles los, an dem er mühevoll festgehalten hat, und läuft irgendwann nicht mehr flüchtigen Erscheinungen hinterher wie ein Narr.
Hermann Hesse schreibt in einer seiner Erzählungen, es sei alles so einfach. Die ganze Kunst sei, sich fallen zu lassen! Habe man das einmal getan, habe man einmal sich dahingegeben, sich anheimgestellt, sich ergeben, einmal auf alle Stützen und jeden festen Boden unter sich verzichtet, höre man ganz und gar nur noch auf den Führer im eigenen Herzen, dann sei alles gewonnen, dann sei alles gut, man habe keine Angst mehr, es bestehe keine Gefahr mehr.
Eine wunderbare Stelle, die genau den Kernpunkt beschreibt: Wenn wir selbst nichts mehr festhalten, dann ist alles befreit.
Dann ist der Fluch und auch das schwere Schicksal des Menschen »Sisyphos« aufgehoben, die nur in der eigenen Anhaftung bestanden.
Das Leben erscheint ihm nun auch öfter wie ein Traum und leicht – er träumt, dass er träumt; und sich beim Träumen beobachtend, erkennt er, dass alles, was ihn scheinbar hemmte, band und zwang, immer nur sein eigenes Denken, sein Widerstand und Begehren oder dessen Folge war. Er kommt zur Ruhe und irrt nicht mehr dahin in den Gängen des Labyrinths des Denkens, in seinem unbewussten Lebenstraum Vergnügen suchend und dem Leid entfliehend. Er tritt hinaus in die frische Luft der offenen Weite, und gleichsam über sich schwebend schaut er den Spielplan des Lebens. Das Labyrinth in seiner Gesamtheit schaut er dann in sich selbst, und schauend versteht er, wie eines aus dem anderen folgte und wo der Anfang und der Ausgang aus dem Labyrinth des eigenen Denkens sind und dass das torlose Tor zur Freiheit immer offen steht.
Alle Gedanken kommen aus dem Zustand des Nicht-Denkens, dem Ungeborenen, so erkennt er; und zu guter Letzt über alles Denken und Glauben, über jede Vorstellung hinausgehend, erfährt er alle scheinbaren Gegensatzpaare des Spiels, wie Leben und Tod, Ordnung und Chaos, Selbst und Welt, Schein und Sein und alle anderen dualistischen Konzepte und Wahrnehmungen als immer schon aufgehoben, immer schon vereint und erlöst in der alles umfassenden Weite des eigenen ungeborenen, unsterblichen Gewahrseins.
Wenn uns durch exzellente Belehrungen über das Wesen der absoluten Wirklichkeit des Geistes und der relativen Wirklichkeit seiner Wahrnehmungen, wie zum Beispiel die des Buddha Padmasambhava im Tibetischen Totenbuch oder die in buddhistischen Schriften wie dem Lankavatara-Sutra oder dem Diamant-Sutra und in Dzogchen-Texten wie dem Drönma Drug, den »Sechs Leuchten«, immer klarer wird, dass alles Erfahrbare, die Projektion, die Vorstellung des eigenen Geistes ist, so lösen sich all unsere Erwartungen, Erkenntnis, Liebe, Glück, Beständigkeit und Sicherheit im Außen auf, und wir erfahren den unaussprechlichen Sinn dieser Lehren in der Stille der Meditation.
Durch häufige Übung erlangen wir Vertrautheit mit unserem ursprünglichen Zustand; und heimgekehrt in uns selbst, wieder zur Ruhe gekommen im leeren Gewahrsein aller Buddhas, genießen wir die Fülle der Qualitäten des erleuchteten Geistes, und nichts und niemand kann sie uns mehr nehmen. Erst wenn wir völlige Luzidität erlangen, können wir inmitten der Fülle unserer Visionen frei von Selbstverblendung leben. Frei von Störgefühlen, frei von unnötigen Anstrengungen und frei von Leiden. Frei von dualistischen Gedanken sind wir glücklich, denn wir erfahren uns als eins mit allem und alles als eins mit uns.
Das ist der Erfahrungsmodus eines Buddha, eines völlig erwachten Wesens. Das ist der höchste Level von Lebenskunst und Sterbekunst, und alle Kunst und jede Methode können dann vergessen werden.
Ein altes chinesisches Zen-Gedicht sagt: »Das Wort des Buddha hilft uns, des Denkens Raum zu überqueren. Ist still geworden der Gedanken Spiel, was braucht es dann noch des Buddha Lehren?«
Wenn wir glücklich sind, ohne glücklich sein zu wollen, wenn wir nichts anderes mehr wollen als das, was wir bereits haben. Nichts anderes mehr werden wollen als das, was wir bereits sind.
Zurückgekehrt zum Urzustand des Geistes, luzide, wie vor dem Fall in die projektive Fehlwahrnehmung, sind wir eins mit der Wahrheit, eins mit Gott. Und alles Gute in uns selbst besitzend, verstehen wir nicht mehr, wie wir auf das Zukunftsversprechen der Schlange im Paradies, »Ihr werdet sein wie Gott und Gutes und Böses erkennen«, dieses falsche Versprechen, das uns ins Werden und damit in die Illusion einer linearen Zeit und in den zwanghaften Prozess dualistischen Denkens und Werdens geführt hat, jemals hören konnten. Auch dies ist eine gleichnishafte Szene und ein starkes Bild dafür, wie wir in den nichtluziden Modus der Fehlwahrnehmungen geraten sind.
Die Dzogchen-Lehren zu diesem Thema sind außerordentlich detailliert, und wir werden hier immer wieder davon sprechen, denn nicht nur am Anfang unseres persönlichen »Geistesstroms« vor vielen, vielen Leben, sondern am Ende jeder Verkörperung geschieht dieser »Fall«, dieser Verlust der Luzidität erneut, und er geschieht nicht nur dann, sondern in jedem Augenblick, wenn wir auf die uns spontan begegnenden Erscheinungen mit dualistischer Konzeptualisierung und mit widerstreitenden, neurotischen Gefühlen reagieren.
Deshalb: »Lasst uns über alle Vorstellungen hinausgehen, darüber hinaus und noch jenseits des Darüberhinaus und völlig erwachen. So sei es!«
Gate Gate Parasamgate Bodhi Svaha!
Mit diesen Worten am Ende des Herz-Sutras, welches viele Male am Tag in jedem Zen-Kloster rezitiert wird, bekräftigen wir unsere Motivation zum Wohl aller Wesen, die vollkommene Erleuchtung zu realisieren, um so fähig zu werden, allen Wesen zu ihrer ursprünglichen Freiheit zu verhelfen, wissend, dass sie im Grunde bereits frei und erleuchtet sind!