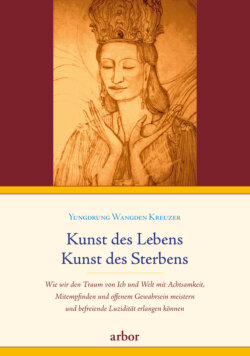Читать книгу Kunst des Lebens, Kunst des Sterbens - Yungdrung Wangden Kreuzer - Страница 21
Der Vergänglichkeit aller Erscheinungen gewahr werden
ОглавлениеDer Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids – und ein Quell unendlichen Trostes.
Marie von Ebner-Eschenbach
The golden leafs, that jewell the ground,they know the art of dying,they leave with joy their glad gold hearts,in the silent shadow lying.
The Incredible String Band
Wer sich der Vergänglichkeit gewahr wird, dem schwindet aller Lebensdurst dahin.
Tantra der Vereinigung von Sonne und Mond
Von allen Spuren ist die des Elefanten die größte. Von allen Achtsamkeitsmeditationen ist die, der Vergänglichkeit gewahr zu sein, die höchste.
Buddha Shakyamuni
Woran der eine leidet, weil es seiner Anhaftung und seinem Streben zuwiderläuft, das ist dem anderen Anlass zur Freude und ein ständiger Garant der sicheren Erlösung alles Seienden.
Möchten wir nicht alle, dass etwas für uns Schmerzliches möglichst schnell vorübergeht, und sind wir dann nicht froh über Vergänglichkeit; und wer wünschte sich nicht, dass ein glückliches Erleben länger dauern möge und dass uns Abschied, Verlust und Tod noch lange nicht ereilen?
Alle Wesen fliehen das Unangenehme und wollen es nach Möglichkeit nicht mehr erleben, und sie suchen das Angenehme und wollen es immer wieder erleben und wiederholen.
Das ist auch aus der Verhaltensforschung gut bekannt, und der Mensch reagiert hier nicht anders als alle anderen fühlenden Wesen. Genau das verbindet uns, und dieses Fühlen und Sich-Hinfühlen an das Glück als optimaler Erlebensmodus ist die Basis für alles Mitgefühl und für alles aus der Empathie wachsende Verstehen des Sinns.
Die Verdrängung der Vergänglichkeit kontrastierend, ja, die Vergänglichkeit als Lehrer in der Lebenskunst des Nicht-Verweilens und als sublime, von allem Angenommenen befreiende Tröstung erkennend, nimmt der Mensch, der sich geistiger Einsicht und Selbsterkenntnis öffnet, den »Bruder Tod« als ständigen Wegbegleiter an. Ohne einen vorzeitigen Tod zu suchen, stellt er sich der Herausforderung, der Entmachtung des Egos in der Krankheit und akzeptiert das Altern und die Schwächung des Körpers in der letzten Lebensphase, und er reift durch sie.
Der Vergänglichkeit und der Vanitas aller Erscheinungen gewahr, können wir uns gewiss sein, dass es, wie in den Worten des Ave Maria so wunderbar ausgedrückt, in dieser Welt nur zwei Momente gibt, die uns sicher sind: »das Jetzt« und »die Stunde unseres Todes« – nunc et hora mortis nostrae. Genau jetzt, in diesem präzisen, ewigen Augenblick reinen Gewahrseins, sind Leben und Tod eins, sind Form und Formlosigkeit eins, wenn wir in nichts verweilen.
In etwas zu verweilen ist Evasion, ist Erinnerung oder Erwartung und Festhalten an der fixen Idee von etwas Bleibendem in einer fließenden Welt, die uns in jedem Augenblick entschwindet und ihre Vergänglichkeit beweist. Als menschliche Wesen fühlen wir eine ungreifbare Unzufriedenheit und Unsicherheit in uns, die daher rührt, dass wir nicht wirklich wissen, was und wer wir sind.
Natürlich zeigen wir unsere Unsicherheit nicht gern, lassen es nicht gern an die Oberfläche kommen oder sich äußern, aber es nagt an uns, denn wir fühlen, dass wir unserem Selbstbild nicht trauen können, ist es doch recht zerbrechlich und muss mühsam gegen Selbstzweifel und Kritik von außen geschützt werden. Wir spüren, dass diese Vorstellung von uns selbst etwas sehr Ephemeres ist – etwas Konstruiertes, das immer bedroht ist von Auflösung. Wir erzählen uns ständig selbst, was wir sind, und unsere inneren Dialoge basieren alle auf der Annahme, dass wir etwas Besonderes sind – verschieden von der Welt und anders als die »anderen«, besser als die anderen oder auch schlechter. So oder so – es ändert nichts an unserer Grundauffassung; denn diese Vorstellung, getrennt und anders zu sein, ist die Basis unseres Selbstbewusstseins, und sie ist der Grund für unser Ichgefühl und seine inhärente Unruhe.
Die Überzeugung, ein abgetrenntes Ich zu sein, wird ausgeschmückt, gestärkt und genährt von falschen Identitäten oder Selbstvorstellungen wie »Ich bin … so und so« oder »Nein … so und so bin ich nicht«. Was immer wir von uns glauben, die Meinung, die wir von uns selbst und unserer Geschichte haben und bewahren, sehen wir in wunderbarer Weise auch von unserer Umgebung bestätigt. Unsere Ausstrahlung oder Projektion strahlt zurück auf uns selbst. Auch ist unsere Konstruktion verknüpft mit der Vorstellung, die sich unsere Eltern und andere uns prägende Personen über uns gebildet, geäußert oder nicht, und bewusst oder unbewusst, in grober oder subliminaler Form auf uns übertragen haben. Es ist deshalb ein schwieriges Unterfangen und eine große Herausforderung, die Illusion des eigenen Ichs und seiner Überzeugungen und Glaubenssätze zu dekonstruieren. Immer wenn wir »über uns selbst« nachdenken, wird unser Ich aufgeladen; und jeder dieser selbstbezogenen Gedanken ist wie ein neuer Stein, der, ob wir es bewusst tun oder unbewusst, unser illusorisches Selbstbild untermauert.
Aber gleichzeitig ist in uns der berechtigte Verdacht, dass diese Konstruktion sehr zerbrechlich ist. Wir identifizieren uns gewohnheitsmäßig und ganz selbstverständlich mit den fünf Komponenten oder »Skhandas« unseres Erlebens, das heißt also mit unserem Körper, unseren Empfindungen, unseren Gedanken, mit dem, was wir mögen und nicht mögen oder wollen, und mit dem Bewusstsein, das diese Erlebnisse verarbeitet. Hierbei ergreifen wir vor allem unser Denkbewusstsein, obwohl es selbst ja nur eine Wahrnehmung ist, fälschlicherweise als den Wahrnehmenden. Dieser Wahrnehmende sagt: »Ich habe das so oder so empfunden.« Dieses Ich sagt: »Ich finde das gut.« Oder: »Ich finde das nicht gut, weil …« Und so weiter.
Nun wird die Identifikation mit dem Körper belastend und erzeugt Leid, wenn wir eine schiefe Nase haben oder wenn wir altern und unser Bild im Spiegel immer mehr Falten bekommt, während unsere Identifikation mit Vorstellungen belastend und anstrengend, ja beängstigend und leidvoll wird, wenn diese infrage gestellt oder kritisiert werden. Das Leben arbeitet mit seiner Vergänglichkeit immer daran, uns zu enttäuschen und uns jeden falschen Halt zu nehmen. Und unsere innere Weisheit, die nicht zulässt, dass wir uns selbst betrügen, und die uns nicht erlaubt, in Lüge und Unwahrheit oder falschem Handeln Ruhe zu finden, zeigt uns mit Unzufriedenheit und seelischer Unruhe, dass etwas in uns nicht stimmt und nicht mit dem »Sinn«, dem »Tao« in Einklang ist. Auf diese Unzufriedenheit über das eigene Leben oder »Dukkha« können wir reagieren. Wir können sie verdrängen und versuchen, sie mit mehr Aktivitäten und Zerstreuungen zu überdecken, und damit vor uns selbst fliehen. Doch dadurch wird die Spannung der Grundangst eher verstärkt. Je mehr man verdrängt und sich verteidigt, umso dicker ist der Panzer, in dem man sich eingeschlossen wähnt, und umso größer die Verletzlichkeit und Angreifbarkeit.
»Fliehe den furchtbaren Herrn des Todes nicht, sondern erkenne, dass er deine eigene Vorstellung ist – er ist nur deine eigene Projektion. Niemand kann dir schaden, denn Leerheit und Offenheit ist deine wirkliche Natur, und diese Leerheit und Offenheit ist dein bester Schutz.« So lehrt Padmasambhava im sogenannten Tibetischen Totenbuch, das recht eigentlich ein Buch der höchsten Lebensweisheit ist. Seine Instruktionen sind in allen Erlebnisformen des Geistes gleichermaßen gültig und befreiend, denn alles, was erfahrbar ist, das ist wandelbar, ist leere Vision. Und ob sie uns bindet oder nicht, liegt im Grunde ganz bei uns. Wenn wir glauben, dass etwas existiert, dann ist es für uns wirklich und wirksam.
Wenn wir an etwas festhalten und darauf bestehen, kann niemand es uns nehmen. Wenn wir es loslassen, kann niemand es mehr halten und darauf bestehen.
Nun ist eine andere, durchaus förderliche Art mit dieser Unzufriedenheit, mit diesem nagenden Zweifel, mit dieser Fragwürdigkeit von allem umzugehen, sie nicht zu fliehen, sondern sie anzunehmen und eins zu werden mit der Sinnfrage. Damit fliehen wir nicht mehr vor unserem höheren Selbst und kreisen an der Peripherie gedanklich um uns selbst, mit einem oberflächlichen, unbewussten Spiel von Frage und Antwort beschäftigt. Sondern uns selbst und alles bereitwillig infrage stellend, können wir uns dem zentrifugalen Sog einer objekt- und antwortlosen Kognitivität hingeben, einem Feuer reinen Erkennens, das alle Gegenstände zerstört und alle Projektionen in seine Quelle, in das gestaltlose Licht des Geistes zurückführt.
Uns selbst infrage zu stellen mit den Worten »Wer bin ich?« lockert den Knoten des »Selbstbilds«, befreit uns von einschränkenden Konstrukten und falschen Sicherheiten und führt uns direkt zurück zum reinen Gewahrsein, zu unserem wahren, selbstlosen Selbst zurück. Dieser Weg zur Verwirklichung und Luzidität ist nichts Neues und auch keine Theorie unter vielen. Es ist der Weg, der aus der unbewussten, instinktiven Projektion direkt zurück zum Projektor führt.
Bleibt unser Blick nach außen gerichtet, so hat unser Suchen und Forschen kein Ende, denn das Licht erschafft immer neue Träume, beleuchtet immer neue Gegenstände. Nur wenn wir das Licht der Aufmerksamkeit zurückwenden auf uns selbst, entdecken wir den Schöpfer aller Dinge, und all unser Suchen ist zu Ende.
Der Ursprung des Universums ist nicht außen, die Welt entsteht hier in diesem Augenblick im eigenen Geist, und wie es in der Tabula Smaragdina heißt, ist alles eins, und durch das Denken des einen ist alles entstanden.
Buddha hat diesen Weg der Selbsterkenntnis durch Selbsterforschung selbst beschritten und nach seiner Erleuchtung gelehrt, welcher uns das eigene Selbst als leer, als ichlos und frei von jeder Form erkennen lässt. Zahllose Wesen haben auf ihm bereits völlige Erleuchtung und Befreiung vom Leid verwirklicht.
Im Anenjasappāya-Sutta heißt es: »Die edle Befreiung ist das Aufhören von Verlangen und Anhaftung. Diese ist frei vom Tod – sie ist die Befreiung des Geistes durch Nicht-Anhaften.« Wenn man die unterbewussten Tendenzen, die zur falschen Annahme eines Ichs verleiten, völlig auflöst – also alle und jegliche Konzepte des »Ich bin« –, dann gibt es auch »niemanden« mehr, der sterben könnte. Dieses Aufhören der »Ströme des begrifflichen Nachdenkens« über das eigene, vorgestellte Ich und der daraus resultierende Friede, der leer ist von Geburt, von Alter und Tod, wird vom Buddha im Dhatuvibhanga-Sutta erklärt:
»Zur Ruhe ist einer gekommen, wenn die Wellen konzeptuellen Denkens sich gelegt haben; und wenn dieses begriffliche Denken in ihm aufgehört hat, wird einer ein Weiser genannt, der Frieden gefunden hat. Warum hat dieser Frieden gefunden, und von was ist er frei? Ihr Mönche – ein solcher ist frei von der Vorstellung ›Ich bin‹, er ist frei von der Vorstellung ›Ich werde sein‹, er ist frei von der Vorstellung ›Ich werde nicht sein‹. Er ist frei von der Vorstellung ›Ich werde eine Form haben‹, ›Ich werde formlos sein‹, ›Ich werde wahrnehmen‹, ›Ich werde nichts mehr wahrnehmen‹, ›Ich werde weder etwas wahrnehmen noch nichts wahrnehmen‹ – denn auch das ist eine Vorstellung. Vorstellung ist eine Krankheit, Vorstellung ist wie ein Cancer, Vorstellung ist wie ein Pfeil, der verwundet. Wenn ein Mensch jenseits allen Vorstellens und begrifflichen Erfassens geht, so wird er zu einem Weisen, der Frieden erlangt hat. Ein solcher Weiser im Frieden wird weder geboren, noch altert er, noch stirbt er.
Er wird von nichts beunruhigt und er ist frei von Verlangen. Deshalb hat er keine Ursache, keinen Beweggrund, geboren zu werden.
Weil er nicht geboren wird, wie könnte er altern? Weil er nicht altert, wie könnte er sterben?
Nicht sterbend, unsterblich, was könnte ihn beunruhigen? Von nichts beunruhigt – wie könnte Verlangen in ihm entstehen?«
Hier zeigt der Buddha auf den Geisteszustand eines Menschen, der endgültigen Frieden erlangt hat. Und wir können daran ablesen, ob wir selbst für solchen Frieden schon bereit wären oder wo und wie wir noch an Vorstellungen und Dingen festhalten und unsere Unruhe damit selbst bewirken.
Hinter der Maske unserer sterblichen »Persona« steht der, der durch sie hindurchschaut, durch sie hindurchspricht, der, der sie tragen oder fallen lassen kann. Denn das kleine Selbst ist nichts als die Gestalt und Vorstellung, die wir von uns selbst haben, und es definiert sich durch die verschiedenen Rollen, die wir im Leben spielen. Wenn wir an diesen festhalten, erleben wir uns als sterblich und als beunruhigt – wenn wir sie loslassen, als unsterblich und in Frieden.
Nun wird diese falsche Identifikation mit unserer Person oder den fünf Skhandas vor allem durch ihre Vergänglichkeit und durch den Tod immer wieder heilsam infrage gestellt. Der große Zen-Meister Hakuin Zenji empfahl seinen Schülern deshalb: »Heftet dieses eine Wort ›Tod‹ zwischen eure Augenbrauen, und behaltet es Tag und Nacht im Sinn. Egal, ob ihr steht, sitzt oder liegt, fragt euch ständig: ›Was bin ich, wenn mein Körper tot und verbrannt ist?‹«
»Was bleibt von mir, was bleibt von diesem Leben?«, so fragt sich wohl jeder, der mit seinem baldigen Tod konfrontiert ist und damit, Abschied nehmen zu müssen. Hakuin empfiehlt uns, auch diese Frage nicht zu verdrängen, sondern direkt in sie hineinzugehen und völlig eins mit ihr zu werden. Er schreibt weiter: »Diese Frage wird euch als Schlüssel zu jener Dimension dienen, wo ihr frei von Geburt und Tod seid und wo ihr, wie der unzerstörbare Diamant, nicht alternd und niemals sterbend euer ungeborenes, unsterbliches Vajra-Wesen erkennt.«
Damit wirklich ein tiefer Wunsch in uns entsteht zu praktizieren, um den instinktiven Kreislauf des Denkens und damit den zwanghaften Kreislauf vom Geborenwerden und vom Sterbenmüssen zu überschreiten, müssen wir die vergängliche Natur des Lebens wirklich an uns heranlassen und realisieren, dass der Freund, dem wir gestern noch die Hand geschüttelt haben, vielleicht morgen schon tot ist – wie viele andere unserer Bekannten auch – und dass es für uns selbst natürlich nicht anders ist, insofern es keinerlei echte Garantie gibt, nur eine eingebildete und erhoffte, dass wir selbst noch lange leben werden.
Die Augenblicke, in denen wir angerührt sind vom Tod und uns die eigene Sterblichkeit bewusst wird, sind ein kostbarer Stimulus, um das Ausmaß unserer Anhaftung an banale Zerstreuungen und Zeitvertreibe zu erkennen und infrage zu stellen. Die Geistesschulung, egal, ob christlich, hinduistisch oder buddhistisch, verlangt von den Übenden, aller verdrängten Ängste und Anhaftungen, aller Gedanken und Gefühle durch die fortgesetzte Pflege von Geistesruhe, Wachheit und Selbstbeobachtung gewahr zu werden. Wenn wir sie direkt anschauen, können wir sie als das erkennen, was sie sind, und uns von unheilsamen karmischen Spuren und Gewohnheitstendenzen reinigen.
Alles Unbewusste kann, wie sonst nur post mortem möglich, bereits jetzt hervorkommen und jede Erfahrung, ob als Freude oder als Leid empfunden, wird uns zum Brennstoff, um das heilige Feuer des reinen Gewahrseins zu nähren.
Wenn wir lernen, allen Erfahrungen mit Gleichmut zu begegnen, ohne das eine festzuhalten und das andere zu verdrängen, erkennen wir deutlicher die wahre Natur aller Erscheinungen als die Untrennbarkeit von Form und Leere. Alle Phänomene sind gleichermaßen reine Energie – der Stoff, aus dem alle Träume sind, und schön und hässlich, angenehm und unangenehm sind nur Zuschreibungen gewesen, die der unterscheidende Verstand sich selbst gemacht hat.
Betrachten wir sie frei vom begrifflichen Denken, haben alle Dinge, scheinbar so verschieden, denselben Sinn und denselben Geschmack von Klarheit, Seligkeit und Leerheit. Es ist der Geschmack der unbegrenzten, undefinierbaren Freiheit aller Dinge und des Geistes.
Der Mensch, der den Tod verdrängt und dem die Kostbarkeit und Begrenztheit seiner Lebenszeit deshalb nicht bewusst sind, hat meistens die Neigung dahinzuleben, als würde er ewig leben. Der Buddha hat deshalb empfohlen, sich der eigenen Sterblichkeit täglich mehrmals zu erinnern, um den daraus entstehenden Impetus für die Praxis zu nutzen.
Die ruhige, nichturteilende Achtsamkeit auf die »vergänglichen Natur« all unserer Erfahrungen, anicca, in jedem Augenblick neu und frisch, ist die grundlegende Praxis des Vipassana, die uns durch direkte Wahrnehmung aus der konzeptuellen Fantasiewelt eigener Erwartungen und Befürchtungen zurückführt in die Wirklichkeit des ewigen Jetzt. Deshalb sagte der Buddha: »Von allen Spuren ist die des Elefanten die größte. Von allen Achtsamkeitsmeditationen ist die, der Vergänglichkeit gewahr zu sein, die höchste.«
Nach Buddhagosha, dem Verfasser des Vishuddhimagga, des »Pfads der Reinheit«, gibt es nur zwei meditative Praktiken, die jederzeit, überall und in den verschiedensten Situationen der inneren Entfaltung förderlich sind. Diese sind erstens die Kultivierung des unendlichen Wohlwollens für alle Wesen durch den Gedanken »Mögen alle Wesen glücklich sein« und zweitens das Gewahrsein der Vergänglichkeit und die Erinnerung des Todes. Auch wenn dies dem normal weltlichen Empfinden zuwiderläuft, oder besser gerade deswegen, verhilft uns die wache Achtsamkeit auf das, was gerade ist, dazu, in jedem Augenblick präsent und lebendig zu sein und nicht in einer eingebildeten, konzeptuellen Vergangenheit oder Zukunft zu leben.
Wenn wir uns betrachtend und kontemplativ mit Vergänglichkeit sowie mit dem Prozess des Sterbens und dem Postmortem vertraut machen, so tun wir dies mit einer Achtsamkeit, die aller dabei aufsteigenden Emotionen, auch der Angst zu sterben, gewahr ist und können dadurch immer tiefere Schichten des Unbewussten erkunden und belichten. Wir verstehen daraus, dass das Beängstigende eigentlich nicht das Sterben und der Tod ist, sondern die falsche Vorstellung, die wir davon haben. Indem wir uns bewusst in das Szenario des Sterbens versetzen, können wir experimentell die Angst vor Kontrollverlust und vor dem Unbekannten kontaktieren und zulassen und gleichzeitig erfahren, dass der Spiegel unseres Gewahrseins von jeder Erfahrung unverändert bleibt. Wir entdecken unsere Unsterblichkeit, wenn wir unser Sterben und Geborenwerden beobachten. Der tibetische Buddhismus hat die therapeutische Technik der Exposition im Rahmen von Fantasiereisen und kreativer Visualisationen bereits mehr als tausend Jahre vor deren Wiederentdeckung in der modernen Psychotherapie angewandt.
Ein anderes Beispiel hierfür ist die selten geübte, vorbereitende Dzogchen-Übung des »äußeren Ru-shän«, bei der wir uns in einer längeren Klausur imaginativ nacheinander in die Lebens- und Leidenssituationen der Wesen in der Menschenwelt, Götterwelt, Tierwelt, in die der hungrigen Geister und der Wesen in der paranoiden Erlebniswelt der Hölle hineinversetzen. Wir können dabei die karmischen Spuren dieser Erlebnisse aus vielen Reinkarnationen aus unserem Unterbewusstsein nach oben bringen und spontan ausagieren. Diese Erfahrungsspuren sind in feinstofflicher, energetischer Form in unseren Chakras gespeichert.
Indem wir gleichzeitig luzide bleibend erkennen, dass wir wie ein Spiegel von seinen Reflexionen von all diesen Erfahrungen immer frei sind und waren, reinigen wir uns von diesen Spuren durch authentische Selbsterkenntnis, und wir vertiefen gleichzeitig unser Mitgefühl mit allen Wesen der sechs Bereiche.
Es ist der Gedanke an den Tod, der uns an die Kostbarkeit dieses Lebens erinnert und mit Dringlichkeit ermahnt, im gegenwärtigen Augenblick voll bewusst zu leben und zu handeln. Es ist der Gedanke, dass wir morgen bereits tot sein können, der die nach außen gerichteten Triebkräfte des Egos kontrastiert und die Rückwendung auf unser unvergängliches, betrachtendes Gewahrsein inspiriert. Longchenpa rät uns deshalb: »Selbst wenn du nun das, was so schwer zu erlangen ist, nämlich diese menschliche Geburt, endlich gefunden hast – auch dieses Leben wird nicht lange dauern und kann jederzeit plötzlich zu Ende sein. Und weil du dem, was wie eine Luftblase ist, nicht vertrauen kannst – erinnere dich Tag und Nacht an die Gewissheit deines Todes!«
Da wir geneigt sind, den Tod zu verdrängen und die Praxis gern auf morgen verschieben, empfiehlt uns die buddhistische Geistesschulung, jeden Tag mit einem kurzen Resümee der folgenden Punkte zu beginnen. Wenn wir sie präzise drücken, schmerzt es etwas, aber sie versetzen uns in eine realistische Perspektive und frische Geistesgegenwart, die eine gute Grundlage für einen neuen Tag in intensiver, heilsamer Praxis der Achtsamkeit und Luzidität bildet:
Es ist unvermeidlich, dass dieser Körper sterben wird und ich ihn verlassen muss.
Die mir gegebene Lebenszeit wird täglich und stündlich geringer.
Die Zeit, die mir noch zur Selbstentwicklung zur Verfügung steht, ist begrenzt.
Wann meine Todesstunde kommt, ist ungewiss, wo es sein wird und wie und durch was der Tod verursacht wird, ist unsicher. Aber dass er kommt, ist sicher.
Es gibt viele Ursachen, die zum Tod führen können, denn der menschliche Körper ist sehr anfällig und verletzlich.
Nur das, was ich durch die Schulung und Reinigung meines Geistes realisiert habe, kann mir im Tod und im Postmortem helfen.
All mein Geld und Besitz und alle äußeren Mittel und Objekte können mir dann nicht helfen. Im Gegenteil, ich will mich frühzeitig von ihnen lösen, um nicht von meinem Haften daran im Sterben irritiert und herabgezogen zu werden.
Nur unsere Taten folgen uns nach. Deshalb will ich mich heute in der Ansammlung von Weisheit durch Studium und Meditation und in der Ansammlung von Verdiensten durch heilsame Gedanken, Worte und altruistische Handlungen üben.
Freunde und Angehörige können mir in der Todesstunde nicht helfen. In der Gegenwart meines wahren Selbst will ich eute leben und mich unzerstreut und liebevoll auf die unvergängliche Zuflucht, die Quelle des Segens und der Erleuchtung, den »Herrn des großen Mitgefühls« ausrichten.
»In deine Hände lege ich meinen Geist« – das sei mein letzter, liebevoller Gedanke im Augenblick des Todes; und mit der letzten Ausatmung will ich in seiner Gegenwart sein und aus dem Traum dieses und aller anderen Leben endgültig erwachen!
So oder ähnlich sind die heilsamen, ernüchternden Betrachtungen, die uns von der prekären Anhaftung an vergängliche Erfahrung heilen und unserem Streben nach Selbsterkenntnis und bleibendem Glück die Richtung weisen können.
Eine klare, vor dem Tod schon kultivierte Richtung, wohin wir nach diesem Leben gehen wollen, ist wichtig. Anderenfalls sind wir wie Reisende auf einem Bahnhof, die vergessen haben, wohin sie fahren wollten. Sie werden folglich einem spontanen Einfall oder der Anregung eines Mitreisenden, sprich, sie werden ihren früheren Prägungen folgen, genau wie in einem nichtluziden Traum.
Longchen Rabjam lädt uns ein, nachdem er die idealen Umstände einer Eremitage inmitten der Natur beschrieben hat, wo unser Geist zur Ruhe kommen kann, zunächst die Wandlungen in unserer Umgebung zu beobachten und Anlass für weitere Realisationen der Vergänglichkeit werden zu lassen. Er schreibt: »Nachdem du dir deinen Sitz bereitet, ihn eingenommen hast und zur Ruhe gekommen bist, beobachte das Knospen, Blühen, Reifen, Welken, das Herabfallen und die Auflösung der Blätter der Bäume um dich herum, und realisiere, dass auch dein Körper, deine Jugend, die Sinne und alles Erworbene sich ständig ändern und hinfällig sind. Wie die Blätter sich trennen vom Baum, so werden auch deine Freunde, Feinde und dein Körper und alles, woran du hängst, unaufhaltsam von dir abfallen und verloren gehen. Siehst du ausgetrocknete Lotosteiche, so realisiere, dass alle Objekte des Begehrens, dass Reichtum und Wohlstand sich wandeln und alles, was angesammelt wurde, wieder zerstreut wird. Die Stunden, Tage, Monate und Jahreszeiten vergehen ohne Halt, und wie diese Frühlingsblumen, so vergeht auch dein blühender Körper. Ihre jugendliche Erscheinung verwelkt, und der Herr des Todes kommt bestimmt. Und so, wie reife Früchte herabfallen, so sterben Junge und Alte, wenn ihre Zeit gekommen ist. Der Zeitpunkt des Todes ist nicht sicher, doch sicher ist es, dass alles, was geboren wurde, sterben muss. Siehst du die Spiegelungen der Dinge auf einer ruhigen Wasserfläche, so realisiere, dass alle Phänomene zwar erscheinen und doch, wie diese Spiegelungen, keine greifbare Existenz, keine eigene Wirklichkeit besitzen.«
Wenn wir die Vorgänge und Wandlungen in den Erscheinungen der Natur beobachten, so wird uns dieses ständige Werden und Vergehen immer deutlicher erlebbar. Und wenn wir uns Zeit nehmen und ruhig und entspannt sitzend, achtsam, der Bewegungen unseres Atems, der Körperempfindungen, der Gefühle und des Fließens unserer Gedanken gewahr werden, erlangen wir eine unmittelbare Erkenntnis der Natur all dieser Phänomene. Durch reine, unvoreingenommene Beobachtung erkennen wir: Alles ist vergänglich. Das Panta rhei des Heraklit, das »Alles fließt«, ist ein einfaches Resümee dieser empirischen Beobachtung. Werden und Vergehen sind die Wellenbewegung dieses Stroms des Lebens. Eine Welle oder Erscheinung formt sich und sinkt wieder ins Formlose zurück. Das, was Form annimmt, ist Energie, der Atem des Lebens; und wenn sie sich auflöst, kehrt diese geformte Energie wieder zurück in das formlose Meer der Lebensenergie, in das, was die Alten mit »Chaos« meinten. Heutige Physiker nennen es das »Quantenfeld« oder die »Matrix«, und auch sie sagen, dass von dieser gesamten Energie des Universums nie etwas verloren geht. Jede Erscheinung ist ihnen eine Welle dieser Energie, die nur dann scheinbar Form annimmt, wenn sie in einem Bewusstsein erscheint. Unbeobachtet aber bleibt sie in ihrem formlosen, nicht wahrnehmbaren Zustand. Max Planck zog daraus den Schluss: »Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen.« Mit anderen Worten: Alles erscheint so, wie es von einem spezifischen Bewusstsein und Sensorium aus wahrgenommen wird.
Diese neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik stimmen in auffallender Weise mit dem überein, was buddhistische Texte bereits vor etwa zweitausend Jahren über das Wesen der Wirklichkeit aussagten. Im Herz-Sutra heißt es: »Form ist Leere, und Leere ist Form, mit Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein verhält es sich ebenso.« Es wird hier auch gelehrt, dass das eigentliche Wesen des Geistes und eines jeden Phänomens unerkennbar ist, nur die Wahrnehmung desselben ist erkennbar.
Zusammenfassend können wir sagen, dass ein Mensch, der jede Welle und Erfahrung gleichzeitig als reine, formlose Energie erkennt, ein ganzheitliches, der nichtdualen Wirklichkeit entsprechendes Verständnis besitzt. Und wer weder an Form und Idee noch an Formlosigkeit oder Leerheit haftet, der ist dieser Lehre nach wahrhaft frei.
Laotse formulierte dies im Taoteking wunderbar mit den Worten: »Verlieren und wieder verlieren – das ist der Weg des Tao.«
Niemand wird ernsthaft bezweifeln, dass alle Dinge und Bewusstseinszustände vergänglich und fließend sind, das ist die offensichtliche, für jeden nachprüfbare Natur aller Phänomene. Folglich befinde ich mich in Übereinstimmung mit der Natur, wenn ich an diesen nicht anhafte und sie nicht festzuhalten versuche. Wenn ich aber an ihnen zwanghaft anhafte, so wie wir es normalerweise gewohnt sind, so handle ich in unvernünftiger Weise gegen die Natur, und Disharmonie und Leiden sind die natürliche Folge. Wenn ich diesen Fehler in meinem Verhalten erkannt habe und mich von der Gewohnheitstendenz befreit habe, ihn zu wiederholen, ja, mich stattdessen daran gewöhnt habe, an nichts zu haften, so kann auch das damit verbundene Leiden enden.
Ein Zen-Schüler fragte: »Wie kann ich Buddhaschaft erlangen?«
Der Meister antwortete: »Folge dem Strom.«
Wenn wir also an Leben und Erlebtem nicht haftend, losgelöst von allen Formen und Gedanken, die hohe Kunst verstehen, dem Leben gleich, ständig fließend in nichts zu verweilen, erreichen wir frei von Fixierung höchste Lebendigkeit, Unsterblichkeit; und selbst formlos, sind wir dann frei, alle Formen spielend anzunehmen.
Das japanische Wort für einen Zen-Mönch ist Unsui – das heißt »Wolken und Wasser«. Wer es versteht, sich ganz zu lassen, dahinströmend wie Wasser und Wolken, der bleibt in der Wahrheit und im Fluss, und Glück und Heiterkeit strömen immer neu aus dem harmonischen Einklang mit dem ewig vergänglichen Wesen der Natur, und die fließende Welt des Samsara ist für diesen wahrhaft armen Menschen, für diesen ewigen Verlierer, so, wie sie ist, das zeitlose Nirvana des In-nichts-Verweilens.
Ein jeder Tag ist neu, ein jeder Augenblick ist neu und unter jedem Schritt weht eine frische Brise. Emaho! Wunderbar!
Buddha zu sein heißt, völlig vergänglich zu sein! Der Geist, der in nichts verweilt, weder in Leerheit noch in Form, weder im Leben noch im Tod, weder im Glück noch im Unglück, weder im Samsara noch im Nirvana – das ist der erlöste Buddha-Geist.