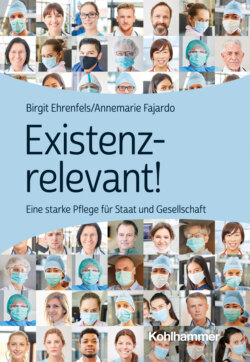Читать книгу Existenzrelevant! - Annemarie Fajardo - Страница 11
2.1 Pflege als Berufung
ОглавлениеIm Zusammenhang mit der Ausübung professioneller Pflege wird oft von »sich dazu berufen fühlen« bzw. von »Berufung« gesprochen, was bedeutet »für diese Tätigkeit besonders geschaffen oder begnadet zu sein« (Bünting, 1996, S. 163). Worin liegt aber die besondere Befähigung zur Pflege?
In Abgrenzung zu anderen Berufen weist der Pflegeberuf einige typische Besonderheiten auf.
Verantwortungsvolle Arbeit und Sinnhaftigkeit charakterisieren zwar auch Berufe bei der Polizei, Feuerwehr oder Sozialarbeit, aber die Pflege verkörpert eine enorme Vielfalt an Werten, die bei anderen Berufen nicht in dieser Konstellation zu finden ist.
Krankenpflege wird seit jeher durch die Werte Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gegenüber Kranken und Schwachen charakterisiert in Anlehnung an den christlich-humanitären Begriff der Barmherzigkeit (vgl. Lademann, 2018; Cassier-Woidasky, 2007; Baumhauer et al., 1983). Abgesehen von Freundlichkeit, taktvoller Distanz und Einfühlungsvermögen gegenüber Pflegebedürftigen wird dem Pflegepersonal ein »harmonisches Miteinanderwirken von Gefühl und Verstand, von menschlicher Zuwendung und der Anwendung medizinischen Wissens« (Baumhauer et al., 1983, S. 4) zugeschrieben. Krankenpflege wird dargestellt als »Dienst am Kranken« (Baumhauer et al., 1983, S. V) individuell, darüber hinaus aber auch als Dienst an der Gesellschaft allgemein, womit eine Gemeinwohlorientierung betont wird (vgl. Cassier-Woidasky, 2007).
Diese Werte und Eigenschaften gelten nach wie vor bei der Pflege. Nach wie vor sind alte, kranke, behinderte, arme und sozial schlechter gestellte Menschen auf Pflege angewiesen. Heutzutage wird von »personenbezogener Dienstleistung« gesprochen, also von einer auf den Menschen ausgerichteten Arbeit (Müller, 2018, S. 82). Auch die »menschenfreundliche« und »zugewandte Grundhaltung« (Müller, 2018, S. 83) der Pflegenden wird immer wieder betont.
Doch die Werte und Eigenschaften, die Pflege ausmachen, entsprechen nicht dem Zeitgeist des 21. Jh. und stehen ganz gewiss nicht im gesellschaftlichen Fokus. Wer denkt heutzutage über taktvolle Distanz und Einfühlungsvermögen nach? Außerdem haben die pflegetypischen Werte leider oft zu missverständlichen Interpretationen des Pflegeberufs geführt. Insbesondere der Aspekt des »Dienens« oder »Diensttuns« hat der Pflege oft eine unterwürfige Haltung gegenüber der Ärzteschaft und gegenüber einer bewusst künstlich geschaffenen Hierarchie nahegelegt, obwohl dazu überhaupt keine Veranlassung besteht und auch niemals bestanden hat. »Dienen« bedeutet in der deutschen Sprache »eine Aufgabe erfüllen«, »nützlich sein« (Bünting, 1996, S. 248). Darin liegt überhaupt nichts Unterwürfiges, ganz im Gegenteil. Welch wichtige Aufgaben die Pflege erfüllt und in welch außerordentlich hohem Maße sie nützlich ist, zeigt die aktuelle Coronapandemie. (Der vielfältige Nutzen der Pflege für Staat und Gesellschaft wird ausführlich erörtert in Kap. 3.)
Gleichzeitig kämpfen Pflegekräfte als Menschen, die ihrer Gesinnung nach eher freundlich zugewandt, taktvoll distanziert und einfühlsam sind, weniger für ihre eigenen Rechte, sondern setzen sich mehr für die Rechte derer ein, die nicht selbst für sich kämpfen können, also wiederum für die Alten, Kranken, Schwachen. Dieser Umstand, dass sich die Pflege in Deutschland sehr lange weitgehend zurückgehalten hat mit der Durchsetzung ihrer eigenen Wünsche und Interessen, hat ihre Unterentwicklung in unserem Land stark begünstigt.
Neben dem sichtbaren physischen Erfolg von Pflegemaßnahmen, der sich allerdings leider nicht bei allen Pflegebedürftigen einstellen kann, ist einer der schönsten Momente, wenn durch die Pflegemaßnahmen zwischen Pflegebedürftigen und Pflegekräften Vertrauen und Vertrautheit zustande kommen. Dieser Moment wird ausgedehnt zu einem bleibenden Vertrauensverhältnis, wenn bei länger andauernder oder sogar permanent dauerhafter Pflege Vertrauen und Vertrautheit wachsen und nicht missbraucht werden. Nicht selten entwickelt sich durch die Pflege eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen, wenn die Pflegemaßnahmen zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausgeübt werden. Die Beziehung wird oft gefördert durch die emotionale und mentale Unterstützung der Pflegekräfte, die sie den Pflegebedürftigen bieten. Das geht weit über die reine Durchführung von Pflegemaßnahmen hinaus. »Vielmehr wird Pflege mit einer zwischenmenschlichen Dimension, mit Beziehung und Interaktion verknüpft, in der beide Seiten, zu pflegender Mensch und Pflegeperson, in besonderer Weise miteinander verbunden sind« (Müller, 2018, S. 86). Diese besondere Verbundenheit entsteht i. d. R. bei der Pflege chronisch kranker, schwerbehinderter oder auch sterbender Menschen, oft in enger Beziehung nicht nur zu den Pflegebedürftigen, sondern auch zu deren Angehörigen.
Meistens wird zunächst durch eine wertschätzende Grundhaltung und durch Empathie, darüber hinaus aber auch durch das eigene Selbstvertrauen, durch das eigene Selbstbewusstsein und durch die eigene Charakterstärke den Pflegebedürftigen Halt und Zuversicht vermittelt. Wenn sich eine charakterstarke Pflegekraft mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt und sich ihrer eigenen Schwächen und Fehler bewusst ist, kann sie sich besser in die Pflegebedürftigen hineinversetzen und besser mit den Schwächen, Fehlern und Krisen der Pflegebedürftigen umgehen. Das ist besonders wichtig bei lang dauernden Pflegebeziehungen und bei der Pflege schwerkranker Pflegebedürftiger. Die Beziehung zwischen Pflegekraft und Pflegebedürftigen hängt dann sehr vom Selbst-Bewusstsein der Pflegekraft ab.
Von den Pflegenden erfordert Pflege ständig Selbstreflexion, Selbstkritik und den Mut zu dieser Auseinandersetzung mit sich selbst. Damit hängt auch zusammen, die eigenen Grenzen zu hinterfragen und sich selbst zu schützen vor Überanstrengung und Überforderung. Diese permanente Selbst-Prüfung macht den Pflegeberuf abgesehen von den äußeren Gegebenheiten sehr anstrengend. Mit jeder/jedem Pflegebedürftigen findet im Grunde automatisch dieser Prozess der Selbst-Prüfung statt, da die Pflegekraft durch die Pflege einen Spiegel ihrer eigenen Persönlichkeit vor sich hat.
Deshalb vertrete ich eine andere Position zu der Ansicht, dass Pflegende die eigenen Bedürfnisse »als nachrangig behandeln« und »zurückstellen« sollen (Müller, 2018, S. 81; Friesacher, 2008, S. 298; zit. n. Müller, 2018, S. 88). Ein Zurückstellen der eigenen Person und Bedürfnisse kann nur bedingt zeitweise, z. B. bei einem Notfall, angebracht sein. Wenn Pflegende während der Durchführung der Pflegemaßnahmen durch Selbstreflexion erkennen, dass sie aus irgendeinem Grund die Pflege nicht voll konzentriert und/oder nicht vollumfänglich so gut ausführen können, wie es erforderlich wäre, müssen sie umgehend Abhilfe schaffen und sich notfalls ablösen lassen. Sonst gehen sie einerseits das Risiko ein, Fehler zu verursachen und schlimmstenfalls den ihnen Anvertrauten Schaden zuzufügen, andererseits besteht die Gefahr, dass ein falsches Verständnis von Pflege als »dienendem« Beruf und die damit verbundene Aufforderung zur ständigen Selbstaufopferung die Pflegenden selbst auf Dauer krankmachen. Es können z. B. Burnout oder Gratifikationskrisen2 entstehen (vgl. Ulich & Wülser, 2010) und die Pflegekräfte können körperlich und seelisch erkranken.
Wenn aus irgendwelchen Gründen zwischen einer Pflegekraft und einer/-m Pflegebedürftigen die Beziehung nicht stimmt und keine gute Pflege möglich ist, so ist das keine Schande und keine Katastrophe. Dann muss sich die Pflegekraft entweder um eine Änderung der Beziehung bemühen oder sich ganz zurückziehen und durch eine andere Pflegekraft austauschen lassen. Entscheidend ist die Reflexion über die Situation und die rechtzeitige Änderung der Situation.
Pflegekräfte benötigen dazu viel Mut, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Vor allem auch in ihrem eigenen Interesse, um ihre eigene Situation richtig einzuschätzen, um gute Entwicklungen genauso zu erkennen wie schlechte und um Änderungen vorzunehmen, falls notwendig. Also wird eine qualitativ gute Pflege erst durch persönliche Reife möglich. Diese Reife fördert die Authentizität der Pflegekräfte und unterstützt den respektvollen, aufrichtigen, fairen und vertrauensvollen Umgang mit den Pflegebedürftigen. Der Dreh- und Angelpunkt der Pflege ist folglich die Persönlichkeit der Pflegekräfte. Diese bestimmt die Pflege: ist die Pflegekraft mit sich im Reinen, dann funktioniert ihre Pflege und ihre Beziehung zu den Pflegebedürftigen ist entsprechend gut. Ist die Pflegekraft inkongruent und nicht authentisch, wirkt sich das auf die Pflege und auf die Beziehung zu den Pflegebedürftigen negativ aus. Pflegekräfte müssen dazu dauerhaft die eigene Persönlichkeit möglichst im Gleichgewicht halten, d. h. die eigene Einheit aus Körper, Geist und Seele immer wieder ausbalancieren. Wem das gelingt, der kann Pflegebedürftigen mittels seiner eigenen Stabilität eine gute Stütze sein.
Bei keinem anderen Beruf muss zeitgleich während der praktischen Berufsausübung, die allein schon ein hohes Maß an Fachwissen, Können und Konzentration erfordert, dazu noch intrapersonal mit der eigenen Persönlichkeit so viel Bewältigungsarbeit und interpersonal auf zwischenmenschlicher Ebene so viel Beziehungsarbeit geleistet werden. Bauch (2005) spricht von »Gefühlsarbeit« oder »sentimental work«, die sogar beim Unterdrücken von Gefühlen geleistet werden müsse. Die Aufmerksamkeit der Pflegekraft wird während der Pflege nicht nur nach außen auf die Pflegebedürftigen, auf Angehörige und auf das Pflegeumfeld gerichtet, sondern während der Steuerung der Pflegehandlungen gleichzeitig nach innen auf ihre eigene Persönlichkeit, auf ihr eigenes Befinden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Grenzen. Denn während der Pflege werden Pflegekräfte oft an ihre eigenen Grenzen gebracht. Deshalb müssen sie unbedingt fähig sein, diese auch zu erkennen.
Die einerseits sehr komplexen intrapersonalen und andererseits sehr komplexen interpersonalen Vorgänge, deren mentale und emotionale Bewältigung während der Pflegetätigkeit viel Energie erfordern, laufen also bei gleichzeitiger Verrichtung der einzelnen Pflegemaßnahmen ab. Das macht diesen Beruf außergewöhnlich und überaus anspruchsvoll.
Pflege ist also ein enorm wert-voller Beruf. Zur Erfüllung dieser Werte kommen in der Berufsausübung bei den Pflegekräften zahlreiche Eigenschaften zum Tragen wie Freundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Geduld, Toleranz, Zugewandtheit, Einfühlungsvermögen, Scham- und Taktgefühl, Flexibilität, Sorgfalt, Vielseitigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Improvisationsfähigkeit, um nur einige zu nennen. Aber der ursprünglichen Aufgabe nach zeichnet sich Pflege vor allem aus durch Menschenliebe und Hilfsbereitschaft im Sinne von Fürsorglichkeit. Dies stellt eine persönliche Haltung gegenüber allen Menschen dar. Um in der Pflege gut und erfolgreich arbeiten und dabei der Menschenliebe und Fürsorglichkeit nachkommen zu können, ist aber die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstkritik unbedingt notwendig, weil die Pflegeperson in ihrer Fürsorglichkeit immer an die eigenen Grenzen stößt. Nur dadurch ist sie letztlich auch fähig zu Korrekturen ihrer Pflege oder Pflegebeziehung. Das macht Pflegende stark.