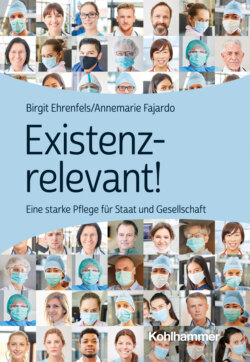Читать книгу Existenzrelevant! - Annemarie Fajardo - Страница 8
Vorwort
ОглавлениеNach einem viermonatigen Pflegepraktikum auf einer internistischen Station mit überwiegend alten Menschen, die einen Schlaganfall erlitten hatten und bettlägerig waren, stand für mich fest, dass der Pflegeberuf ein sehr anspruchsvoller und sehr wertvoller Beruf ist und dass ich möglichst viel über die professionelle Pflege lernen wollte. Gleichzeitig war mir klar, dass ich diesen Beruf, wenn ich ihn so ausüben wollte, wie es richtig gemacht wird und für die Kranken notwendig ist, wegen der körperlichen Belastung nicht lange würde ausüben können. Denn professionelle Pflege ist nun mal eine körperlich sehr schwere Arbeit, selbst mit Hilfsmitteln wie Lifter oder elektrische Betten, die aber Ende der 1980er Jahre noch gar nicht zur Verfügung standen. Während meiner Dienste ging ich regelmäßig mit einer der Pflegehelferinnen durch die Patientenzimmer und bettete die Kranken, lagerte sie um, machte sie frisch, wickelte bzw. topfte sie, wusch sie und zog sie um. Da die PatientInnen1 teilweise oder sogar vollständig immobil waren, waren diese grundpflegerischen Maßnahmen sehr anstrengend. Ich merkte, welche Verantwortung mit der Pflege verbunden war, welche Nähe sich durch die Pflege entwickelte und welches Vertrauen mir die PatientInnen entgegenbrachten, obwohl ich »nur« Praktikantin war. Während die Pflegehelferinnen (es gab nur weibliche Hilfskräfte) mit mir die körperlich schwere Arbeit machten, erledigten die examinierten Pflegekräfte andere Tätigkeiten wie Medikamente richten und verabreichen, Infusionen vorbereiten und anhängen, Verbände erneuern, Dokumentation schreiben. Die Examinierten machten sich manchmal darüber lustig, dass ich so engagiert war, dass ich mich so müde arbeitete durch das korrekte Betten der Kranken, dass ich auch nach dem x-ten Klingeln immer noch mal zu den Kranken ging und dass ich die Arbeit trotzdem gern machte. Sie prophezeiten mir keine lange Berufstätigkeit in der Pflege. Trotzdem entschied ich mich voller Enthusiasmus für diesen Beruf. Ich absolvierte dann noch ein Praktikum in der Kinderkrankenpflege und merkte, dass die körperliche Beanspruchung in diesem Pflegebereich längst nicht so stark war. Die anschließende Ausbildung in der Kinderkrankenpflege habe ich dann auch nicht nur gewählt, weil ich Kinder sehr mag und gern mit ihnen arbeite, sondern vor allem aus Selbstschutz, um meinen drohenden körperlichen Verschleiß, über dessen unweigerlichen Eintritt ich mir von Anfang an bewusst war, möglichst lange abzuwehren.
Heute, nach über dreißig Jahren Berufstätigkeit in der Pflege, kann ich sagen, dass ich alle Facetten der Pflege kenne: Kinderkrankenpflege, Erwachsenenpflege, ambulante Pflege, stationäre Pflege im Krankenhaus und im Seniorenpflegeheim. Darüber hinaus kenne ich die Pflegewissenschaft und die berufspolitische Vertretung der professionellen Pflege. Die Angehörigenpflege führ(t)e ich bei vier hochbetagten Verwandten teilweise zeitgleich seit 2007 sehr umfangreich und sehr engagiert zusätzlich zur Berufstätigkeit und zur akademischen Weiterbildung durch. Dabei sind meine professionellen Kenntnisse und Kompetenzen von großem Vorteil. Auch die Patientenperspektive ist mir vertraut, da ich diverse Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte hinter mir habe.
Mein persönliches Fazit nach diesen Jahren, nach allen Erfahrungen und nach meinen Studien lautet: so sehr ich die Pflege liebe, so sehr lehne ich die überall üblichen, aber allzu oft missbrauchten Strukturen dieses Berufes und die politisch verursachte Fehlentwicklung der Pflege ab. Die Umstände, unter denen Pflegende arbeiten und mit denen sie sich im Arbeitsalltag auseinandersetzen müssen, sind katastrophal. Jedes Jahr werden die Arbeitsbedingungen unzumutbarer, die Anforderungen steigen immer mehr, die Löhne stagnieren im Verhältnis dazu. Auch die gesellschaftliche Position der Pflege wird immer schlechter. Pflegekräfte steigen immer früher aus dem Beruf aus. Weder die Gewerkschaft Ver.di noch die berufspolitischen Vertretungen der Pflege und auch nicht die politisch Verantwortlichen tragen zu einer maßgeblichen Verbesserung der Gesamtsituation des Pflegeberufes bei. Leider bewirkt auch die Akademisierung bisher noch keine entscheidende Verbesserung des Pflegeberufes.
Während meiner Berufsausübung bin ich häufig mit einfach unglaublichen Situationen und Vorgängen konfrontiert worden, die ich mir vor meiner Ausbildung niemals hätte vorstellen können, weil sie nicht einer von Mitmenschlichkeit, Respekt und Verantwortung gekennzeichneten Arbeitsumgebung entsprechen, wie sie gerade im Gesundheitswesen erwartet wird. Dazu werden in diesem Buch an manchen Stellen persönliche Erfahrungen geschildert. Diese Situationen und Vorgänge stehen in keinem konkreten Zusammenhang mit den Kranken oder ihren Angehörigen, sondern sind einerseits begründet in der traditionsbedingten hierarchischen Organisationsstruktur der Gesundheitsbetriebe und andererseits in der über hundert Jahre langen Diskriminierung der Pflege als typischem Frauenberuf. Eine Überwindung dieser historisch gewachsenen Gegebenheiten und eine durchgreifende Änderung dieser überalterten Strukturen ist überfällig und wäre ein Anfang für eine Weiterentwicklung des Pflegeberufes.
Neben den hierarchischen Organisationsstrukturen hat mich schon immer die Stellung der Pflege innerhalb der Gesellschaft beschäftigt. Dieses Thema ist auch deshalb so bemerkenswert, weil Deutschland gegenüber anderen Ländern in Ausbildung, Entwicklung und gesellschaftlichem Ansehen des Pflegeberufes sehr weit hinterherhinkt. Um dieses zum Ausland schon lange bestehende Gefälle auszugleichen, ist ein Systemwechsel dringend geboten.
Die Unterentwicklung des Pflegeberufes wirkt seit Jahren negativ auf die Personalrekrutierung. Immer weniger junge Menschen wollen den Pflegeberuf erlernen. Aus diesem Grund ist es mir ein großes Anliegen, für diesen Beruf zu werben. Tatsächlich werden inzwischen gewagte Wege beschritten, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. So werden z. B. Videos gedreht mit tanzenden Pflegekräften oder mit hübsch gestylten und frisch und ausgeruht aussehenden jungen Menschen. Der Pflegeberuf ist allerdings keine Unterhaltung. Ob man dafür mit unterhaltsamem Schauspiel werben will, ist sicher eine Geschmacksfrage. Aber sollen sich junge Leute unter falschen Voraussetzungen für eine Ausbildung entscheiden? Jeder Mensch sollte eine möglichst genaue Vorstellung davon haben, was ihn erwartet. Das gebieten auch die Fairness und der Respekt. Gesundheitsbetriebe haben nichts davon, wenn sich zwar viele Auszubildende für eine Pflegeausbildung entscheiden, aber nach wenigen Monaten abbrechen oder nach der Ausbildung nicht im Beruf bleiben, weil sie enttäuscht sind von den Umständen, unter denen sie arbeiten müssen. Deshalb ist es wichtig, dass jede Person, die sich für eine Pflegeausbildung entscheidet, möglichst genau weiß, was auf sie zukommt. Das wiederum bedeutet, dass sowohl die positiven Seiten der Pflege als auch ihre großen Probleme dargestellt und erklärt werden müssen, damit alle Interessierten einschätzen können, worauf sie sich einlassen. Zudem sollten im Arbeitsalltag Problemlösungen aufgezeigt und Hilfestellungen angeboten werden, damit Auszubildende an den bestehenden Verhältnissen nicht verzweifeln und dem Beruf schon früh den Rücken kehren, sondern durchhalten, sich engagieren und couragiert für Änderungen eintreten.
Selbstverständlich braucht der Pflegeberuf dringend Nachwuchs, zumal mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte und auf die gesellschaftliche Entwicklung Pflege und Gesundheit neben Umweltschutz und Klima die existenziell entscheidenden Themen der Menschheit darstellen. Diese Themenbereiche hängen eng miteinander zusammen, da die Umweltbedingungen und das Erdklima sich unmittelbar auf die Gesundheit der Menschen auswirken (z. B. Wasser- und Ressourcenmangel, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, die inzwischen gefährliche Sonneneinstrahlung, die Vielfalt und Qualität unserer Nahrung usw.). Die Menschheit kann ohne eine intakte Natur und ohne ein gesundes Klima nicht dauerhaft überleben, aber eben auch nicht ohne Pflege und Gesundheit. Die Politik hat hier leider in den letzten Jahrzehnten falsche Prioritäten gesetzt und der Wirtschaft gegenüber dem Pflege- und Gesundheitswesen und gegenüber Klima- und Umweltschutz deutlich den Vorzug gegeben, obwohl letztendlich wirklich niemand Geld essen oder sich Gesundheit als solche kaufen kann. Vielleicht kann man sich mit Geld bessere Voraussetzungen schaffen für ein gesünderes Leben, z. B. durch teurere und bessere Lebensmittel oder durch eine Privatversicherung für bessere Gesundheitsleistungen. Aber spätestens bei einem physischen oder psychischen Trauma oder bei einer schweren Erkrankung merkt jeder Mensch, dass nicht materielle Güter und nicht der Konsum für das menschliche Leben und für seine Lebensqualität entscheidend sind. Wirtschaft kann die Entwicklung einer Gesellschaft – positiv oder negativ – beeinflussen, aber sie ist kein Garant für das Überleben einer Gesellschaft und sie ist kein Ersatz für andere wichtige Gesellschaftsbereiche. Im Gegenteil, sie benötigt gesunde Menschen für ihren Bestand und für ihr Wachstum. Das hat spätestens die Coronakrise gezeigt.
Wer möglichst viel weiß über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Pflege, Krankheit, Natur und Natürlichkeit, ist im Vorteil. Ebenfalls ist diejenige Gesellschaft, die sich dieser Zusammenhänge, aber auch ihrer Möglichkeiten und Stärken bewusst ist, gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Also stellt sich die Aufgabe, allen BürgerInnen möglichst viel von diesem Wissen zu vermitteln. An dieser Stelle schließt sich der Kreis und führt wieder zur Politik und zum Thema Systemwechsel zurück.
Es sind auf allen Gesellschaftsebenen, also auf der Mikro-, Meso- und Makroebene, Änderungen notwendig, damit die Pflege endlich den Platz erhält, den sie ihrer Bedeutung nach verdient. Deshalb werden im vorliegenden Buch auch alle Ebenen angesprochen. Die Perspektivenvielfalt soll zu Erkenntnissen über den Pflegeberuf und zu seiner Weiterentwicklung beitragen. Die im Buch verwendeten Fremdquellen werden alle angegeben.
Mit größtem Respekt danken wir Herrn Prof. Karagiannidis für sein Geleitwort. Indem er sich als Mediziner hier zur Situation des Pflegeberufes geäußert hat, hat er sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Wir sehen seinen Beitrag als einen weiteren Brückenschlag zwischen den Berufsgruppen. Außerdem empfinden wir große Freude darüber, dass er in vielen Punkten unsere Ansichten und die der Berufsgruppe der professionell Pflegenden teilt. Vielleicht finden die ärztliche und die pflegerische Berufsgruppe künftig auch sonst eine gemeinsame Linie beim Einsatz für die Gesundheitsversorgung.
Zuletzt noch ein Wort zur Erarbeitung dieses Buches: Annemarie Fajardo und ich haben neben unserer hauptberuflichen Arbeit und neben unseren ehrenamtlichen Tätigkeiten innerhalb weniger Monate mit diesem Buch ein Werk geschaffen, in dem wir viel niedergeschrieben haben, was uns seit langer Zeit bewegt. Wir glauben, dass wir mit diesem Buch auch sehr vielen anderen Menschen, vor allem aber den Pflegekräften aus dem Herzen sprechen. Dieses Projekt haben wir sehr leidenschaftlich und mit großem Stolz auf die Beine gestellt. Entsprechend war die Zusammenarbeit immer begleitet von einem sehr konstruktiven Austausch. Wir haben dadurch auch neue Erkenntnisse gewonnen und Ideen bekommen, die wir gerne an die Leserinnen und Leser weitergeben möchten. Und nicht zuletzt hatten wir so viel Spaß, dass wir uns schon für weitere Projekte verabredet haben.
Birgit Ehrenfels
1 In diesem Buch wurde stets versucht, eine geschlechtsneutrale Formulierung zu wählen. Wenn dies jedoch nicht möglich war, wurde aus Gründen der gendergerechten Sprache das Binnen-I verwendet. Hiermit sind selbstverständlich alle Geschlechter gemeint.