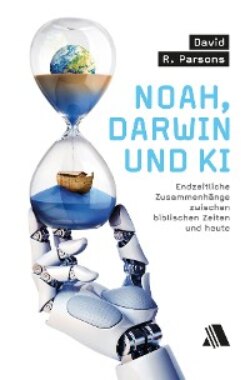Читать книгу Noah, Darwin und KI - David R. Parsons - Страница 16
Bestätigungen aus der Antike
ОглавлениеViele Geheimnisse der Antike sind in dem Feuer, das die legendäre Bibliothek im ägyptischen Alexandria vor zirka 2000 Jahre in Schutt und Asche legte, verbrannt. Heute beherbergen der Vatikan in Rom und das Britische Museum in London die größten Sammlungen von Büchern, Steintafeln, Schriftrollen, Kunstgegenständen und anderen seltenen Artefakten der Antike. 1872 wurde ein einfacher Mitarbeiter des Britischen Museums namens George Smith schlagartig dadurch berühmt, dass er eine assyrische Version einer Flutgeschichte von globalem Ausmaß entdeckte. Sie war dem Bericht im Buch Genesis sehr ähnlich. Das Gilgamesch-Epos, das in eine Tontafel eingraviert worden war, die man in Ninive (im heutigen Irak) ausgrub, erzählt folgende Legende: Die Schwächen der Menschen veranlassten die babylonischen Götter dazu, die Menschheit durch Wasser zu vernichten, doch ein einzelner Mann rettete einen Überrest aller Lebewesen. Als Smith die Bedeutung dessen bewusst wurde, was er da gerade entziffert hatte, rannte er Berichten zufolge vor Begeisterung im Kreis herum und riss sich die Kleider vom Leib. Seine Entdeckung katapultierte ihn sofort in das Rampenlicht der viktorianischen Ära, denn die Bibel wurde von der Wissenschaft attackiert. Es waren daher begeisternde Neuigkeiten, dass eine der ältesten biblischen Geschichten auf so dramatische Art und Weise bestätigt wurde.14
Mehr als ein Jahrhundert später machte ein anderer Kurator des Britischen Museums eine ähnlich atemberaubende Entdeckung auf einer weiteren Tafel, die mit Keilschrift beschrieben war. Irving Finkel entzifferte 2009 ein babylonisches Artefakt, das gewissermaßen die Bauanleitung für eine riesige Arche enthielt. Ihr Sinn und Zweck bestand darin, Menschen und Tiere zu retten. Diese Tafel stammt aus der Zeit um 1900 v. Chr. Ihre Inschrift forderte eine dem biblischen Noah ähnliche Person dazu auf, ein großes rundes Schiff mit mehreren Stockwerken und Abdichtungen an der Innen- und Außenseite zu bauen. Finkel fand auch heraus, dass der Text von „wilden Tieren … jeweils zwei, in Zweiergruppen“ sprach. Das war ein seltener Ausdruck in der akkadischen Sprache. Sein Gebrauch gilt als nachdrückliche Bestätigung der Flutgeschichte aus dem Buch Genesis.15
Es gibt mindestens neun derartige mesopotamische Berichte über die Flut, während man Hunderte vergleichbarer Flutlegenden auf der ganzen Welt finden kann. Sie stammen von so unterschiedlichen Völkern und Orten wie den Massai aus Kenia, den Azteken aus Mexiko, den Maori aus Neuseeland und den Inkas aus Peru.16 In seinem Buch „Moons, Myths and Man“ (Monde, Mythen und der Mensch) schätzte der Forscher H.S. Bellamy, dass es auf der ganzen Welt über 500 solche Flutlegenden gibt.17 Unterdessen untersuchte James Perloff über 200 Flutgeschichten und fand Folgendes heraus: 95 Prozent erwähnten eine weltweite Überschwemmung, in 70 Prozent dieser Legenden kamen Menschen vor, die in einem Boot gerettet wurden, und in 57 Prozent fanden die Überlebenden Zuflucht auf einem Berggipfel.18
In einer weiteren Studie, die 35 Flutlegenden aus der ganzen Welt untersuchte, fand man heraus, dass in allen 35 die Welt durch eine massive Flut zerstört wurde, die die Gipfel der Berge bedeckte, und dass die Menschheit durch eine Familie gerettet wurde – üblicherweise durch einen Mann, seine drei Söhne und ihre Ehefrauen. 32 dieser Berichte schreiben diese Rettung einem großen Boot zu.19 Ein weiteres Element, das diese Geschichten aus weit entfernten Gegenden miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass man Vögel fliegen ließ, um festzustellen, ob das Wasser zurückgegangen war. Diese Übereinstimmung deutet darauf hin, dass die Geschichten alle dasselbe Ereignis beschreiben, während die mündliche Weitergabe im Laufe der Zeit einige Details verändert hat.20
Der chinesische Klassiker „Hihking“ erzählt die Geschichte eines Mannes und seiner Familie (bestehend aus seiner Frau, drei Söhnen und drei Töchtern), die auf einem Boot vor einer großen Flut verschont wurden. Diese Flut bedeckte das ganze Land. Die Chinesen betrachten diesen Mann als den Urvater ihrer Zivilisation; und seine Familie bevölkerte die ganze Welt von Neuem. Elemente dieser Geschichte sind sogar in den altertümlichen Bildzeichen enthalten, die später zur chinesischen Sprache wurden.21 So besteht beispielsweise das chinesische Piktogramm für „Boot“ aus den Zeichen für einen Behälter, einen Mund und die Acht, d. h. ein Wasserfahrzeug, das acht Menschen betreten können.22
Doch die wichtigsten Flutlegenden stammen aus dem antiken Nahen Osten, da ihre Details so ähnlich sind und ihre Protagonisten dasselbe einzigartige Weltbild hatten wie die semitischen Stämme der Hebräer. Von diesen mesopotamischen Berichten ist und bleibt das Gilgamesch-Epos der wichtigste. Es weist so viele Ähnlichkeiten mit dem Buch Genesis auf, dass beide zweifellos dasselbe Ereignis behandeln.
In diesem Epos trifft der Erzähler (Gilgamesch) auf einen alten Mann (Utnapischtim), der ihm berichtet, wie ihn die Götter einst vor einer kommenden Flut warnten. Er wurde angewiesen, ein großes, mit Pech abgedichtetes Schiff zu bauen und männliche und weibliche Tiere aller Art an Bord zu nehmen, ebenso seine Frau und seine Familie. Als das Schiff fertig war, regnete es sechs Tage und Nächte lang heftig. Das Schiff ließ sich schließlich auf einem Berggipfel nieder. Utnapischtim wartete sieben Tage, bis er eine Taube fliegen ließ, die bald zu ihm zurückkehrte. Dann ließ er eine Schwalbe und schließlich einen Raben frei, der nicht wieder zu ihm zurückkam, weil der Erdboden getrocknet war.23
Bemerkenswerterweise teilen sowohl das Buch Genesis als auch das Gilgamesch-Epos die Welt in drei Ebenen ein: den Himmel, die Erde und die Unterwelt. Diese dreigliedrige Kosmologie durchzieht tatsächlich das Alte Testament genauso wie das Neue (siehe beispielsweise 2. Mose 20,4; Philipper 2,10; Offenbarung 5,13). Laut dem Gilgamesch-Epos regnete es nicht nur aus dem Himmel, sondern der Held warnte auch davor, dass die Wasser aus dem Abgrund (oder der Unterwelt) schon bald die Erde überfluten würden. Das entspricht der biblischen Version, die in 1. Mose 7,11 berichtet, dass die Fluten aus den „Quellen der großen Tiefe“ kamen und aus den „Fenstern des Himmels“.24
Doch immer noch stellt sich uns die bohrende Frage: Welche Geschichte war die ursprüngliche – die babylonische oder die hebräische Version? Und ist die eine nur ein Plagiat der anderen? Manche Bibelkritiker behaupten, der biblische Autor habe einfach das Gilgamesch-Epos und weitere Flutgeschichten herangezogen, ein paar Namen und Details verändert und so eine Fabel verbreitet. Die traditionelle Auffassung unter Bibelwissenschaftlern besagt, das 1. Buch Mose sei, wie die anderen vier Bücher Mose auch, vom Patriarchen Mose selbst verfasst worden. Dabei habe Gott den Autor inspiriert. In den letzten Jahrhunderten haben Vertreter der historisch-kritischen Methode jedoch eine alternative Theorie entwickelt. Demnach hätten spätere Verfasser diese Bücher aus verschiedenen und einander widersprechenden Quellen zusammengeschrieben. Diese Theorie wird die „dokumentarische Hypothese“ genannt.25 Doch die moderne Wissenschaft kehrt gerade zur traditionellen Ansicht zurück.26
Ein Hauptgrund, die Genesis-Erzählung der Flut als einzigartigen und originären Bericht nur eines Verfassers zu betrachten, liegt in der Tatsache, dass man vor Kurzem die Literaturkritik und Formgeschichte in die biblische Forschung integriert hat. Unter diesem Blickwinkel ist die Geschichte so genial aufgebaut, dass eine Verbindung zu außerbiblischen Quellen absolut undenkbar erscheint. Der Genesis-Forscher Gordon Wenham verweist beispielsweise auf die komplexe poetische Form des Chiasmus, die im hebräischen Ursprungstext verwendet wird. Die Chiasmus-Poesie bedient sich eines literarischen Spiegeleffekts, indem sie die Handlung in der Mitte der Geschichte ihren Höhepunkt erreichen lässt. Dort wird die Hauptaussage des Textes hervorgehoben, nur um sich dann in der zweiten Hälfte wieder abwärts zu bewegen, in einer spiegelbildlichen Umkehrung der ersten Hälfte.27 Daher ist die Ansicht, dass die Flutgeschichte aus dem Buch Genesis nur ein Nebenprodukt der mesopotamischen Fassungen sein könnte, mittlerweile gründlich diskreditiert worden, auch wenn es derart verblüffende Übereinstimmungen gibt. 28
Ich persönlich glaube, dass Mose einzigartigen Zugang zu Informationen über vergangene Ereignisse erhielt, einschließlich der Schöpfung und der Sintflut, und diese unter göttlicher Anleitung niederschrieb. In 2. Mose 33,7–11 erfahren wir, dass Mose das Zelt der Begegnung aufstellte, in einiger Entfernung vom Lager der Israeliten am Berg Sinai, und dort seine Zeit damit verbrachte, allein mit Gott zu sprechen „von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet“ (Vers 11 L). Am Ende dieses Kapitels erhält Mose zudem die ehrfurchtgebietende Möglichkeit, die „Güte“ Gottes an sich vorübergehen zu sehen, während er selbst in einer Felsspalte verborgen bleibt (siehe 2. Mose 33,19–22). In Vers 23 heißt es, Gott habe Mose erlaubt, ihn „von hinten“ zu sehen, wobei das hebräische Wort achowr gebracht wird; es kann „rückwärts“ oder „zurück in die Vergangenheit“ bedeuten.29
Das Fazit lautet daher: Der Flutbericht aus dem Buch Genesis steht auf eigenen Füßen, und zwar als einzigartige und akkurate Beschreibung eines tatsächlichen Ereignisses. Diese Erzählung wird durch Hunderte ähnlicher Geschichten aus der damaligen Zeit bestätigt, die erstaunliche Parallelen zum biblischen Bericht aufweisen. Die Tatsache, dass man diese anderen Legenden auf der ganzen Welt finden kann, bekräftigt, dass die Sintflut tatsächlich die ganze Welt betraf. Sie ist so vielen verschiedenen Völkern bekannt, da wir alle von der Familie Noahs abstammen.
Allerdings ziehen Geologen, die sich mit der Erdkruste beschäftigen, in unserer heutigen Zeit diese Vorstellung von einer weltweiten Flut vor zirka 4350 Jahren immer mehr in Zweifel.