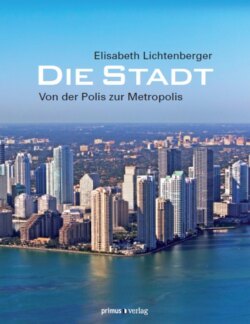Читать книгу Die Stadt - Elisabeth Lichtenberger - Страница 15
Die mittelalterliche Bürgerstadt Überblick
ОглавлениеDie Neubildung der europäischen Stadt vollzog sich auf der Grundlage des Feudalsystems: Aus dem Zusammenschluß von politisch-herrschaftlicher Funktion und Marktfunktion entstand in den Jahrhunderten des Mittelalters die Bürgerstadt. Die Einzelheiten ihres Auf- und Ausbaus, die Ausweitung nach dem Osten Zentraleuropas hin und andererseits im Südflügel die Entwicklung in der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel können hier nicht thematisiert werden. Es geht vielmehr darum, die Besonderheit der mittelalterlichen Bürgerstadt auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung im 13. und 14. Jh. herauszustellen, die Unterschiede gegenüber der Polis und den römischen Städten aufzuzeigen und die Merkmale hervorzuheben, welche bis heute in den europäischen Stadtstrukturen nachwirken.
Mit dem Feudalsystem war die Siedlungsdreiheit von Burg, Stadt und Dorf verbunden, die freilich nicht überall im mittelalterlichen Abendland zur Ausbildung gekommen ist. Im Mediterrangebiet haben die mächtigen Stadtrepubliken den Adel schon damals in ihre Mauern gezwungen. Der erzwungene Abbruch seiner Turmbauten in den Großstädten Italiens belegt dies eindrucksvoll. Ebenso ist in Fortsetzung der antiken Sozialorganisation das Land in Italien und im Süden Frankreichs im Besitz städtischer Schichten geblieben, die ähnlich der „Villeggiatura“ der römischen Kaiserzeit die Pachthöfe im weiteren Stadtumland zu Sommersitzen ausgebaut haben (Abb. 1.12).
Im Norden der Alpen haben sich in weiten Teilen Zentral- und Westeuropas in Abhängigkeit vom feudalen Oberbau drei Gesellschaften im Raum klar separiert: Burgen, Stadt und Land und damit Adel, Bürger und Bauern. Sie waren andererseits aber in vielfältiger Weise, vor allem durch Wirtschaftsbeziehungen, funktionell verknüpft. Während jedoch die Grundherrschaft über die ländlichen Gemeinden bis zur Grundentlastung, beginnend mit der Französischen Revolution, aufrecht blieb, ist es einer ganzen Anzahl von Städten in der Zeit der Desorganisation der Feudalgewalten gelungen, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Es entstanden die Freien Reichsstädte in Deutschland, die „villes franches“ in Frankreich, die „villa franca“ in Italien und die „freetowns“ in Großbritannien. Für die erfolgreiche Vertreibung der Feudalherren bietet das Exil des Erzbischofs von Köln ein Beispiel. Aus diesen unabhängig gewordenen Städten sind Städtebünde, wie der Nürnberger Städtebund und als größte Organisation des Mittelalters die Hanse, entstanden.
Die Unterscheidung von Fremden und Ortsbürgern bestand auch in der mittelalterlichen Bürgerstadt ganz ähnlich wie in der Polis, nur fehlten die Sklaven, und überdies galt die Regel „Stadtluft macht frei“, d.h., zuwandernde Hörige vom Land konnten, wenn sie von der Stadt aufgenommen wurden, der Leibeigenschaft von Grundherren entrinnen.
Die Zersplitterung der Territorien im Feudalismus brachte anstelle des römischen Bürgerrechts somit eine Ständegesellschaft. Der geänderte Bedingungsrahmen gegenüber griechischen und römischen Städten bestand ferner in der besitzmäßigen Trennung von Stadt und Land. Damit war die Bürgergemeinde gezwungen, sich mit der Produktion von materiellen Gütern und Diensten einen virtuellen Lebensraum zu schaffen. Der „Rentenkapitalismus“ der vom Boden und der Landwirtschaft und dem Export von Agrarprodukten mittels Sklavenbetrieben profitierenden römischen Bürger wurde durch den „produktiven Kapitalismus“ der mittelalterlichen Stadtbürger ersetzt, dessen Frühformen schon im 14.Jh. deutlich zu fassen sind. England gibt mit der Kommerzialisierung der Naturalleistungen sowie der Hand- und Spanndienste durch die Feudalherren im 14. Jh. im ländlichen Raum den Auftakt. Eine Delegierung der gewerblichen Fertigung an die ländlichen Siedlungen erfolgte insbesondere von seiten der Patrizier in den Fernhandelsstädten Flanderns, Oberitaliens und Süddeutschlands.
Insgesamt hatte in der politischen Landschaft des Mittelalters die Stadt eine privilegierte Stellung. Als freie Reichsstadt bzw. als Stadtstaat in Flandern und Italien besaß sie alle Institutionen und Aufgabenbereiche, welche dann später vom absolutistischen Flächenstaat übernommen wurden. Dazu zählten Verteidigung, Rechtsprechung und Kontrollfunktionen über die bauliche und ökonomische Tätigkeit der Bürger sowie verschiedene Aufgabenbereiche der sozialen und technischen Infrastruktur, wie Schulen, Spitäler, Siechenhäuser, Bäder usw.
Abb. 1.12: Ansicht von Siena, 1340
Entsprechend den Basisfunktionen – Markt und gewerbliche Produktion – bildeten Kaufleute und Gewerbetreibende die tragenden sozialen Schichten. Aus den Bestrebungen der Handelsherren, die Handwerker in die Abhängigkeit des Verlagssystems zu bringen, resultierten soziale Spannungen und Konflikte. Die mittelalterliche Stadtgeschichte ist voll davon.
Die Stadtgrößen der mittelalterlichen Bürgerstadt sind nicht mit denen der antiken Welt vergleichbar. Die weit überwiegende Zahl der Städte blieb klein und zählte nur wenige tausend Einwohner. Keine Stadt erreichte die Größe der Städte im damaligen arabischen Herrschaftsgebiet, wo z.B. für Córdoba eine Einwohnerzahl von 500.000 geschätzt wird.
Wesentliche, bis heute „sichtbare“ Merkmale der mittelalterlichen Bürgerstadt sind folgende:
▪ Die Symbolik von monumentalen Kirchenbauten weist die Stadt als ein Mitglied des christlichen Abendlandes aus. Hierzu trägt die Formensprache der Gotik bei, die sich ab dem 13. Jh. ausbreitete, ein neuer Stil, „eine verrückt-tollkühne Technik“ (Le Corbusier 1937: „Als die Kathedralen weiß waren“). Das Bild der Stadt wurde durch die Kirchenbauten dominiert, man baute sie so hoch wie möglich, vielfach in kleinen Städten disproportional im Gesamtbild. Le Corbusier hat sie als „die Wolkenkratzer Gottes“ bezeichnet (Abb. 1.13).
▪ Der öffentliche Bereich ist recht komplex strukturiert, oft bestehen mehrere Zentren: eine Burg des Stadtherrn, später als Schloß umgebaut, die Kathedrale, das Rathaus, Tuchhallen der Kaufleute. Bei Stadterweiterungen bildeten sich neue Zentren mit den Klöstern der neuen religiösen Orden, ihren Kirchen und Plätzen. In den größeren Städten ist der Gegensatz zwischen religiöser und weltlicher Macht, der in der Antike nicht existierte, deutlich sichtbar.
▪ In der Aufschließung überwiegen schmalstreifige Blöcke, schmale Parzellen herrschen vor. In der Stadtgeschichte von Freiburg im Breisgau ist nachzulesen, daß jeder Angehörige der Siedlergilde gegen einen Jahreszins von 1 Schilling ein Grundstück von 50 × 100 Fuß (ca. 16 × 33 m) erwerben konnte.
▪ Grundsätzlich neu ist die Konzeption des „ganzen Hauses“ mit der Einheit von Wohnen und Wirtschaften. Die Baukonstruktion bediente sich schmaler Baustreifen mit 2 bis 3 Fensterachsen an der Straßenfront, nicht nur auf schmalen Parzellen, sondern auch auf großflächigen Parzellen der Patrizierhäuser, wo derartige Streifen nebeneinander angeordnet wurden.
▪ Anders als bei den Hofhäusern der antiken Stadtkulturen ist das Bürgerhaus mit der repräsentativen Schaufront zur Straße hin ausgerichtet. Damit beginnen der bis zur Gründerzeit reichende „Fassadenkult“ und die horizontale Differenzierung des Hauses auf der Parzelle.
Abb. 1.13: Wien, Stephansdom, 1770
▪ Jede größere Stadt hatte verschiedene Stadtteile mit jeweils spezifischem Charakter, oft eigener politischer Verwaltung und eigenem Wappen. Ebenso bestand eine sehr ausgeprägte Viertelsbildung des Gewerbes.
▪ Zwischen dem öffentlichen Raum und dem Privatraum bestanden Verschränkungen: zeitlich geregelte Rechte der Allmende, Durchgangsrechte, aber auch in Vorwegnahme des gegenwärtigen halböffentlichen Raums Rechte von Bruderschaften, Zünften u. dgl.
▪ Die Stadt kontrollierte die Bautätigkeit der Bürger mit sehr genauen Regelungen hinsichtlich der Baupflichten bei Wiederaufbau u. dgl., aber auch bezüglich der Details der Hausvorsprünge, Balkons, Treppenaufgänge, Säulengänge u. dgl.
▪ In sozialräumlicher Hinsicht bestand eine ausgeprägte zentral-periphere Differenzierung. In der mittelalterlichen Bürgerstadt war der zentrale Marktplatz mit Kirche, Rathaus, Markthalle usw. die soziale Mitte der Stadt. Hier reihten sich die Häuser der führenden Geschlechter aneinander. Überall dort, wo heute Hausbesitz, Handel und Gewerbe noch eine Einheit bilden, wie dies in Kleinstädten der Fall ist, hat sich das „Soziale-Mitte-Konzept“ der Stadterhalten, welches die Denkmalschutzbewegung ganz entscheidend unterstützt.
Als wichtiges Erbe wäre ferner der vielfältige Aufgabenbereich der Stadtbehörden sowie das Fortleben zünftischer Verfassungen und besitzbürgerlicher Verhaltensweisen zu nennen. Gerade in diesen zahlreichen gewerberechtlichen Details, vom Apothekengesetz angefangen bis zu den Gewerbeordnungen, bestehen grundsätzliche Unterschiede gegenüber dem Liberalismus in Nordamerika, wohin die Rechts- und Normenstruktur der Gesellschaft der mittelalterlichen Bürgerstadt nicht mehr exportiert worden ist.
Die Frage nach den Spielregeln von Wachstum, Stagnation und Schrumpfung von Bevölkerungszahl und Wirtschaft der mittelalterlichen Bürgerstadt hält eine andere Antwort bereit als für die griechische Polis bzw. die Stadt des Römischen Reichs. Es fehlt der mittelalterlichen Bürgerstadt das Prinzip der Polis mit Synoikismus und Koloniegründung ebenso wie die hierarchische Konzeption der Stadt im römischen Weltreich. Sehr vereinfacht bieten sich drei Modelle an:
1) Es bestand nur eine formale Grenze gegenüber Märkten und Dörfern überall dort, wo die zahlreichen feudalen Territorien die Möglichkeiten einer Stadtgründung überschätzt hatten und Fehlgründungen von Städten im Spät- und Hochmittelalter erfolgten, denen ein entsprechendes tragfähiges Hinterland fehlte.
2) Eine große Zahl von im Mittelalter durchaus erfolgreichen Städten, deren Wachstum in der Neuzeit stagnierte, hat sich als Museumsstädtchen bis heute in ihren Mauern erhalten, wobei sie freilich ihre bauliche Form zumeist erst zwischen dem 15. und 18. Jh. bekommen haben (Abb. 1.14). Hierbei ist festzuhalten, daß die zahlreichen Neugründungen von Städten in Abhängigkeit von den Intentionen des Stadtgründers sowie dem regionalen und zeitlichen Standort bestimmten Modellen für die Grundrißformen folgten, die sich im Laufe der Jahrhunderte geändert haben. Auf die außerordentlich breite Literatur zu dieser Thematik kann nicht eingegangen werden.
3) Die meisten Städte erhielten ihre Form jedoch nicht in einem Zug. Ein kleinzügig komplexes, unregelmäßiges, jedoch zusammenhängendes Straßennetz ist daher die Regel, in dem zumeist nur die Fußgängerstraßen zu den jeweiligen Landmarken dem Fremden eine Orientierung gestatten.
Grundsätzlich bestanden beim Stadtwachstum zwei unterschiedliche Möglichkeiten: zum einen die Stadterweiterung durch Einbeziehung außerhalb der Mauern entstandener Vorstädte in einen neuen Mauerring, Wien bietet hierfür ein Beispiel, zum anderen der Fortbestand von mehreren nebeneinandergelegenen Städten bis in die Zeit des absolutistischen Flächenstaates. Prag wird als Beispiel vorgestellt.
Zumeist erfolgte die neue Ummauerung erst, wenn das bisherige Gebiet verbaut war. Nur die großen Stadterweiterungen wie in Prag, in Italien in Florenz, Siena, Bologna, Padua oder auch in den Niederlanden in Gent erwiesen sich als zu groß, so daß der neue Mauerring lange Zeit offene, unverbaute Flächen umschloß.