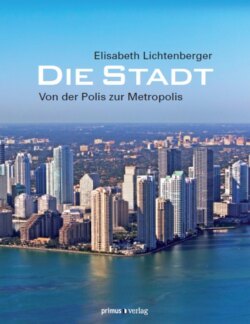Читать книгу Die Stadt - Elisabeth Lichtenberger - Страница 19
Die Wiener Agglomeration im 18. Jahrhundert
ОглавлениеWien war mit rund 180.000 Einw. um 1770 die drittgrößte Stadt des Kontinents und bietet ein vorzügliches Beispiel für den Dualismus von mittelalterlicher Bürgerstadt und barocker Residenz und gleichzeitig für den Vorgang einer barocken Suburbanisierung (Abb. 1.25). Es kam einerseits zur besitzmäßigen Ablösung der bürgerlichen Hausbesitzer durch Adel, Geistlichkeit und hofzugewandte Schichten und andererseits zu einem enormen Wachstum der Vorstädte, so daß sich das Verhältnis zwischen der Stadt und den Vorstädten im Laufe des 18. Jh.s von 1:2 auf 1: 5 verschob. Hierbei verstärkten sich die Unterschiede zwischen der barocken Stadt und den barocken „Suburbs“.
Die sozialen Kontraste zwischen Stadt und Vorstädten können um die Mitte des 18. Jh.s auf die sehr einfache Formel gebracht werden, daß in der Stadt in erster Linie die Angehörigen des Adels und die Vertreter des tertiären Sektors wohnten, während in den Vorstädten die Sozialstruktur von der in der Produktion tätigen Bevölkerung bestimmt wurde. Im Hinblick auf die Herkunft sonderte sich die überwiegend ortsbürtige Bevölkerung in der Stadt von der überwiegend fremdbürtigen Bevölkerung in den Vorstädten ab.
In der Stadt hatten die Paläste des Adels die gotischen Bürgerhäuser auf einzelne Gassen verdrängt (Abb. 1.26). Der Großhandel befand sich in der Hand ausländischer Kaufleute. Die Klosteraufhebung unter Joseph II. hatte das Problem der Unterbringung der neu begründeten öffentlichen Behörden zumindest kurzfristig gelöst, das Geld- und Finanzwesen begann sich baulich zu verselbständigen.
Abb. 1.25: Sozialräumliche Gliederung von Wien um 1770
In den Vorstädten bestanden Unterschiede zwischen der Stadtgemarkung und den ursprünglich dörflichen Gemarkungen. Auf der Stadtgemarkung reihte sich längs der Fernstraßen das Gast- und Verkehrsgewerbe an, auf grundwassernahem Auengelände breitete sich die ins Mittelalter zurückreichende Standortgemeinschaft von Gemüsegärtnern und Milchmeiern aus. Weite Flächen nahm die – um einen modernen Terminus zu gebrauchen – „Zweitwohnungsperipherie“ des Adels ein. Auf der Stadtgemarkung erfolgte auch zuerst die Anlage von Wohlfahrtseinrichtungen des Staates; Armen- und Waisenhäuser entstanden, ebenso Kasernen.
Im westlichen Sektor des Stadtumlandes reichten dörfliche Gemarkungen nahe an die Stadtmauer heran. Sie wurden erst 1689 in den Burgfriedensbezirk der Stadt einbezogen. Seither legten hier geistliche und weltliche Grundherren planmäßig Vorstädte an, als Auffangquartiere sowohl für die zwangsweise vom Hofquartiersamt aus der Stadt ausgewiesenen Gewerbetreibenden als auch für Zuwanderer aus dem Deutschen Reich und dem westlichen Ausland, insbesondere die später privilegierten Manufakturisten. Die Vielfalt der Aufschließungsformen ist aus Abb. 1.27 zu entnehmen.
Sie reichte von der spontanen Aufsiedlung auf dörflichen Gewannfluren, wodurch ein blockweises Nebeneinander von extrem tiefen Parzellen und Durchbruchsgassen entstand, bis zu kleinen Plananlagen, vorwiegend auf Gutsblockfluren. Schon sehr früh kam es zu spekulativer Grundstücksausschlachtung in Form von sehr kleinen Parzellen, wie sie im Vordergrund in der knapp nach 1700 gegründeten Vorstadt Spittelberg zu erkennen sind.
Im Hinblick auf die Landnutzung entsprach die Wiener Situation 1770 noch völlig dem Thünenschen Modell der Stadt im isolierten Staat. Im damaligen Augelände der Donau und des Wienflusses breiteten sich in Stadtnähe Gemüsegärten aus, die bis ins späte 19. Jh. als Barriere gegenüber der Verbauung wirkten.
Abb. 1.26: Wien um 1770, gotische Bürgerhäuser und barocke Adelspaläste
Die im Thünenschen Modell anschließende Zone des „Stadtwaldes“ war im Wiener Vorstadtraum auf den Sektor des Auwaldes der Donau beschränkt, der sich im Besitz der Habsburger befand. Auf den Terrassenabfällen im Vorstadtraum breiteten sich bis zur zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 ausgedehnte Weingärten aus. Sie befanden sich im Besitz der Stadtbürger und gelangten dann an den Adel, der an ihrer Stelle in der Barockzeit in aussichtsreicher Lage Sommerpaläste inmitten weiträumiger Parks errichtete. Wein- und Gemüsegärten und der Wald waren somit der Neuanlage und Ausweitung der „bürgerlichen“ Vorstädte im wesentlichen verschlossen. Diese entwickelten sich daher in erster Linie auf Kosten des Ackerlandes.
Vor allem die Vogelperspektiven aus dem späten 18. Jh. zeigen die Vorstädte und Vororte von Gärten durchsetzt. Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Verbauung und der ausgedehnten Grünräume entstand bei modernen Städtebauern und Architekten daher die Illusion einer städtischen Idylle, eines harmonisch ausgewogenen, überschaubaren Gemeinwesens. Übersehen werden hierbei die enormen Probleme der Sozialhygiene, wonach in Wien, ähnlich wie wir dies aus London wissen, die Sterblichkeit höher war als im anschließenden ländlichen Raum. Auch die Bevölkerungsdichte in der Stadt war mit rund 500 Menschen pro Hektar (um 1780) außerordentlich hoch, wenn man bedenkt, daß gegenwärtig in Deutschland 250 Menschen pro Hektar als Obergrenze bei Stadtentwicklungsvorhaben gelten. Dazu kam ein weiteres gravierendes Problem, nämlich die Wohnraumbeschaffung seitens der Zuwanderer. Gelang es ihnen nicht, in die Haushalte der Gewerbeherren und des Adels aufgenommen zu werden, so zählten sie zum Heer der Obdachlosen, die allabendlich von der Polizei über die „Linie“ aufs freie Feld hinausgeschafft wurden.
Abb. 1.27: Wiener Vorstädte, 1785