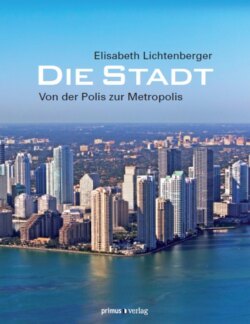Читать книгу Die Stadt - Elisabeth Lichtenberger - Страница 18
Die Residenzstadt des Absolutismus Überblick
ОглавлениеIn Vorwegnahme des Konzepts der absolutistischen Fürstenstadt hat Albrecht Dürer (1471–1528) in der knapp vor seinem Tod 1527 erschienenen Schrift „Etliche underricht zu befestigung der Stett, Schloß und Flecken“ den Idealplan einer Stadt gezeichnet, die nie gebaut worden ist (Abb. 1.22). In Übereinstimmung mit dem neuen politischen System des Absolutismus gibt Dürer dem Schloß eine klare zentrale Position in der Mitte der Stadt. Die einzige Kirche mit dem Pfarrhaus wird an den Rand der Stadt versetzt, Klöster fehlen überhaupt. Der Dualismus zwischen weltlicher und kirchlicher Macht wird damit klar städtebaulich zugunsten der ersteren entschieden. Die Bürgerstadt wird beibehalten, aber ebenso wie der Markt in einen äußeren Ring verschoben. Bei den Baublöcken wird von Dürer die mittelalterliche Langstreifenform weiter verwendet, wobei ganze und „halbe“ Parzellen, mit 50 bzw. 25 Schuh Breite (ungefähr 15 bzw. 7,5 m), unterschieden werden.
Der Aufbruch der Renaissance und des Barock im Städtebau des absolutistischen Landesfürstentums brachte mit dem Zurückgreifen auf antike Vorbilder neue Grundrißformen. Die Wiederentdeckung von Vitruv führte zu einer Flut von Entwürfen für Idealstädte im Rastersystem, neu war die Betonung der radialen Konzeption. Die Renaissance entdeckte den Menschen: Dessen unterschiedliche Vorder- und Rückansicht spiegelt sich in der Asymmetrie der Stadtanlage bei neuen Residenzstädten wider. Somit unterscheiden sich die vieleckigen oder strahlenförmigen Städte der Renaissance und des Barock in ihrer Anlage grundsätzlich von den geplanten griechischen Städten der Antike dadurch, daß sie immer auf einen Platz, das Schloß oder das Tor hin ausgerichtet waren und das gesamte umgebende Wohngebiet dem Zentrum untergeordnet wurde (Abb. 1.23).
Abb. 1.22: Dürer: Stadtplan mit zentralem Schloß (1527)
Die in dieser Epoche entstandenen Städte sind als Manifestationen politischer und militärischer Zentralmacht zu verstehen (Versailles, Karlsruhe, Mannheim, St. Petersburg). Das Schloß als Sitz des Herrschers war der Mittelpunkt der Stadt, deren Elemente (Straßen, Plätze, Baublöcke und Parkanlagen) folgerichtig zur Konkretisierung dieser neuen Zentralkonzeption eingesetzt wurden.
Der Baublock wurde nicht im Hinblick auf Wohnbedingungen und Wohnmöglichkeiten, sondern in erster Linie als formales städtebauliches Element verwendet. Straßen dienten nicht primär als Erschließungselemente des Stadtraumes, sondern erhielten vorwiegend strategische und damit die absolutistische Herrschaft sichernde Aufgaben. Der Städtebau verwendete Achsenkonzepte, diagonale und radiale Straßenzüge als neue Grundelemente und gestaltete Straßen und Plätze mittels repräsentativer Fassaden als Kulissen für höfisches und militärisches Zeremoniell. In Paris kaufte z.B. die Stadt die Fassaden von Häusern an wichtigen Straßen und Plätzen, ließ dafür von Hof- und Staatsarchitekten neue Entwürfe anfertigen und die Fassaden umgestalten, während das hinter der Fassade liegende Haus samt dem Grundstück weiter im Besitz des jeweiligen Eigentümers blieb.
Die Zahl der neugegründeten Städte blieb insgesamt klein, doch folgten zahlreiche Stadterweiterungen von wachsenden Städten der Geometrie antiker Vorbilder. Ein Beispiel hierfür ist der Ausbau von Turin in den Jahren 1620, 1673 und 1714 (Abb. 1.24).
Die beschriebenen städtebaulichen Merkmale bilden jedoch nur eine Seite der Medaille. Es ist die Frage zu stellen: Wodurch unterscheidet sich die Residenzstadt grundsätzlich von vorangegangenen und folgenden Stadttypen? Max Weber (1956) hat die Marktfunktion als entscheidendes Merkmal der Stadt angesehen, Werner Sombart (1902) hat von „Städtegründern“ und „Städtefüllern“ gesprochen und den Produktionsüberschuß für ein weiteres Hinterland als Grundlage der städtischen Existenz bezeichnet.
Abb. 1.23: Stadtplan von Mannheim
Wendet man diese Theorien von der Bedeutung von Produktion und Vermarktung auf die historischen Stadttypen Europas an, so kann man stark vereinfacht feststellen, daß für die mittelalterliche Bürgerstadt die Marktfunktion, für die Industriestadt die Erzeugung von Sachgütern die wirtschaftliche Basis bildeten. Die Residenzstadt brach aus dieser von wirtschaftlichen Funktionen bestimmten Reihe aus. Sie war in ihrer Existenz an nichtökonomische Aufgaben administrativer und kultureller Art gebunden.
Abb. 1.24: Stadterweiterungen in Turin im 17. und 18. Jh.
Diese Funktionsverlagerung ist allerdings nur verständlich vor dem Hintergrund der Entstehung von Flächenstaaten, welche vom absolutistischen Landesfürstentum in administrative Einheiten gegliedert wurden. Dabei übernahm der Staat die Aufgaben, welche bereits die voll entwickelte mittelalterliche Bürgerstadt wahrgenommen hatte. Dazu gehörten die Verteidigung, Rechtsprechung und Aufgaben der sozialen und technischen Infrastruktur, aber auch die Kontrolle über die bauliche und ökonomische Tätigkeit der Bürger. Damit subordinierte der Staat die städtischen Behörden unter die neugeschaffenen Organe seiner Administration. Gleichzeitig wurde das Gefüge der Bürgergemeinde durch die Urbanisierung des Adels gesprengt. Allerdings wurde der Adel nicht überall in der Stadt ansässig. Im Raum des deutschen Altsiedellands, im Machtbereich der Hansestädte und vor allem in Großbritannien verblieb er auf dem Lande.
Mittels neuer Verkehrstechnologien – zuerst des Kanalbaus (vor allem in Frankreich und Preußen), später der Kommerzialstraßen in der Habsburger-Monarchie (in Frankreich: Routes Napoléon) – wurden Städte der oberen und mittleren administrativen Rangstufen an die jeweilige Hauptstadt angeschlossen. Zahlreiche Kleinstädte blieben abseits, ihre Erreichbarkeit und damit ihre Verkehrsqualität nahmen relativ ab.
Im Städtebau steigerte die Barockzeit das aus dem Mittelalter geläufige Repräsentationsprinzip zum Monumentalen hin. Sichtachsen zu Schlössern und sonstigen Monumentalbauten entstanden und ersetzten als breite Boulevards für Reiter und Kutschen die fußgängerbezogene Enge mittelalterlicher Gassen. Weiträumige Parkanlagen dienten als ergänzende Elemente architektonischer Gestaltung. Das Schloß des Herrschers bildete die neue „soziale Mitte“ der Stadt und damit das Zentrum einer sozialräumlichen Gliederung, von dem aus sich die sozialen Gruppen fächerförmig zentral-peripher anordneten.
Die Residenzfunktion brachte neue Sozialgruppen in die Stadt: Adelige, Beamte, Offiziere. Der Adel drängte in den Dienst des Hofes und wurde so in der Stadt ansässig. In Großbritannien verblieb er jedoch weitgehend auf seinen ländlichen Besitzungen und bezog nur episodisch seine „town houses“. Damit fehlte hier ein wichtiges Bevölkerungselement, welches in den Residenzen Kontinentaleuropas für die Bautätigkeit der Barockperiode die Maßstäbe setzte. Dem Lebensstil der neuen Sozialgruppen entsprechend entstanden neue Wohnbautypen, nämlich der Adelspalast und das Beamtenwohnhaus.
Besonders eindrucksvolle duale Stadtstrukturen sind überall entstanden, wo mittelalterliche Bürgerstädte in der Zeit des Absolutismus zu Residenzen des jeweiligen Herrscherhauses wurden. Dort verschmolz die ältere Bürgerstadt mit der „Fürstenstadt“, und angelagert an das Schloß gelangte ein adeliger und höfischer Stadtsektor zur Ausbildung.
Aufgrund der absolutistischen Machtstrukturen erfolgte ein Transfer des Besitzes an Grund, Boden und Häusern von der alten bürgerlichen Elite an die neue Elite des Adels und des Hofes. Das Bürgertum wurde vielfach aus der Stadt in den Vorstadtraum abgedrängt, gleichzeitig damit jedoch die Eigenschaft der Stadtmitte als soziale Mitte verstärkt. Der Dualismus des Sozialsystems äußerte sich im Vorstadtraum als sektorales Prinzip, indem längs der Ausfallstraßen Gewerbevorstädte und in den Interstitien in attraktiver Lage die Sommerpaläste des Adels entstanden.
Im neu aufgeschlossenen Gelände kam es zu einer flächigen Segregation nach Herkunft, Stand und Vermögen, während in der Stadt die vertikale und horizontale gesellschaftliche Differenzierung der Mietshäuser eine Integration verschiedener Stände unter einem Dach zur Folge hatte. Auf diese integrative soziale Funktion des älteren kontinentaleuropäischen Mietshauswesens wird noch eingegangen. Die duale Struktur der Stadt führte schließlich in weiterer Konsequenz in der Citybildung des 19. Jh.s zur Zweiteilung in Wirtschafts- und Regierungscity.
In einer späteren Phase der absolutistischen Ära, die in der politischen Geschichte als aufgeklärter Absolutismus bezeichnet wird, waren die großen Städte nicht mehr imstande, ihren Bedarf an gewerblichen Produkten für den eigenen Konsum und den Fernhandel selbst zu decken. Eine Delegierung der gewerblichen Fertigung an die ländlichen Siedlungen erfolgte, ähnlich wie dies die Fernhandelsstädte Flanderns, Oberitaliens und Süddeutschlands bereits im Mittelalter getan hatten.
In den Städten selbst trat eine Differenzierung des Bürgertums ein: Die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte, die Großhändler, Bankiers und Unternehmer des Manufakturwesens, formierten sich zu einer „zweiten Gesellschaft“, die neben der „ersten Gesellschaft“, der Aristokratie, wachsende politische Bedeutung gewann und sich in eigenen Stadtvierteln von Adel und Hof separierte.