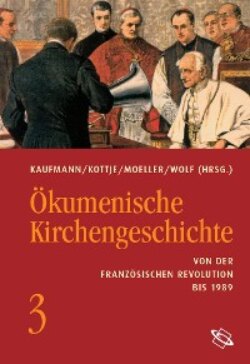Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 13
Für König und Vaterland
ОглавлениеIm Spätwinter und Frühjahr 1813 erhob sich Preußen gegen die französische Fremdherrschaft. Georg Heinrich Ludwig Nicolovius (1767–1839), Leiter der Kultusabteilung im Preußischen Innenministerium, richtete an die Pfarrerschaft die Worte: „Eures Gottes und Eures Königs Ruf ergeht nun an euch, nicht die Stunde zu versäumen, sondern das zu neuem Leben erwachende Volk mit allen Mitteln zu erheben“ (Alfred Nicolovius, Denkschrift auf Georg Heinrich Ludwig Nicolovius, Bonn 1841, 204). Der Freiheitskampf Preußens gegen Napoleon sollte sich mit der Erweckung der Religion verbinden, die Politik vom Glauben beflügelt werden. Am 28. März 1813 verlasen die Geistlichen von den Kanzeln den Aufruf König Friedrich Wilhelms III. (1770–1840) „An mein Volk“. Zahlreiche Anweisungen und Verordnungen belegen: Die Religion galt als Waffe. Geschmiedet wurde sie von der Ministerialbürokratie und vom König. Durch Kabinettsordre vom 9. August 1813 befahl der König seinen Truppen morgens und abends ein Gebet. Es war sein königlicher Wille, „dass Meine Truppen auch in Hinsicht der Gottesverehrung keinen anderen nachgehen sollen, und dass überhaupt bei denselben dem so notwendigen religiösen Sinn immer mehr Raum gegeben und jedes Mittel zur Belebung desselben angewandt werden möge“ (Graf, Gottesbild 94f.).
Modern ausgedrückt wurde die Religion im Befreiungskampf zum Instrument der inneren Führung. Die Pfarrer beteten für den Sieg der preußischen Waffen, sie trauten ins Feld ziehende Kämpfer, sammelten Spenden, hielten Dankgottesdienste nach erfolgreichen Waffengängen. Eine eigene Kriegslyrik, Gebets- und Predigtliteratur feuerte die Bevölkerung an. Ernst Moritz Arndt (1769–1860), einstiger Theologiestudent in Greifswald und damals Sekretär des Freiherrn vom Stein, schickte seine wortmächtigen Flugschriften „An die Preußen“, „Was bedeutet Landsturm und Landwehr“ und den „Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann“ hinaus. In ihnen vereinigte sich die Wucht der prophetischen Sprache des Alten Testaments mit dem Stil Luthers und den Erfordernissen allseitiger Mobilmachung. Der Krieg sei ein heiliger Krieg, von Gott gewollt, las man mit Ergriffenheit. Verstärkt wurden die religiösen Empfindungen in Preußen durch die Russen. Die in heilloser Auflösung befindliche Grande Armée vor sich hertreibend, ritten sie mit Ikonen als Kriegsstandarten ein. Aus ihren Kehlen erscholl die Kampfparole „Für Glaube und Zar“. Das Kreuz der preußischen Landwehr war dem russischen Landwehrkreuz nachempfunden. Schleiermacher, Sohn eines reformierten Feldpredigers der friderizianischen Armee, zu dieser Zeit Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche und Professor an der Theologischen Fakultät der 1810 gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, hielt aufrüttelnde Predigten und redigierte den „Preußischen Correspondenten“. Außerdem traf er Vorbereitungen, um wie sein Vater Feldprediger zu werden. Die Räume der Theologischen Fakultät waren im Herbst 1813 nahezu leer. Das Leben fand auf den Aufmarschstraßen und Schlachtfeldern statt. Die Rückkehr Friedrich Wilhelms III. nach Berlin am 7. August 1814 feierte man mit einem Dankgottesdienst unter freiem Himmel im Berliner Lustgarten.
Die Religiosität der preußischen Erhebung und der Anteil der Geistlichen gehören aus heutiger Sicht zu den umstrittenen Ereignissen der protestantischen Kirchengeschichte. Nahezu anderthalb Jahrhunderte lang richtete sich die protestantische Welt Deutschlands an der Erinnerung an die „glorreichen Tage“ von 1813 auf. Was im Zusammenklang von König, Volk und Kirche geschehen war, galt als Symbol für eine nach wie vor wünschenswerte Synthese von Christlichkeit und vaterländischer Gesinnung. Auf dem Hintergrund der Entkirchlichungsfolgen des Aufklärungsjahrhunderts wirkte der religiöse Sinn aller Stände und Schichten der Gesellschaft während der Befreiungskriege wie eine Verheißung neuer, zu wiederholender Möglichkeiten. So war es 1870/71, 1914 und 1933. Die Religiosität der Befreiungskriege wurde an Wendepunkten der nationalen Geschichte zu einem Bezugspunkt für das protestantische Selbstverständnis in Deutschland.