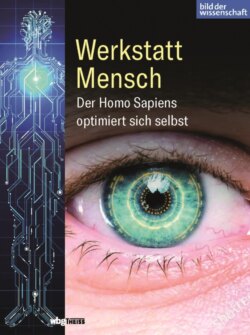Читать книгу Werkstatt Mensch - Группа авторов - Страница 23
Der Mensch im Takt der Maschine
ОглавлениеVaucanson widmete sich schon bald einer anderen Art von Automaten. Er entwickelte einen automatischen Webstuhl. Das Zeitalter der Industrialisierung war angebrochen, die Arbeit der Menschen veränderte sich. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken waren schlecht, die Menschen machten stundenlang die gleichen Handgriffe. Effizienter, schneller, besser war die Devise. Die Maschinen sollten die Leistung optimieren und die Arbeiter hatten sich daran anzupassen. So bekommt der Begriff Automaten-Mensch eine zweite Deutungsebene: ein Mensch, der einer Maschine gleicht. Er handelt wie sie, bewegt sich im Takt, immer weiter ohne Unterbrechung.
Das ist es, was der Schriftsteller E. T. A. Hoffmann ablehnte. Seine Werke „Die Automate“ von 1814 und „Der Sandmann“ von 1816 können als Kritik an dieser gesellschaftlichen Entwicklung gedeutet werden. Ludwig, einem Musiker in „Die Automate“, legt er folgende Worte in den Mund: „Mir sind alle solche Figuren, die dem Menschen nicht sowohl nachgebildet sind, als das Menschliche nachäffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens, im höchsten Grade zuwider.“ Trotzdem kann auch Ludwig nicht widerstehen und besucht wie viele andere in seiner Stadt den „redenden Türken“. Dieser beantwortet alle Fragen der verblüfften Zuschauer offensichtlich ohne Einfluss seines Schöpfers, etwa auch wenn dieser sich anderweitig unterhält.
Die Gefahr, die von diesem Automaten ausgeht, ist weniger greifbar als noch beim Golem oder Frankensteins Monster. Der redende Türke geht nicht gewaltsam gegen seinen Schöpfer vor. Trotzdem weckt er die Angst der Menschen. Denn der Android ist dem Menschen erschreckend ähnlich: Er sieht aus wie ein Mensch, er verhält sich und spricht sogar wie einer und ist es doch nicht. Ludwig sagt: „Das Streben der Mechaniker, immer mehr und mehr die menschlichen Organe zum Hervorbringen musikalischer Töne nachzuahmen oder durch mechanische Mittel zu ersetzen, ist mir der erklärte Krieg gegen das geistige Prinzip.“ Der Mensch steht in Konkurrenz zu den unfehlbaren, unermüdlichen, eigens geschaffenen Androiden. Diese scheinen plötzlich den Takt vorzugeben.
Im Jahre 1738 baute der französische Ingenieur Jacques de Vaucanson den Querflötenspieler, ein Jahr später den mechanischen Trommler als musikalische Automaten.
Die Maschine als Gleichnis für den Menschen: Eine Präsentation der Automaten-Figuren von Pierre Jaquet-Droz (1721–1790) am Hofe Ludwig des XVI.
Der mechanische Trompeter als Musikautomat, gefertigt um 1810 von Friedrich Kaufmann, befindet sich heute im Deutschen Museum.
Aufgegriffen und doch anders ausgearbeitet hat Hoffmann das Automatenmotiv in „Der Sandmann“. In dem Roman verliebt sich der Student Nathanael in Olimpia, die Tochter seines Professors Spalanzani. Nathanael sieht in Olimpia die perfekte Frau: Sie hat ein „schöngeformtes Gesicht“, ist „sehr reich“ und „geschmackvoll gekleidet“. Seine Zuneigung – und sein zunehmender Wahnsinn – lassen ihn die Zeichen, dass Olimpia keine gewöhnliche Frau ist, leugnen. Nicht nur Olimpia, auch Nathanael als wahnsinnig gewordener Mensch verhält sich mechanisch, unterliegt nicht seiner eigenen Kontrolle, sondern ist fremdgesteuert.
Erst als Olimpia im Streit zwischen ihrem Vater Spalanzani – weniger in der leiblichen Vaterrolle als in der als göttlicher Schöpfer – und dem Co-Schöpfer Coppola zerstört wird, ist auch für Nathanael ihr wahres Wesen enthüllt. „Erstarrt stand Nathanael – nur zu deutlich hatte er gesehen, Olimpia’s todterbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen, statt ihrer schwarze Höhlen; sie war eine leblose Puppe.“
So sehr wie Hoffmann mit seinen Romanen das vorherrschende Weltbild seiner Zeit kritisiert, so sehr war auch er vom Fortschritt durch Wissenschaft fasziniert. Er sah im Oktober 1813 eine Vorstellung der Musikautomaten von Johann Georg und Friedrich Kaufmann und spielte daraufhin sogar mit dem Gedanken, selbst einen Automaten zu bauen.